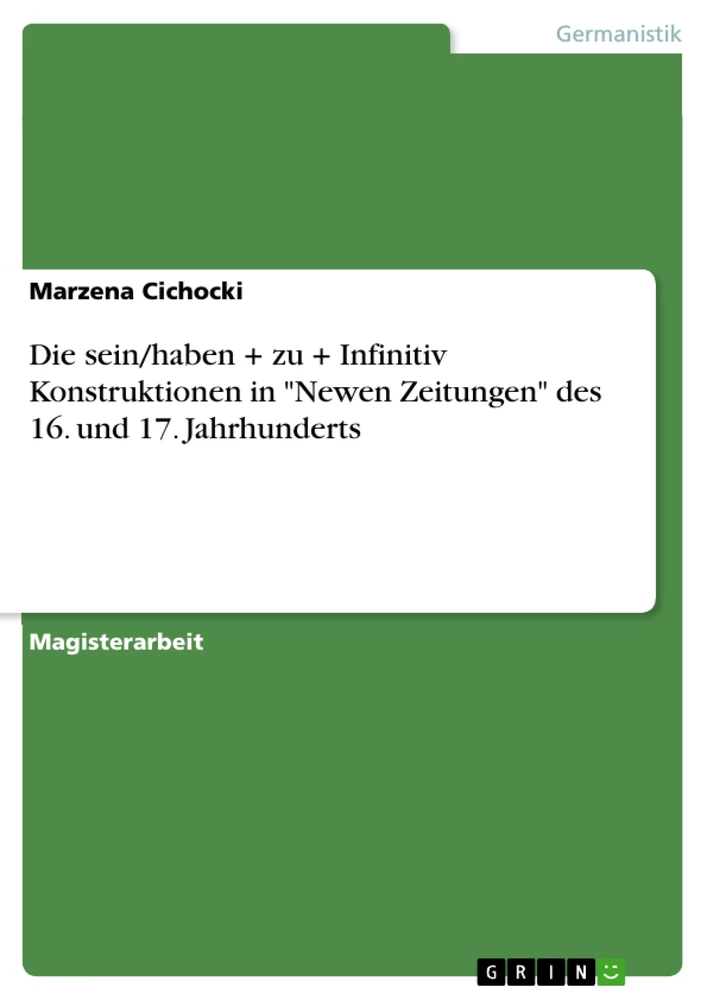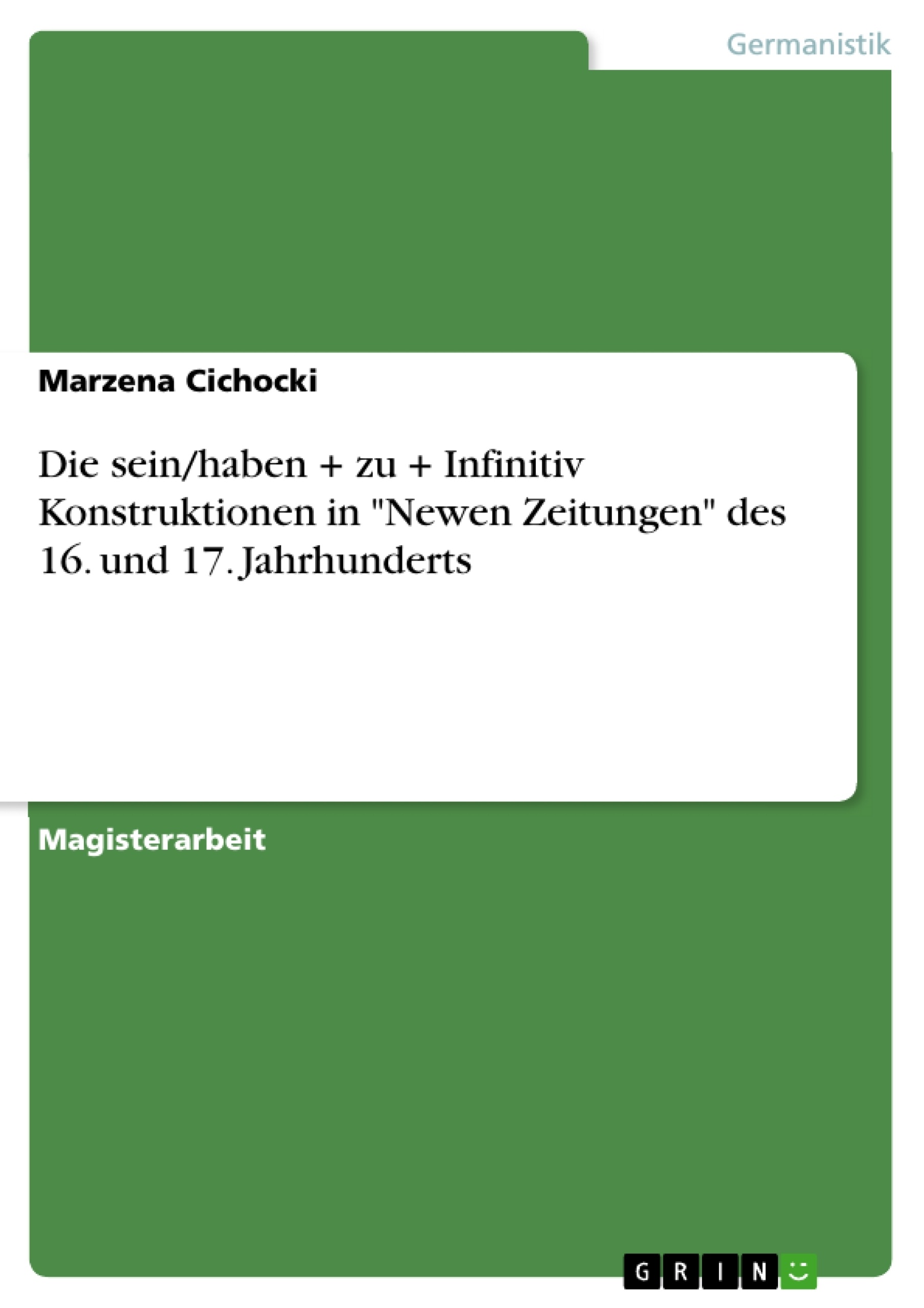Das Hauptanliegen der vorliegenden Arbeit besteht in der Darstellung bisher wenig beachteter "sein/ haben+ zu"+ Infinitiv Konstruktionen, die als modale Konstruktionen betrachtet werden. Ich habe gerade diese Konstruktionen für meine Untersuchung ausgewählt, weil sie eine Sonderstellung im Vergleich mit den anderen Verben, die die Modalität kennzeichnen, einnehmen.
Die Notwendigkeit für die Erstellung eines eigenen Korpus ergab sich allerdings aus meinem umfassenderen Ansatz, für den übliche Ausgangspunkte und Fragestellungen durchweg zu einseitig ausgerichtet waren. Ich beschränke mich in der Untersuchung der "sein/ haben+ zu"+ Infinitiv- Konstruktionen nicht nur auf den Bereich der deutschen Gegenwartssprache, sondern greife in der Analyse auf Belege aus früheren Sprachepochen zurück. Damit soll gezeigt werden, dass die Existenz dieser Konstruktionen keine rein gegenwartssprachliche Erscheinung des Deutschen ist, sondern schon wesentlich früher eine Rolle in der Sprachverwendung gespielt hat.
Die vorliegende Arbeit besteht aus drei Teilen. In den ersten zwei Teilen wird zunächst der theoretische Rahmen errichtet, auf den sich dann die praktische Analyse stützen kann. Die Aufgabenstellung ist somit eine dreifache: Einerseits soll die Arbeit den Gebrauch der "sein/ haben+ zu"+ Infinitiv- Konstruktionen in der Gegenwartssprache darstellen, um aufzuzeigen, welche Bedeutungen den Konstruktionen zukommen. Andererseits ist ein Beitrag zur Geschichte und Entstehung der Neuen Zeitungen beabsichtigt, da sie das eigentliche Untersuchungskorpus bilden.
Etwas anders stellt sich die Lage im funktionalen Teil der Untersuchung dar, in welchem die Bedeutung der "sein/ haben+ zu"+ Infinitiv- Konstruktionen der deutschen Schriftsprache des 16. und 17. Jahrhunderts im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Im folgenden werde ich die theoretischen und systematischen Untersuchungen zum Gebrauch dieser Konstruktionen im Deutschen mit einer empirisch- historischen Analyse dieser Gefüge in Neuen Zeitungen konfrontieren.
In meiner Arbeit konzentriere ich mich darauf, eine erste Grundlage zu schaffen und der Frage der Regelhaftigkeit in Form und Gebrauch der "sein/ haben+ zu"+ Infinitiv- Konstruktionen nicht nur in der Gegenwartssprache, sondern auch in der deutschen Schriftsprache des 16. und 17. Jahrhunderts nachzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I. Die Konstruktionen sein / haben + zu + Infinitiv in der Gegenwartssprache
- 1. Einleitung
- 2. Zum Wesen des Infinitivs
- 2.1 Historische Betrachtung des Infinitivs
- 2.2 Modale Infinitivkonstruktionen: sein und haben + zu
- 3. Die modale Relation bei sein + zu
- 3.1 Konkurrenzformen
- 3.1.1 Möglichkeit
- 3.1.2 Notwendigkeit
- 3.1.3 Negierte Aussagen
- 3.1.4 Das Gerundivum
- 3.2 Modale Passivumschreibungen
- 4. Die modale Relation bei haben + zu
- 5.1 Konkurrenzformen
- 6. Wechselseitiges Verhältnis zwischen sein + zu und haben + zu
- 7. Ambiguität der sein- und haben- Fügung
- 8. Modaler Infinitiv mit einem anderen Abhängigkeitsstatus
- 9. Zusammenfassung
- II. Neue Zeitung als eine der öffentlichen Kommunikationsformen im 16. und 17. Jahrhundert
- 1. Einleitung
- 2. Zeitung heute
- 3. Die Entstehung der Zeitung aus dem brieflichen Verkehr
- 3.1 Brief und geschriebene Zeitung
- 4. Flugblatt und Flugschrift
- 5. Zum Begriff Zeitung
- 6. Neue Zeitungen
- 6.1 Äußeres Erscheinungsbild
- 6.2 Inhalt
- 6.3 Produzenten und Druckorte
- 6.4 Zeitungsmerkmale
- 6.5 Die Sprache
- 7. Zusammenfassung
- III. Die sein/haben + zu + Infinitiv-Konstruktionen in Neuen Zeitungen des 16. und 17. Jahrhunderts
- 1. Einleitung
- 2. Druckorte und Produzenten
- 3. Das zu untersuchende Korpus
- 4. Sein zu + Infinitiv
- 4.1 Zu den häufigsten sein + zu + Infinitiv Kombinationen
- 4.2 Konstruktionen mit potentialer Modalität
- 4.3 Konstruktionen mit adhortativer Modalität
- 5. Haben zu + Infinitiv
- 5.1 Zu den häufigsten haben + zu + Infinitiv Kombinationen
- 5.2 Konstruktionen mit adhortativer Modalität
- 5.3 Konstruktionen mit potentialer Modalität
- 6. Gerundivkonstruktionen
- 7. Analyseergebnisse
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sein/haben + zu + Infinitiv-Konstruktionen, ihre Verwendung in der deutschen Gegenwartssprache und ihre historische Entwicklung anhand von Beispielen aus Neuen Zeitungen des 16. und 17. Jahrhunderts. Das Ziel ist es, die modalen Bedeutungen dieser Konstruktionen zu beschreiben und ihre Rolle in der Sprachentwicklung aufzuzeigen.
- Modalität von sein/haben + zu + Infinitiv in der Gegenwartssprache
- Historische Entwicklung der sein/haben + zu + Infinitiv-Konstruktionen
- Analyse der Konstruktionen in Neuen Zeitungen des 16. und 17. Jahrhunderts
- Vergleich der Verwendung in verschiedenen Sprachstufen
- Untersuchung der Regelhaftigkeit in Form und Gebrauch der Konstruktionen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Die Konstruktionen sein / haben + zu + Infinitiv in der Gegenwartssprache: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der sein/haben + zu + Infinitiv-Konstruktionen in der modernen deutschen Sprache. Es untersucht die modalen Bedeutungen (Möglichkeit, Notwendigkeit), die Konkurrenzformen und die semantischen Unterschiede zwischen den beiden Konstruktionen. Ausführlich werden die Bedeutungsnuancen und die syntaktischen Besonderheiten dieser Konstruktionen beleuchtet, inklusive einer Diskussion über Passivumschreibungen und die Ambiguität der Fügungen. Der Fokus liegt auf der logisch-grammatischen Modalität, die ein besonderes Verhältnis zwischen Subjekt und Handlung ausdrückt.
II. Neue Zeitung als eine der öffentlichen Kommunikationsformen im 16. und 17. Jahrhundert: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der Neuen Zeitungen als öffentliche Kommunikationsform im 16. und 17. Jahrhundert. Es verfolgt die Entwicklung von Briefen und Flugschriften zur Zeitung, analysiert deren äußeres Erscheinungsbild, Inhalt, Produzenten und Druckorte und beschreibt die sprachlichen Besonderheiten. Die Zusammenfassung fasst die historische Entwicklung und die wichtigsten Merkmale der Neuen Zeitungen zusammen und liefert einen Kontext für die spätere sprachwissenschaftliche Analyse.
III. Die sein/haben + zu + Infinitiv-Konstruktionen in Neuen Zeitungen des 16. und 17. Jahrhunderts: In diesem Kapitel wird die empirische Analyse der sein/haben + zu + Infinitiv-Konstruktionen in einem Korpus von Neuen Zeitungen des 16. und 17. Jahrhunderts vorgestellt. Es werden die häufigsten Kombinationen, die modalen Bedeutungen (potentielle und adhortative Modalität) und der Gebrauch von Gerundivkonstruktionen untersucht. Die Analyseergebnisse beleuchten die Verwendung dieser Konstruktionen in historischen Texten und setzen sie in Beziehung zu den Ergebnissen der Analyse der Gegenwartssprache.
Schlüsselwörter
sein/haben + zu + Infinitiv, modale Konstruktionen, Modalität, deutsche Gegenwartssprache, historische Sprachwissenschaft, Neue Zeitungen, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, Korpusanalyse, potentielle Modalität, adhortative Modalität, Gerundivum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der sein/haben + zu + Infinitiv-Konstruktionen in Neuen Zeitungen des 16. und 17. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Verwendung der sein/haben + zu + Infinitiv-Konstruktionen in der deutschen Sprache. Sie betrachtet sowohl die moderne Verwendung als auch die historische Entwicklung dieser Konstruktionen, insbesondere anhand von Beispielen aus Neuen Zeitungen des 16. und 17. Jahrhunderts.
Welche Aspekte der sein/haben + zu + Infinitiv-Konstruktionen werden untersucht?
Die Analyse umfasst die modalen Bedeutungen (Möglichkeit, Notwendigkeit, Aufforderung), die Konkurrenzformen zu diesen Konstruktionen, semantische Unterschiede zwischen "sein + zu" und "haben + zu", Passivumschreibungen, Ambiguitäten und die syntaktischen Besonderheiten. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der Verwendung in verschiedenen Sprachstufen (Moderne Sprache vs. 16./17. Jahrhundert).
Welche Rolle spielen die Neuen Zeitungen des 16. und 17. Jahrhunderts in der Untersuchung?
Die Neuen Zeitungen dienen als Korpus für die historische Sprachbetrachtung. Die Arbeit analysiert die Verwendung der sein/haben + zu + Infinitiv-Konstruktionen in diesen Texten, um deren historische Entwicklung und sprachliche Besonderheiten im Kontext der öffentlichen Kommunikation dieser Zeit zu untersuchen.
Welche Methoden werden in dieser Arbeit angewendet?
Die Arbeit kombiniert eine deskriptive Darstellung der sein/haben + zu + Infinitiv-Konstruktionen in der Gegenwartssprache mit einer empirischen Analyse eines Korpus von Neuen Zeitungen des 16. und 17. Jahrhunderts. Die Analyse umfasst die Identifizierung der häufigsten Kombinationen, die Bestimmung der modalen Bedeutungen (potentielle und adhortative Modalität) und die Untersuchung von Gerundivkonstruktionen.
Welche Ergebnisse werden in der Arbeit präsentiert?
Die Ergebnisse der Arbeit umfassen eine detaillierte Beschreibung der modalen Bedeutungen der sein/haben + zu + Infinitiv-Konstruktionen, einen Vergleich ihrer Verwendung in der Gegenwartssprache und in den historischen Texten, sowie eine Analyse der Häufigkeit und des Kontextes der verschiedenen Konstruktionen im untersuchten Korpus. Die Arbeit zeigt die Entwicklung und den Wandel dieser Konstruktionen über die Zeit auf.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Kapitel I behandelt die sein/haben + zu + Infinitiv-Konstruktionen in der Gegenwartssprache; Kapitel II beleuchtet die Neuen Zeitungen des 16. und 17. Jahrhunderts als Kommunikationsform; Kapitel III präsentiert die empirische Analyse der Konstruktionen in den historischen Texten. Ein Vorwort und ein Resümee runden die Arbeit ab.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: sein/haben + zu + Infinitiv, modale Konstruktionen, Modalität, deutsche Gegenwartssprache, historische Sprachwissenschaft, Neue Zeitungen, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, Korpusanalyse, potentielle Modalität, adhortative Modalität, Gerundivum.
- Quote paper
- Marzena Cichocki (Author), 2004, Die sein/haben + zu + Infinitiv Konstruktionen in "Newen Zeitungen" des 16. und 17. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437776