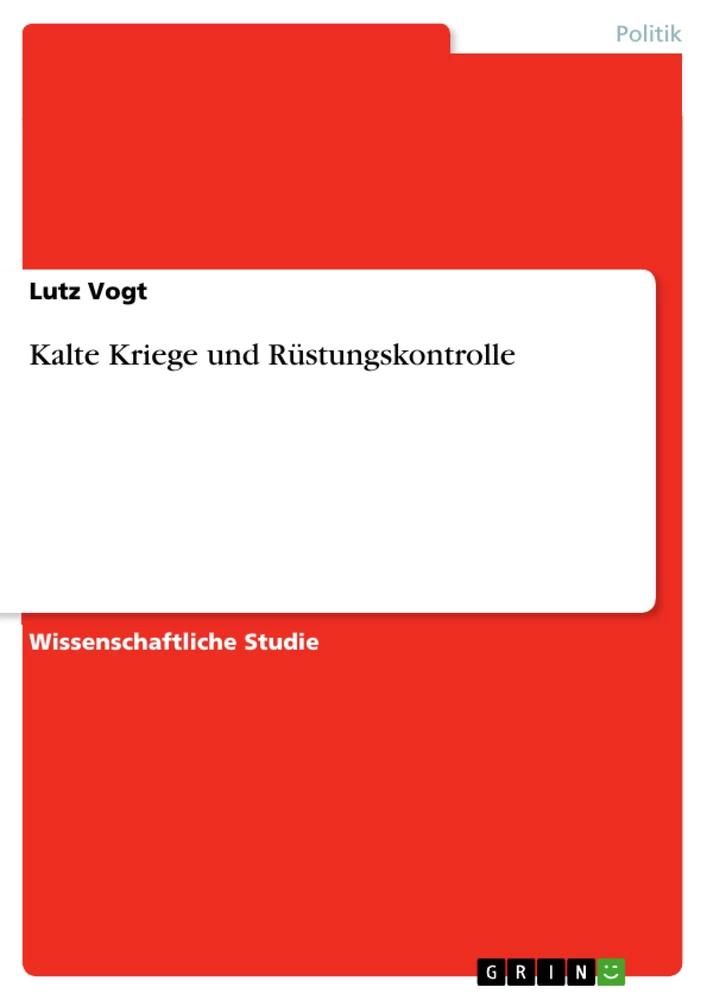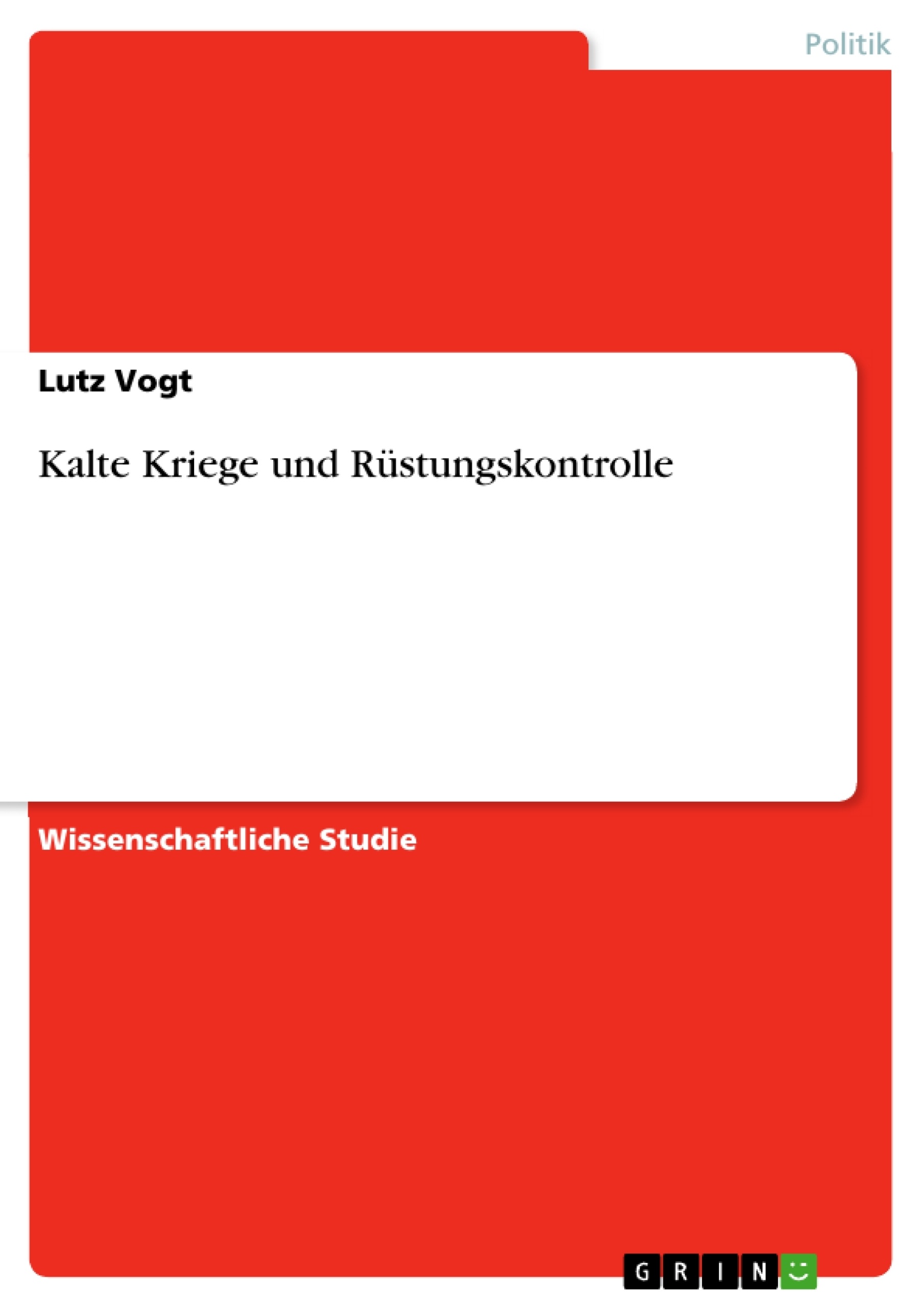Rüstungskontrolle als Instrument der auswärtigen Politik erlangte ein besonderes Gewicht im 20. Jahrhundert, nachdem die Kernwaffen den Krieg als ein gewaltsames Mittel der Politik zwischen Nuklearmächten zu einem selbstmörderischen Unterfangen werden ließen. Die nuklearen Zauberlehrlinge suchten im gegenseitigen Überlebensinteresse nach Wegen und Methoden, wie sie die Geister, die bereits aus ihren Flaschen entwichen waren, wieder einfangen konnten.
Im Ausgang des vergangenen Jahrhunderts wurde immer klarer, dass auch ein konventioneller Waffengang in Europa als ein gemeinsamer Weg in den Untergang enden würde.
Soweit Politiker ihre Verantwortung gegenüber den eigenen Nationen fühlten und entsprechend handelten, schickten die Koalitionen beider Supermächte ihre Diplomaten und Militärs an Verhandlungstische und balancierten ihre Sicherheitsinteressen auch mittels Rüstungskontrollverträgen aus. Sie umfassten dabei nukleare wie konventionelle Waffen. Die gegenseitigen Handlungen sollten berechenbar gestaltet werden, um Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen aufzubauen.
Das vorliegende Buch widmet sich wichtigen Rahmenbedingungen dieser Verhandlungen in den letzten 60 Jahren und den dabei ausgehandelten Verträgen. Es zeigt auch die Risiken, die entstehen, wenn heutzutage in immer mehr Bereichen, die Ausbalancierung von Sicherheit und der Aufbau von Vertrauen von wichtigen Akteuren in den internationalen Beziehungen verweigert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Im letzten Jahrzehnt des 1. Kalten Krieges
- Rahmenvereinbarungen der Rüstungskontrolle zwischen den Nuklearmächten im 1. Kalten Krieg
- Das Madrider KSZE-Treffen und europäische Rüstungskontrolle
- Umsetzung der Stockholmer Vereinbarungen durch die DDR
- Die Durchführung von Manöverbeobachtungen durch Vertreter der DDR im Ausland
- Die Sicherstellung von Manöverbeobachtungen auf dem Territorium der DDR
- Die Sicherstellung von Inspektionen auf dem Territorium der DDR
- Die Durchführung von Inspektionen durch die DDR
- Resümee
- Die DDR und der INF-Vertrag
- Raketenkomplexe kürzerer Reichweite (OKA) auf DDR-Territorium
- Epilog und 2+4-Vertrag
- Kalte Kriege und Rüstungskontrolle
- Nach dem Krieg ist vor dem Krieg?
- Globale und europäische Ordnung nach dem 1. Kalten Krieg
- Sein oder Nicht-Sein und Haben oder Nicht-Haben
- Proliferation und globale Politik
- Weltraumrüstung, Raketen- und Satellitenabwehr
- Prompt Global Strike (PGS), Hyperschallkomplexe
- Rüstungskontrolle?
- Rüstung als Innovationsmotor der Wirtschaft
- Neues und Altes und zur kontrollierten Rüstung
- New START
- China der,,dritte Mann“
- 2New START und die nukleare Nichtweiterverbreitung
- Die Zukunft des INF-Vertrages
- Nachkriegsordnungen in Europa, KSZE und OSZE - Echo aus ferner Vergangenheit
- Die Zukunft des Krieges - Gefahren durch Bits und Bytes, Cyberkriege, „künstliche Intelligenz“ und elektromagnetische Waffen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit „Kalte Kriege und Rüstungskontrolle“ befasst sich mit der Geschichte und der Zukunft der Rüstungskontrolle im Kontext der internationalen Beziehungen. Der Autor zeichnet ein umfassendes Bild der Entwicklung der Rüstungskontrolle, insbesondere im 1. Kalten Krieg, und analysiert die Herausforderungen, die sich durch die technologischen Fortschritte und die sich verändernden Machtverhältnisse stellen.
- Die Entwicklung der Rüstungskontrolle im 1. Kalten Krieg
- Die Rolle der DDR in der internationalen Rüstungskontrolle
- Die Herausforderungen der Rüstungskontrolle im 21. Jahrhundert
- Die Bedeutung von New START für die nukleare Abrüstung
- Die Zukunft des INF-Vertrages und die Auswirkungen auf die europäische Sicherheitsarchitektur
Zusammenfassung der Kapitel
- Im letzten Jahrzehnt des 1. Kalten Krieges: Dieses Kapitel behandelt die Zuspitzung des Kalten Krieges zwischen den USA und der UdSSR in den 1980er Jahren und beleuchtet die Rolle der Rüstungskontrolle in dieser Zeit.
- Rahmenvereinbarungen der Rüstungskontrolle zwischen den Nuklearmächten im 1. Kalten Krieg: Dieses Kapitel analysiert die wichtigsten Rahmenvereinbarungen zur Rüstungskontrolle zwischen den Nuklearmächten im 1. Kalten Krieg, ihre Ziele und ihre Auswirkungen.
- Das Madrider KSZE-Treffen und europäische Rüstungskontrolle: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle des Madrider KSZE-Treffens in der europäischen Rüstungskontrolle und untersucht die Bemühungen um eine stärkere Kooperation.
- Umsetzung der Stockholmer Vereinbarungen durch die DDR: Dieses Kapitel beschreibt die Umsetzung der Stockholmer Vereinbarungen durch die DDR und zeigt die Herausforderungen, die sich daraus für die DDR ergaben.
- Die Durchführung von Manöverbeobachtungen durch Vertreter der DDR im Ausland: Dieses Kapitel behandelt die Durchführung von Manöverbeobachtungen durch Vertreter der DDR im Ausland und die damit verbundenen Erfahrungen.
- Die Sicherstellung von Manöverbeobachtungen auf dem Territorium der DDR: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Sicherstellung von Manöverbeobachtungen auf dem Territorium der DDR.
- Die Sicherstellung von Inspektionen auf dem Territorium der DDR: Dieses Kapitel behandelt die Sicherstellung von Inspektionen auf dem Territorium der DDR und die dabei auftretenden Herausforderungen.
- Die Durchführung von Inspektionen durch die DDR: Dieses Kapitel beschreibt die Durchführung von Inspektionen durch die DDR.
- Resümee: Dieses Kapitel fasst die zentralen Erkenntnisse der ersten Kapitel zusammen und bietet eine kritische Analyse der bisherigen Rüstungskontrollbemühungen.
- Die DDR und der INF-Vertrag: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der DDR im Kontext des INF-Vertrages und die Auswirkungen des Vertrages auf die DDR.
- Raketenkomplexe kürzerer Reichweite (OKA) auf DDR-Territorium: Dieses Kapitel behandelt die Frage der Raketenkomplexe kürzerer Reichweite (OKA) auf DDR-Territorium und die damit verbundenen Sicherheitsbedenken.
- Epilog und 2+4-Vertrag: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des 2+4-Vertrages für die deutsche Wiedervereinigung und die Auswirkungen auf die Rüstungskontrolle.
- Nach dem Krieg ist vor dem Krieg?: Dieses Kapitel behandelt die Frage, ob nach dem Ende des Kalten Krieges neue Konflikte drohen und welche Herausforderungen die Rüstungskontrolle in einer neuen Weltordnung stellen.
- Globale und europäische Ordnung nach dem 1. Kalten Krieg: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen des Endes des Kalten Krieges auf die globale und europäische Ordnung und die Rolle der Rüstungskontrolle in dieser neuen Weltordnung.
- Sein oder Nicht-Sein und Haben oder Nicht-Haben: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung von militärischer Macht und Ressourcen in der heutigen Welt und die Herausforderungen der Rüstungskontrolle im Kontext der globalen Ressourcenverteilung.
- Proliferation und globale Politik: Dieses Kapitel behandelt die Problematik der Proliferation von Massenvernichtungswaffen und ihre Auswirkungen auf die internationale Politik und die Rüstungskontrolle.
- Weltraumrüstung, Raketen- und Satellitenabwehr: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklungen in der Weltraumrüstung und die wachsende Bedeutung von Raketen- und Satellitenabwehrsystemen.
- Prompt Global Strike (PGS), Hyperschallkomplexe: Dieses Kapitel beleuchtet die technologischen Entwicklungen im Bereich der Prompt Global Strike-Waffen und der Hyperschallkomplexe und deren Bedeutung für die Rüstungskontrolle.
- Rüstungskontrolle?: Dieses Kapitel stellt die Frage nach der Zukunft der Rüstungskontrolle in einer Welt, die von technologischen Veränderungen und neuen Bedrohungen geprägt ist.
- Rüstung als Innovationsmotor der Wirtschaft: Dieses Kapitel behandelt die Rolle der Rüstung in der Wirtschaft und die Auswirkungen auf die Innovation und den technologischen Fortschritt.
- Neues und Altes und zur kontrollierten Rüstung: Dieses Kapitel reflektiert über die Herausforderungen und Chancen der Rüstungskontrolle im 21. Jahrhundert und die Notwendigkeit einer kontrollierten Rüstung.
- New START: Dieses Kapitel analysiert den New START-Vertrag und seine Bedeutung für die nukleare Abrüstung.
- China der,,dritte Mann“: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle Chinas in der internationalen Rüstungskontrolle und die Herausforderungen, die sich durch den Aufstieg Chinas stellen.
- 2New START und die nukleare Nichtweiterverbreitung: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen von New START auf die nukleare Nichtweiterverbreitung und die Bedeutung des Vertrages für die globale Sicherheit.
- Die Zukunft des INF-Vertrages: Dieses Kapitel analysiert die Zukunft des INF-Vertrages und die Auswirkungen eines möglichen Auslaufens des Vertrages auf die europäische Sicherheitsarchitektur.
- Nachkriegsordnungen in Europa, KSZE und OSZE - Echo aus ferner Vergangenheit: Dieses Kapitel reflektiert über die Nachkriegsordnungen in Europa, die Rolle der KSZE und der OSZE und die Bedeutung dieser Organisationen für die europäische Sicherheit.
- Die Zukunft des Krieges - Gefahren durch Bits und Bytes, Cyberkriege, „künstliche Intelligenz“ und elektromagnetische Waffen: Dieses Kapitel behandelt die neuen Bedrohungen durch Cyberkriege, „künstliche Intelligenz“ und elektromagnetische Waffen und die Herausforderungen der Rüstungskontrolle in der digitalen Welt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit „Kalte Kriege und Rüstungskontrolle“ beschäftigt sich mit zentralen Themen der internationalen Politik wie Rüstungskontrolle, Nuklearwaffen, Abrüstung, Proliferation, Sicherheitspolitik, internationale Beziehungen, Kalter Krieg, NATO, Warschauer Pakt, KSZE, OSZE, New START, INF-Vertrag, Cyberkriege, Künstliche Intelligenz, Weltraumrüstung.
- Quote paper
- Lutz Vogt (Author), 2018, Kalte Kriege und Rüstungskontrolle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437645