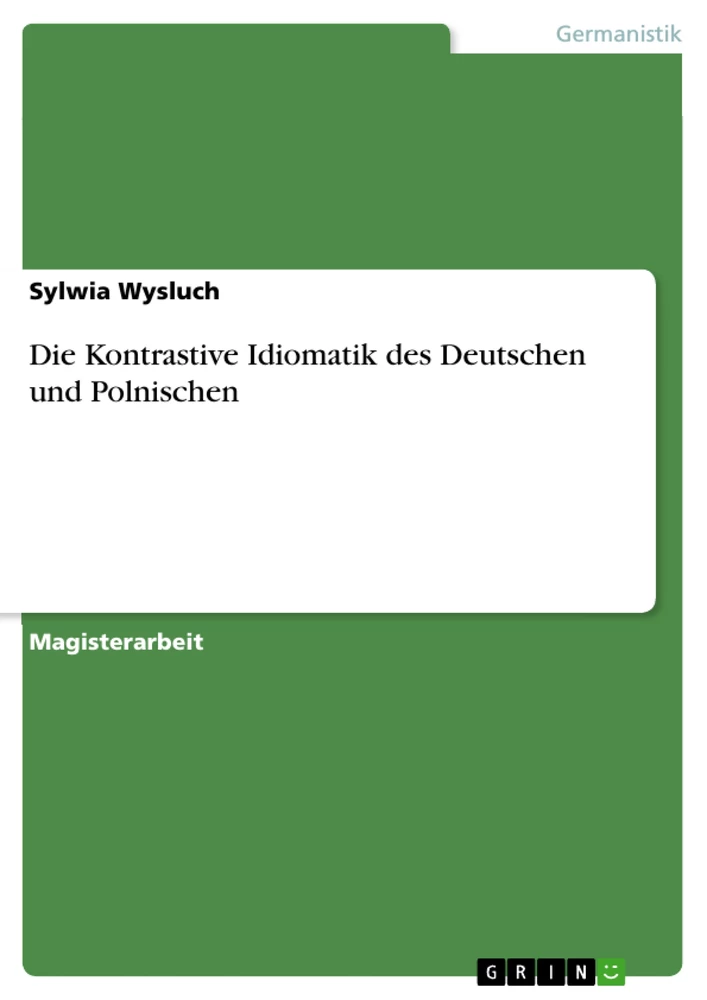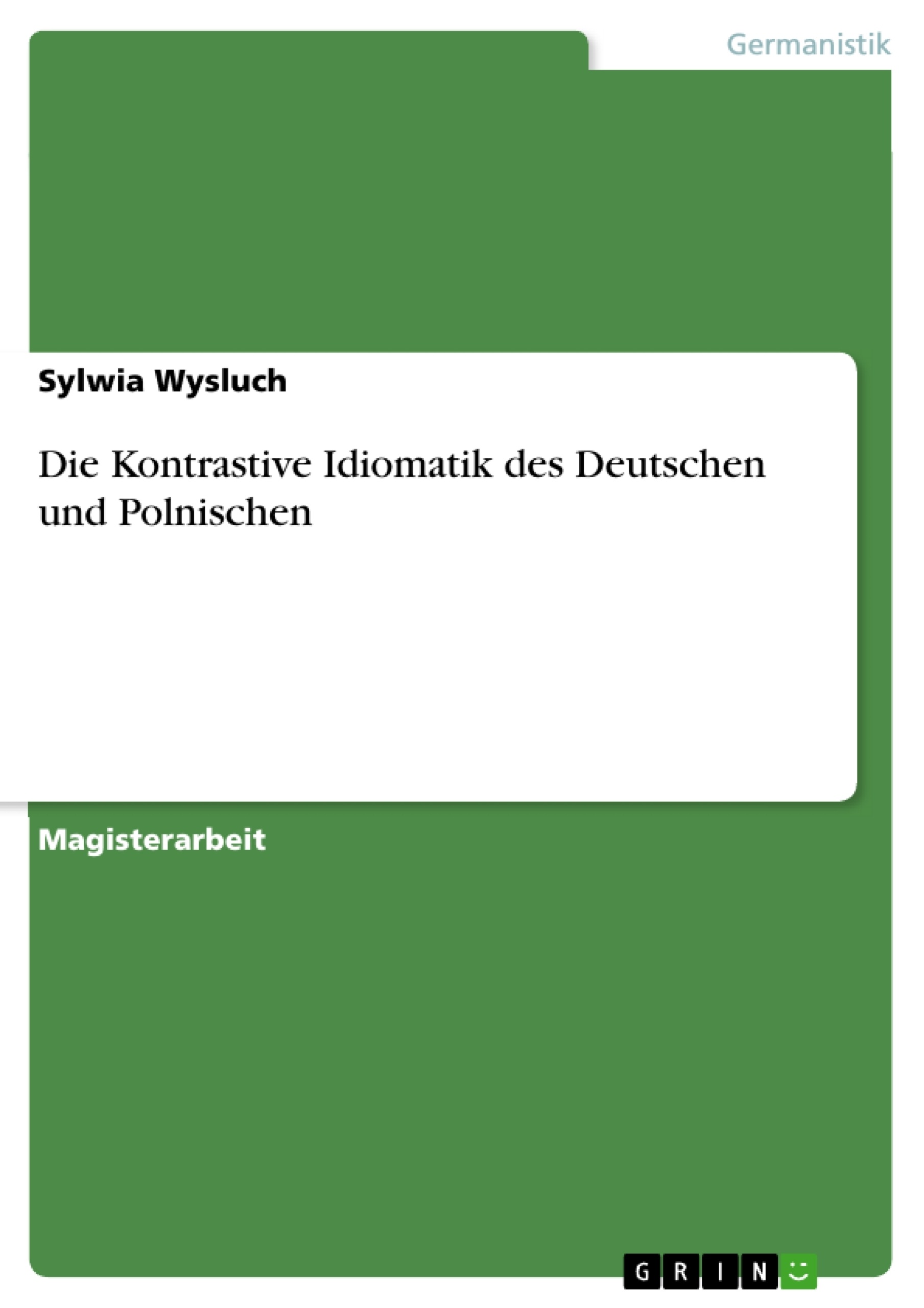Die Verwendung der natürlichen Sprache ist eine der kompliziertesten menschlichen kognitiven Aktivitäten. Trotz ihrer großen Komplexität verwenden Menschen Sprache mit großer Leichtigkeit wie das Atmen oder das Gehen. In Gegensatz zu anderen geistigen Aufgaben gibt es Stufen der natürlichen Sprachrezeption und -produktion. Verschiedene Fachrichtungen, unter anderem die Sprachpsychologie, auch die Psycholinguistik genannt, versuchen die der natürlichen Sprache und kognitiven Sprachverarbeitung zugrunde liegenden Fähigkeiten zu untersuchen. Die psychologische Seite sprachlicher Strukturen bildet eine Grundlage der linguistischen Theoriebildung. Verhalten, Wahrnehmung, Lernen, Gedächtnis, Motivation sind Schlüsselbegriffe für die Psychologie, und Wort, Satz, Grammatik, Bedeutung, Lautform gehören zur Linguistik und stehen im engen Zusammenhang mit dem mentalen Lexikon und umschreiben Gegenstandsaspekte, auf die die psycholinguistische Theoriebildung angelegt ist.
Das Ziel der Sprache ist die zwischenmenschliche Kommunikation, die konstitutiver Bestandteil des realen gesellschaftlichen Lebensprozesses ist. Sie spielt sich im Rahmen verschiedenartiger sozialer Strukturen ab. Sprachliche Äußerungen beziehen stets auch die Kenntnissysteme ein, die dem Aufbau konzeptuell strukturierter Gedanken zugrunde liegen. Die Forschung sprachlicher Kommunikationsvorgänge schafft die Möglichkeit, die Wiedergabe konzeptueller Strukturen zu vermitteln und den Mikrokosmos der menschlichen Kognition zu entdecken.
Die Aufgabe der Psycholinguistik ist es, Theorien über die menschlichen kognitiven Prozesse zu entwickeln, die beim Sprachgebrauch auftreten. Gegenstand der Untersuchungen ist deshalb der primäre Sprachgebrauch: das Erzeugen von Sprachäußerungen (Sprachproduktion) und ihr Verstehen (Sprachrezeption). Die Sprachwissenschaft beschäftigt sich mit dem Produkt der sprachlichen Prozesse. Die Psycholinguisten versuchen, aufgrund der Daten, die aus der empirischen Analyse der Produkte des sprachlichen Prozesses resultieren, die internen Regeln und Prinzipien der sprachlichen Repräsentationen zu entschlüsseln.
Inhaltsverzeichnis
- I. Der theoretische Teil
- 1. Mentale Repräsentationen von phraseologischen Einheiten
- 1.1 Zur Terminologie
- 1.2 Das mentale Lexikon
- 1.3 Neurophysiologische und psychologische Aspekte des
- 2. Phraseolexeme im mentalen Lexikon
- 3. Die lexikalische Ebene
- 3.1. Die substantivischen Phraseologismen.
- 3.2. Die adjektivischen Phraseolexeme
- 3.3 Die adverbialen Phraseolexemen..
- 3.4 Die verbalen Phraseolexeme.......
- 4. Die semantische Ebene
- 4.1 Idiomatizität..
- 4.2 Semantisch-syntaktische Stabilität
- 4.3 Zur Konnotation der Phraseologismen
- 4.4 Die denotative Bedeutung der Wörter.
- 4.5 Zusammenfassung zum Kapitel „Die semantische Ebene“.
- 5. Die konzeptuelle Ebene
- 5.1 Zusammenfassung zum Kapitel „, Die konzeptuelle Ebene\"..
- 1. Mentale Repräsentationen von phraseologischen Einheiten
- II. Der empirische Teil
- 1. Einleitung zum empirischen Teil.
- 2. Das Korpus
- 2.1 Die Vorgehensweise .......
- 3. Die kontrastive Darstellung der phraseologischen Einheiten im..
- 3.1 Die lexikalische Ebene....
- 3.2 Schematische Darstellungen der Komponentenkategorien in den beiden Sprachen.
- 3.3 Schematische Gegenüberstellung der deutschen und polnischen phraseologischen Komponentenkategorien.
- 4. Die semantische Ebene - eine qualitative Auswertung der Untersuchung.
- III. Der empirische Teil -
- 1.Sprachliche Indikatoren der politischen Sprache....
- 22.Die Vorgehensweise..
- 3. Die lexikalische Ebene .....
- 4. Die semantisch - konzeptuelle Analyse der Phraseologismen.…….....
- 4.1 Die Komponentenkategorie „Die Kommunikation\".
- 4.2 Die Komponentenkategorie „Die nächste Umgebung“.
- 4.3 Die Komponentenkategorie „, Naturerscheinungen“.
- 4.4 Die Komponentenkategorie,,Der Krieg\".
- 4.5 Die Komponentenkategorie „, Theater“.
- 4.6 Die Komponentenkategorie „Die Körperteile“.
- 4.7 Die Komponentenkategorie,,Bewegung\".
- 4.8 Die Komponentenkategorie „Der Raum“.
- 4.9 Die Komponentenkategorie „Reisen“.
- 5.Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema der kontrastiven Idiomatik im modernen Deutsch und Polnischen. Sie untersucht, wie phraseologische Einheiten in den beiden Sprachen repräsentiert und verarbeitet werden, sowohl auf der lexikalischen als auch auf der semantischen Ebene.
- Mentale Repräsentationen phraseologischer Einheiten
- Kontrastive Analyse der lexikalischen und semantischen Eigenschaften von Phraseologismen
- Einfluss von kulturellen und sprachlichen Faktoren auf die idiomatische Verwendung
- Die Rolle von Phraseologismen in der politischen Sprache
- Entwicklung eines Modells zur Erklärung der Verarbeitung von Phraseologismen
Zusammenfassung der Kapitel
Der theoretische Teil der Arbeit konzentriert sich auf die Vorstellung der mentalen Repräsentationen von phraseologischen Einheiten. Hier werden wichtige Begriffe wie das mentale Lexikon und die Neurophysiologie des Sprachverstehens erläutert.
Der empirische Teil untersucht die Kontraste zwischen deutschen und polnischen Phraseologismen. Es werden sowohl die lexikalischen als auch die semantischen Aspekte dieser Einheiten analysiert.
Schlüsselwörter
Phraseologismen, Idiomatizität, kontrastive Linguistik, mentales Lexikon, Sprachverarbeitung, politische Sprache, Kulturvergleich, deutsche Sprache, polnische Sprache.
- Quote paper
- Sylwia Wysluch (Author), 2004, Die Kontrastive Idiomatik des Deutschen und Polnischen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437563