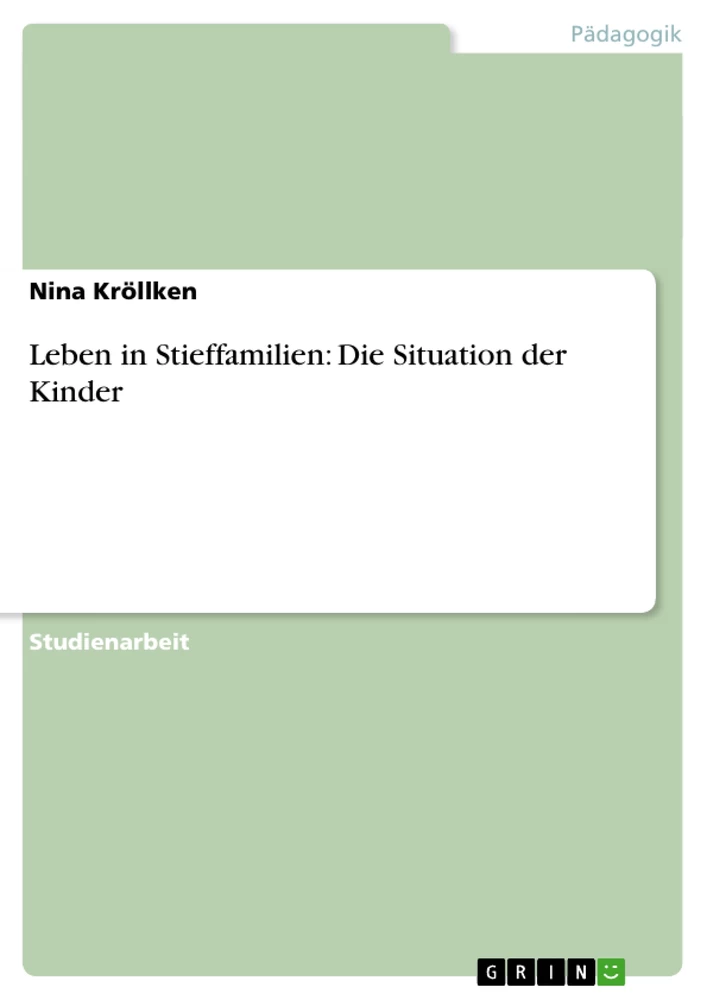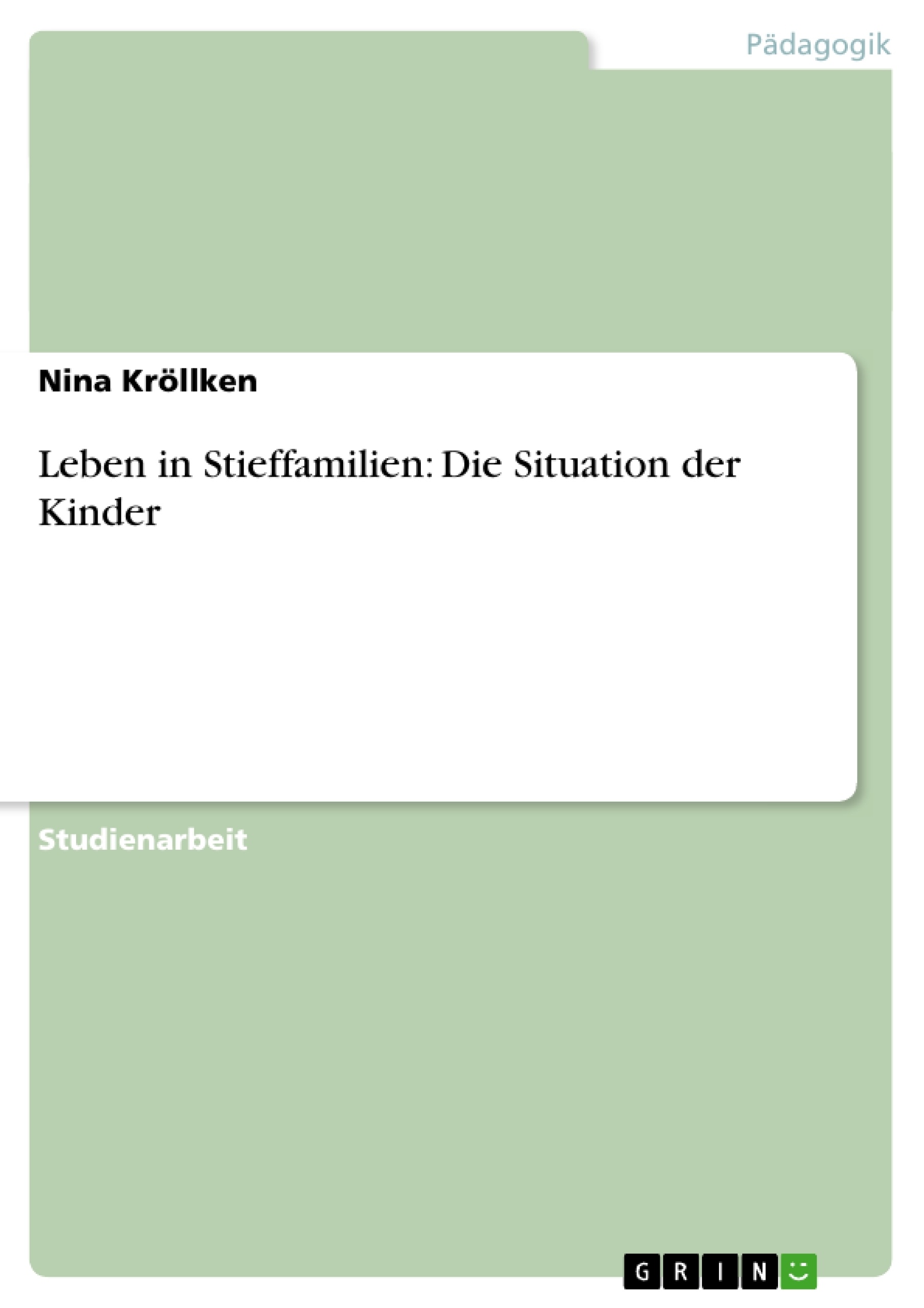Eine Stieftochter erzählt über ihre Familie:
„Ich finde das ganz gut, daß wir so unnormal sind, nicht so alltäglich. Also, daß meine Eltern so geschieden sind und daß ich dann noch einmal drei Brüder habe von einem anderen Vater. Ja, und daß mein Vater dann wiedergeheiratet hat und daß ich eigentlich noch eine Stiefschwester habe. Bei uns ist immer etwas los und es passiert oft etwas Außergewöhnliches.“
(zit. n. Friedl / Maier-Aichen 1991, S.238)
In den letzten Jahren häufen sich Berichte über steigende Scheidungszahlen und eine abnehmende Heiratsneigung. Heftige Diskussionen um das möglicherweise herannahende „Ende der Familie“ sind entbrannt. Doch solche Kontroversen vernachlässigen einerseits, dass das Vorhandensein der Kernfamilie als quasi einzige Familienform der 50er und 60er Jahre eine nahezu einmalige Situation war, und dass andererseits die heute nebeneinander existierenden alternativen Familienformen durchaus auch positiv gesehen werden können.
Die Stieffamilie ist eine dieser Alternativen zur Kernfamilie, die zwar keine gänzlich neue Erscheinung ist, dennoch im Rahmen der gestiegenen Scheidungshäufigkeit zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Umso mehr verwundert es, dass die Menge an Literatur zu diesem Thema bislang nicht gerade üppig ist. Es mangelt besonders an quantitativen Studien zur Vorkommenshäufigkeit von Stieffamilien; qualitative Studien aus dem therapeutischen Bereich finden sich dagegen eher häufiger. Diese haben jedoch das Problem, dass sie sich vor allem mit Stieffamilien beschäftigen, die therapeutische Hilfe benötigen, weil sie mit ihrer Situation nicht so ohne weiteres zu Recht kommen. Dadurch könnte der Eindruck entstehen, es handele sich bei Stieffamilien grundsätzlich um „Problemfamilien“, was selbstverständlich nicht zutrifft.
Es ist ein zentrales Anliegen dieser Arbeit, die strukturellen Besonderheiten und Herausforderungen von Stieffamilien unter die Lupe zu nehmen, ohne dabei das Bild einer problembelasteten Familienform zu zeichnen. Es sollen daher auch die besonderen Chancen dieser Familien betont werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Rückblick: Entwicklung der bürgerlichen Kernfamilie
- Zur Geschichte der Stieffamilie
- Stieffamilien heute
- Definition, Erscheinungsformen und begriffliche Vorbemerkungen
- Entwicklung des Scheidungsrisikos
- Häufigkeit von Stieffamilien
- Charakteristika der Stieffamilie
- Beziehungsstrukturen im Vergleich zur Kernfamilie
- Besondere Herausforderungen
- Kinder in der Stieffamilie
- Vorgeschichte der Stiefkinder
- Verhältnis zum außerhalb lebenden leiblichen Elternteil
- Verhältnis zum Stiefelternteil
- Geschwisterbeziehungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die strukturellen Besonderheiten und Herausforderungen von Stieffamilien, ohne dabei ein negatives Bild der Familienform zu zeichnen. Sie beleuchtet die Chancen und die besonderen Herausforderungen für Kinder in Stieffamilien.
- Die Entwicklung der bürgerlichen Kernfamilie im historischen Kontext
- Die Geschichte und Entwicklung der Stieffamilie
- Definition, Erscheinungsformen und Häufigkeit von Stieffamilien heute
- Vergleich der Beziehungsstrukturen in Kern- und Stieffamilien
- Die Situation von Kindern in Stieffamilien und deren Beziehungsebenen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangssituation und die Relevanz des Themas Stieffamilie dar. Es wird auf die steigenden Scheidungsraten und die zunehmende Bedeutung alternativer Familienformen hingewiesen. Die Arbeit soll die Besonderheiten und Herausforderungen von Stieffamilien beleuchten, ohne dabei ein defizit-orientiertes Bild zu zeichnen.
Kapitel 2 gibt einen historischen Überblick über die Entwicklung der bürgerlichen Kernfamilie und zeigt, dass die Familie der 50er und 60er Jahre eine nahezu einmalige Situation war. Es wird deutlich, dass die heutige Diskussion um die Zukunft der Familie auf einer historischen Entwicklung basiert.
Kapitel 3 beleuchtet die Geschichte der Stieffamilie und zeigt, dass sie kein neuartiges Phänomen ist. Es wird darauf hingewiesen, dass die Stieffamilie bereits in der vorindustriellen Zeit eine gängige Familienform war.
Kapitel 4 widmet sich der Situation der Stieffamilie heute. Es werden die Definition, Erscheinungsformen und die Häufigkeit von Stieffamilien sowie die Entwicklung des Scheidungsrisikos näher betrachtet.
Kapitel 5 analysiert die strukturelle Komplexität von Stieffamilien im Vergleich zur Kernfamilie. Es werden die besonderen Herausforderungen und Chancen dieser Familienform beleuchtet.
Kapitel 6 befasst sich mit der Situation von Kindern in Stieffamilien und den besonderen Herausforderungen, denen sie auf den verschiedenen Beziehungsebenen gegenüberstehen.
Das Fazit zieht eine zusammenfassende Bilanz und beleuchtet die zentralen Ergebnisse der Arbeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Stieffamilie, Kernfamilie, Scheidung, Familienformen, Beziehungsebenen, Kinder, Herausforderungen, Chancen, Familienleben, Sozialisation.
- Arbeit zitieren
- Nina Kröllken (Autor:in), 2005, Leben in Stieffamilien: Die Situation der Kinder, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43745