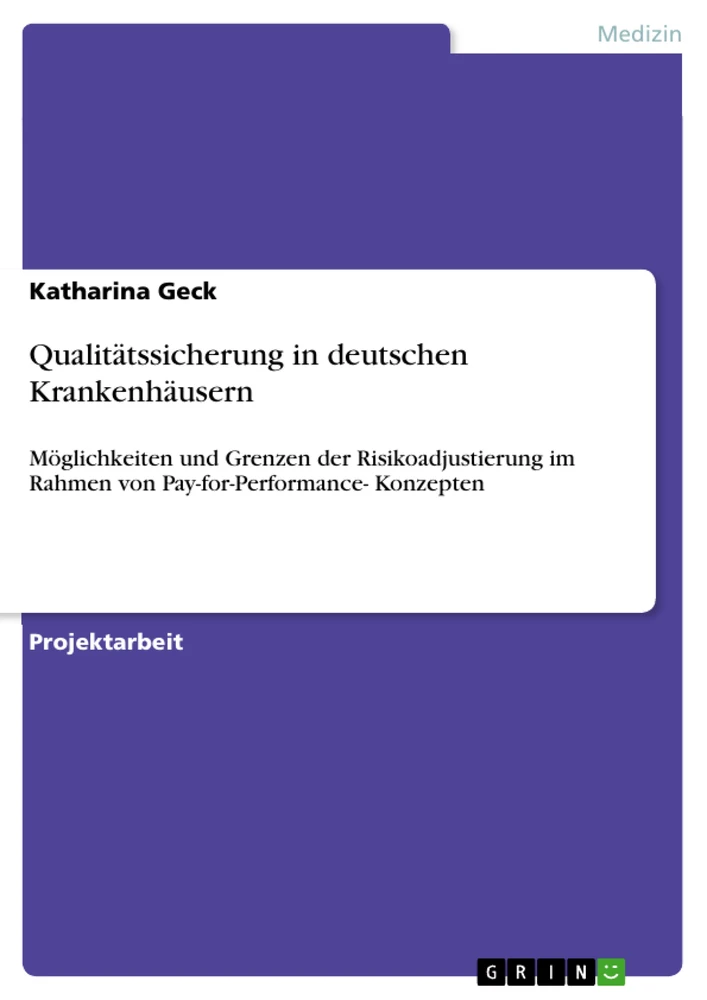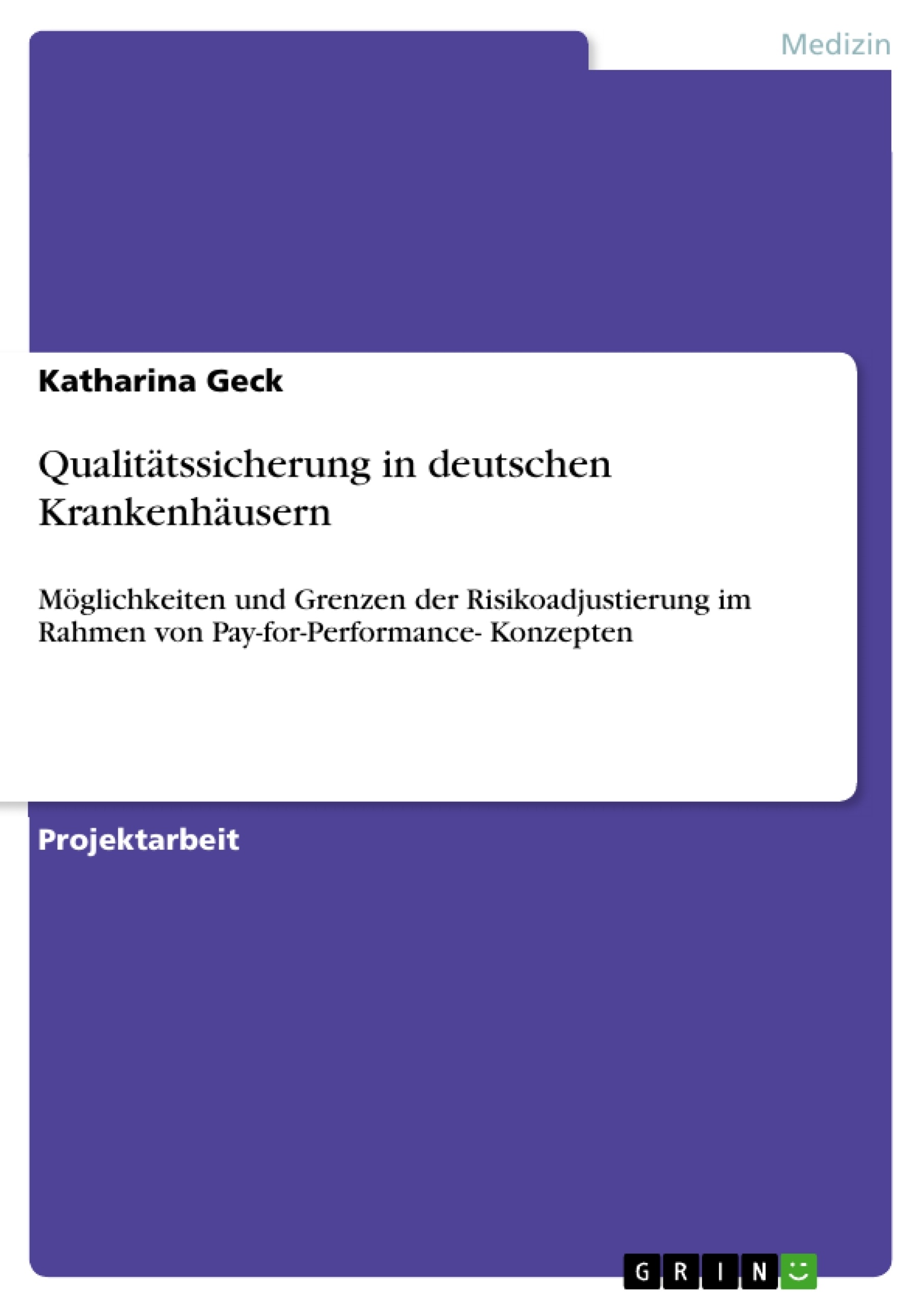Diese Projektarbeit thematisiert die Chancen und Risiken der Risikoadjustierung von Qualitätsindikatoren im Rahmen einer qualitätsorientierten Vergütung der stationären Versorgung im deutschen Gesundheitswesen. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht diesbezüglich die bisherige als auch zukünftige Ausgestaltung des Pay-for-Performance (P4P) Konzeptes.
Der Wettbewerb zwischen verschiedenen Unternehmen ist essentiell für eine innovative Marktwirtschaft: er wirkt als Antrieb für den Fortschritt der gesamten Volkswirtschaft. Um sich unter diesem Wettbewerb profilieren zu können, wenden sich immer mehr Unternehmen von einem verbindlichen Fixgehalt ab und tendieren hin zu einer Kombination aus fixen und variablen Bestandteilen. Auch das Gesundheitswesen sieht sich durch eine sich zunehmend verschlechternde wirtschaftliche Lage gezwungen, Wettbewerb zu betreiben. Die unterschiedlichen Einrichtungen sind im Rahmen ihrer Existenzsicherung aufgefordert, sich von den Konkurrenten abzuheben. Im deutschen Gesundheitswesen existieren allerdings Grenzen des Wettbewerbsgedankens, da das Gesundheitssystem der öffentlich rechtlichen Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge unterliegt. Gerade dies implizierte in den letzten Jahren das stringente Vernachlässigen des Qualitätsgedanken. Klinische Einrichtungen mussten derweilen keine markttypische Bereinigung fürchten. Dies hatte zur Folge, dass das deutsche Gesundheitssystem im Laufe der letzten Jahre einige Abschläge im Bereich der Vertrauensbasis seiner Nutzer einstecken musste.
Angeleitet durch den Wunsch einer qualitätsbewussten Versorgung wurde daher jüngst das Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) mit einer Vielzahl an Gesetzesänderungen im Rahmen der Qualitätsoffensive verabschiedet. Schwerpunkte des KHSG sind die wirtschaftliche Stärkung der Krankenhäuser sowie die Berücksichtigung von Aspekten der stationären Qualitätssteigerung. Im Rahmen der stationären Qualitätssteigerung wurde u.a. das Pay-for-Performance Modell für den stationären Sektor in die Sozialgesetzgebung eingeführt. Dieses Modell soll auf Basis von qualitätsorientierten Merkmalen die Leistungserbringer vergüten und somit durch monetäre Motivationsanreize eine Qualitätsverbesserung implizieren.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Bestandsaufnahme der Situation in der Krankenhauslandschaft Deutschlands
- Begriffsbestimmung des Krankenhauses
- Einblick in die bisherige Krankenhausfinanzierung/-vergütung
- Duale Finanzierung
- DRG-Fallpauschalensystem
- Pay-for-Performance Ansatz
- Begriffsdefinition
- Beginn und Entfaltung des Pay-for-Performance Gedankens
- Ziele und Aufbau des P4P Ansatzes
- Ziele
- Erfolgsorientierte Vergütung
- Public Reporting
- Umsetzung des P4P - Ansatzes in Deutschland
- Bedeutung der Qualitätssicherung im Gesundheitswesen
- Externe stationäre Qualitätssicherung
- Qualitätsindikatoren
- Vorraussetzungen und Rahmenbedingungen von Qualitätsindikatoren
- Qualitätsmodell nach Avedis Donabedian
- Risikoadjustierung als Grundlage für die Qualitätsmessung
- Grundlagen
- Möglichkeiten und Grenzen der Risikoadjustierung
- Kritische Würdigung der Risikoadjustierung in Bezug auf P4P
- Zusammenfassung und Fazit
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Qualitätssicherung im deutschen Krankenhauswesen und analysiert die Möglichkeiten und Grenzen der Risikoadjustierung im Rahmen von Pay-for-Performance-Konzepten. Die Arbeit zielt darauf ab, ein besseres Verständnis der Herausforderungen und Chancen der Qualitätssicherung im Gesundheitswesen zu schaffen und die Rolle der Risikoadjustierung im Kontext von P4P-Modellen zu bewerten.
- Bedeutung der Qualitätssicherung im Gesundheitswesen
- Pay-for-Performance-Konzepte im Krankenhauswesen
- Risikoadjustierung als Instrument zur Qualitätsmessung
- Möglichkeiten und Grenzen der Risikoadjustierung im Rahmen von P4P
- Kritische Würdigung der Risikoadjustierung im Hinblick auf P4P
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit darlegt. Anschließend wird die Situation in der deutschen Krankenhauslandschaft beleuchtet, wobei die Begriffsbestimmung des Krankenhauses sowie die bisherige Krankenhausfinanzierung und -vergütung im Vordergrund stehen. Das dritte Kapitel widmet sich dem Pay-for-Performance-Ansatz, seiner Definition, seinem historischen Hintergrund und seinen Zielen. Es werden die verschiedenen Elemente des P4P-Ansatzes, wie die erfolgsorientierte Vergütung und das Public Reporting, erläutert. Das vierte Kapitel fokussiert auf die Bedeutung der Qualitätssicherung im Gesundheitswesen. Die extern stationäre Qualitätssicherung und die Rolle von Qualitätsindikatoren werden dabei im Detail betrachtet. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der Risikoadjustierung als Grundlage für die Qualitätsmessung. Es werden die Grundlagen der Risikoadjustierung, ihre Möglichkeiten und Grenzen sowie ihre kritische Würdigung im Kontext von P4P-Modellen behandelt. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Fazit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die wichtigsten Themen und Konzepte im Bereich der Qualitätssicherung im deutschen Krankenhauswesen, insbesondere im Zusammenhang mit Pay-for-Performance-Modellen und der Rolle der Risikoadjustierung. Schlüsselbegriffe sind Qualitätssicherung, Pay-for-Performance, Risikoadjustierung, Krankenhausfinanzierung, DRG-System, Qualitätsindikatoren und externe Qualitätssicherung.
- Quote paper
- Katharina Geck (Author), 2017, Qualitätssicherung in deutschen Krankenhäusern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437355