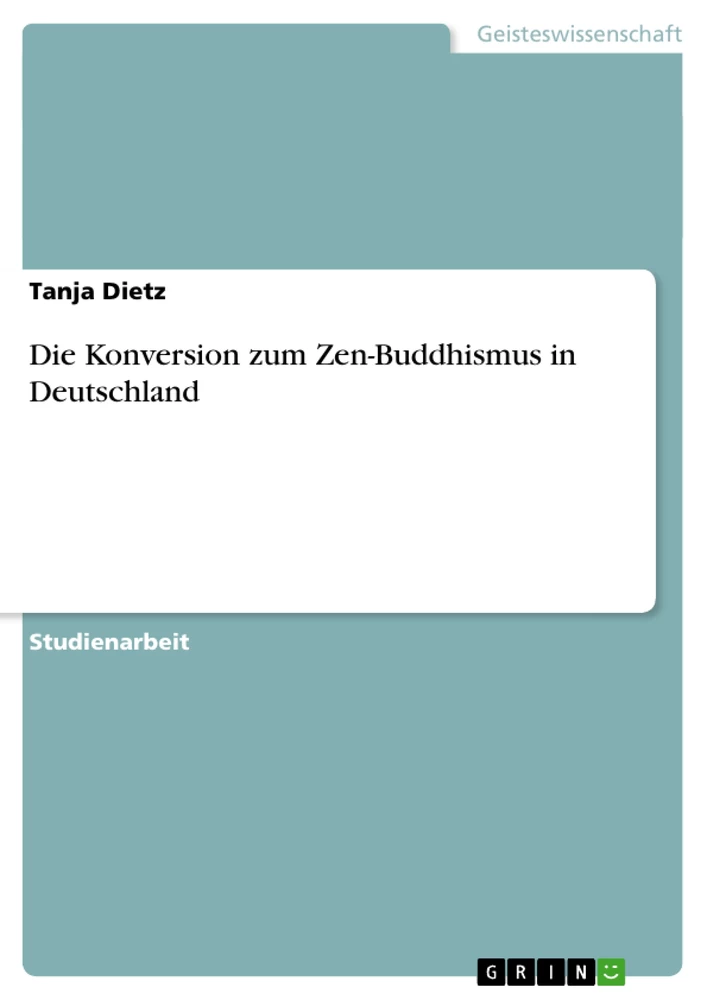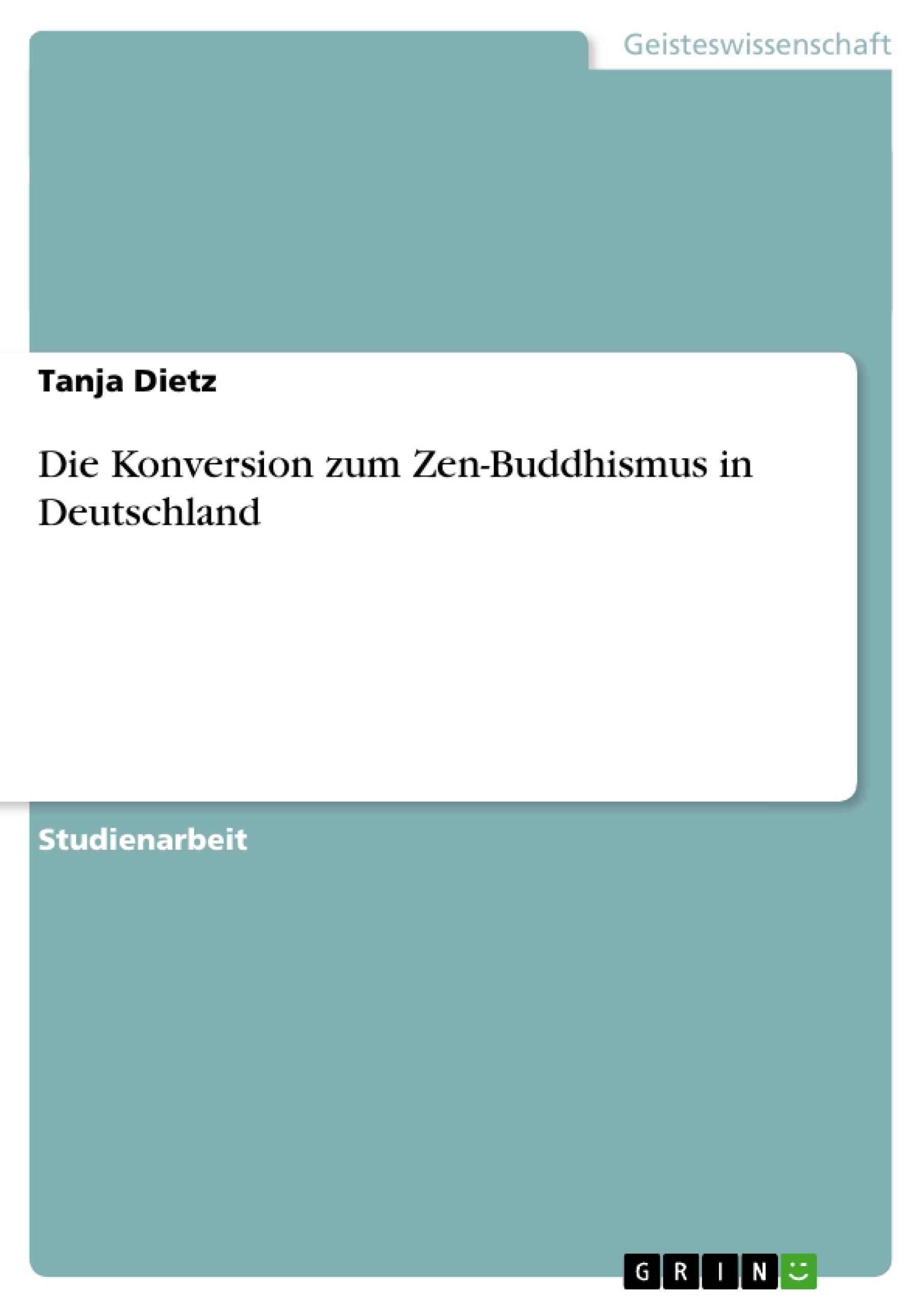Die Hausarbeit „Die Konversion zum Zen-Buddhismus in Deutschland“ entstand im Rahmen des Seminars „Spiritualität und neue religiöse Bewegungen in den westlichen Kulturen. Motive und Hintergründe aus religionswissenschaftlicher, sozialpsychologischer und psychoana-lytischer Sicht“ unter Leitung von PD Dr. Angela Moré und Dr. Edith Franke. Das Seminar war eine Kooperation des Psychologischen Instituts und des Seminars für Religionswissenschaft der Universität Hannover im Sommersemester 2002.
Im vergangenen Frühjahr nahm mich ein zum japanischen Nichren Shosho-Buddhismus konvertierter Lehrer und Freund zu einer buddhistischen Veranstaltung mit. Als dort die durchschnittlich deutsch erscheinenden Buddhisten beim Chanten (Beten) in Verzückung gerieten und anschließend von der Initialzündung zur Konversion berichteten, drängte sich mir – die ich auf dem Papier evangelisch, aber ansonsten religionsunempfindlich bin – unwillkürlich die Frage auf: Warum machen die das, und welchen „Kick“ empfinden sie dabei? Dieser Frage soll die vorliegende Arbeit nachgehen. Welche Gemeinsamkeiten in Einstellungen, Bildung und Biographie finden sich bei Zen-Buddhisten? Meine Arbeit fußt hauptsächlich auf der Untersuchung Katja Werthmanns in ihrem Buch Zen und Sinn, in der sie deutsche Zen-Buddhisten zu ihren Beweggründen befragte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Säkularisierungs- und Individualisierungsprozesse
- Individualisierung
- Säkularisierung
- Synkretistische Collage und Konversion
- Buddhismus - Westliche Rezeption
- Faszination am Zen-Buddhismus
- Persönlichkeit, Biographie und Gruppendynamik
- Biographische Prädispositionen
- Gruppenbildung
- Die Rolle der Rituale
- Konversion zum Zen-Buddhismus
- Zuwendung zum Zen-Buddhismus durch eine Krise
- Religiöse Prädispositionen
- Die Zen-Gruppe
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konversion zum Zen-Buddhismus in Deutschland. Sie beleuchtet die Beweggründe und Gemeinsamkeiten von Zen-Buddhisten hinsichtlich ihrer Einstellungen, Bildung und Biographie. Die Studie basiert hauptsächlich auf der Arbeit von Katja Werthmann, "Zen und Sinn".
- Der Einfluss von Säkularisierung und Individualisierung auf die Konversion zu neuen religiösen Bewegungen.
- Die westliche Rezeption des Buddhismus und die besondere Faszination am Zen-Buddhismus.
- Die Rolle von persönlichen und biographischen Faktoren sowie Gruppendynamik bei der Konversion.
- Die Analyse von Krisen als Auslöser für die Zuwendung zum Zen-Buddhismus.
- Die Bedeutung religiöser Prädispositionen und der Zen-Gruppe im Konversionsprozess.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die Frage nach den Motiven für die Konversion zum Zen-Buddhismus in Deutschland, ausgehend von persönlichen Beobachtungen bei einer buddhistischen Veranstaltung. Der Fokus liegt auf Gemeinsamkeiten in Einstellungen, Bildung und Biographie von Zen-Buddhisten, basierend auf der Studie von Katja Werthmann. Die Arbeit betrachtet den Kontext von Säkularisierung und Individualisierung und beleuchtet die westliche Rezeption des Buddhismus sowie die Rolle von Persönlichkeit, Biographie und Gruppendynamik.
Säkularisierungs- und Individualisierungsprozesse: Dieses Kapitel analysiert die Prozesse der Individualisierung und Säkularisierung in der modernen Gesellschaft und deren Einfluss auf religiöse Konversionen. Es werden verschiedene Theorien diskutiert, darunter die von Werthmann, Daiber und Berger. Individualisierung wird als Prozess der Entlassung aus traditionellen Sinnzusammenhängen beschrieben, der zu Wahlfreiheit, aber auch zu Irritation und Entfremdung führt. Die Säkularisierung wird im Kontext des Begriffs der „Entzauberung der Welt“ (Weber) diskutiert, wobei die These der Abnahme religiöser Bedeutung in Frage gestellt und die anhaltende Bedeutung von Religion weltweit betont wird. Der Unterschied in der Ausprägung der Säkularisierung zwischen Europa und den USA wird ebenfalls beleuchtet, wobei das staatliche Schulsystem in Europa als wichtige Säkularisierungskraft hervorgehoben wird.
Buddhismus - Westliche Rezeption: (Kapitel-Zusammenfassung fehlt im Originaltext. Eine Zusammenfassung müsste hier hinzugefügt werden, wenn der Text das entsprechende Kapitel enthält.)
Faszination am Zen-Buddhismus: (Kapitel-Zusammenfassung fehlt im Originaltext. Eine Zusammenfassung müsste hier hinzugefügt werden, wenn der Text das entsprechende Kapitel enthält.)
Persönlichkeit, Biographie und Gruppendynamik: Dieses Kapitel (angenommen es existiert im Originaltext) würde sich vermutlich mit den individuellen und biographischen Voraussetzungen und der Bedeutung der Gruppendynamik innerhalb der Zen-Gemeinschaft auseinandersetzen. Es würde wahrscheinlich Faktoren wie Lebenskrisen, Suche nach Sinn und Zugehörigkeit sowie die Rolle von Ritualen in der Gruppe untersuchen.
Konversion zum Zen-Buddhismus: Dieses Kapitel, basierend auf der Analyse von Werthmanns Interviews, untersucht detailliert die individuellen Konversionserfahrungen. Es würde verschiedene Faktoren wie Krisen, religiöse Prädispositionen und den Einfluss der Zen-Gruppe auf die Konversionsentscheidung beleuchten und die in Kapitel 5 vorgestellten Annahmen untermauern.
Schlüsselwörter
Zen-Buddhismus, Konversion, Säkularisierung, Individualisierung, Religionswissenschaft, Sozialpsychologie, Biographie, Gruppendynamik, Krisen, Sinnfindung, religiöse Prädispositionen, Westliche Rezeption des Buddhismus.
Häufig gestellte Fragen zu "Zen und Sinn" (Arbeitstitel)
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Konversion zum Zen-Buddhismus in Deutschland. Sie analysiert die Beweggründe und Gemeinsamkeiten von Zen-Buddhisten in Bezug auf ihre Einstellungen, Bildung und Biographie. Die Studie basiert auf der Arbeit von Katja Werthmann, "Zen und Sinn".
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Einfluss von Säkularisierung und Individualisierung auf die Konversion zu neuen religiösen Bewegungen, die westliche Rezeption des Buddhismus und die Faszination am Zen-Buddhismus im Besonderen. Weitere Schwerpunkte sind die Rolle von persönlichen und biographischen Faktoren sowie Gruppendynamik bei der Konversion, die Analyse von Krisen als Auslöser für die Zuwendung zum Zen-Buddhismus und die Bedeutung religiöser Prädispositionen und der Zen-Gruppe im Konversionsprozess.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zu Einleitung, Säkularisierungs- und Individualisierungsprozessen, der westlichen Rezeption des Buddhismus, der Faszination am Zen-Buddhismus, Persönlichkeit, Biographie und Gruppendynamik, der Konversion zum Zen-Buddhismus und einem Fazit. Die Kapitel zu "Buddhismus - Westliche Rezeption" und "Faszination am Zen-Buddhismus" enthalten im vorliegenden Auszug keine detaillierten Zusammenfassungen.
Wie wird die Säkularisierung und Individualisierung behandelt?
Das Kapitel zu Säkularisierungs- und Individualisierungsprozessen analysiert diese Prozesse in der modernen Gesellschaft und ihren Einfluss auf religiöse Konversionen. Es diskutiert verschiedene Theorien (Werthmann, Daiber, Berger) und beleuchtet die Individualisierung als Prozess der Entlassung aus traditionellen Sinnzusammenhängen sowie die Säkularisierung im Kontext von Webers „Entzauberung der Welt“. Der Unterschied in der Ausprägung der Säkularisierung zwischen Europa und den USA wird ebenfalls thematisiert.
Welche Rolle spielen persönliche Faktoren und Gruppendynamik?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung persönlicher und biographischer Faktoren sowie der Gruppendynamik innerhalb der Zen-Gemeinschaft. Es werden Faktoren wie Lebenskrisen, die Suche nach Sinn und Zugehörigkeit und die Rolle von Ritualen in der Gruppe betrachtet.
Wie werden Konversionserfahrungen analysiert?
Das Kapitel zur Konversion zum Zen-Buddhismus analysiert detailliert individuelle Konversionserfahrungen basierend auf Werthmanns Interviews. Es beleuchtet Faktoren wie Krisen, religiöse Prädispositionen und den Einfluss der Zen-Gruppe auf die Konversionsentscheidung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Zen-Buddhismus, Konversion, Säkularisierung, Individualisierung, Religionswissenschaft, Sozialpsychologie, Biographie, Gruppendynamik, Krisen, Sinnfindung, religiöse Prädispositionen, westliche Rezeption des Buddhismus.
Auf welcher Studie basiert die Arbeit?
Die Arbeit basiert hauptsächlich auf der Studie von Katja Werthmann, "Zen und Sinn".
Welche Methode wird angewendet?
Die genaue Methode wird im vorliegenden Auszug nicht explizit genannt, jedoch lässt sich aus dem Kontext schließen, dass qualitative Methoden, insbesondere die Auswertung von Interviews (basierend auf Werthmanns Arbeit), zum Einsatz kommen.
- Quote paper
- Tanja Dietz (Author), 2003, Die Konversion zum Zen-Buddhismus in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43680