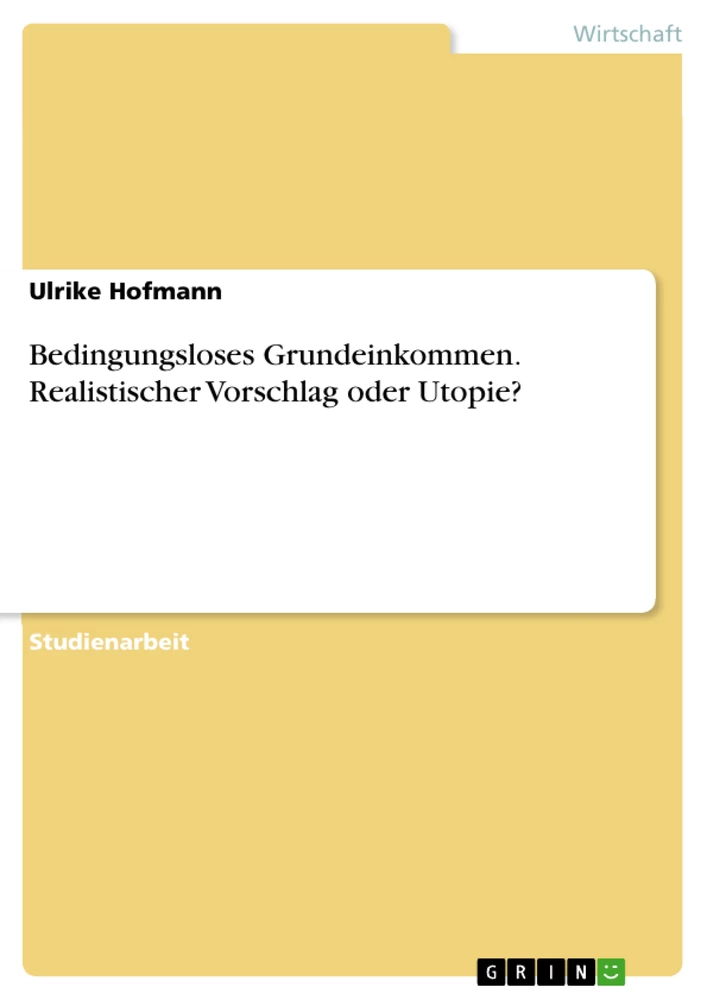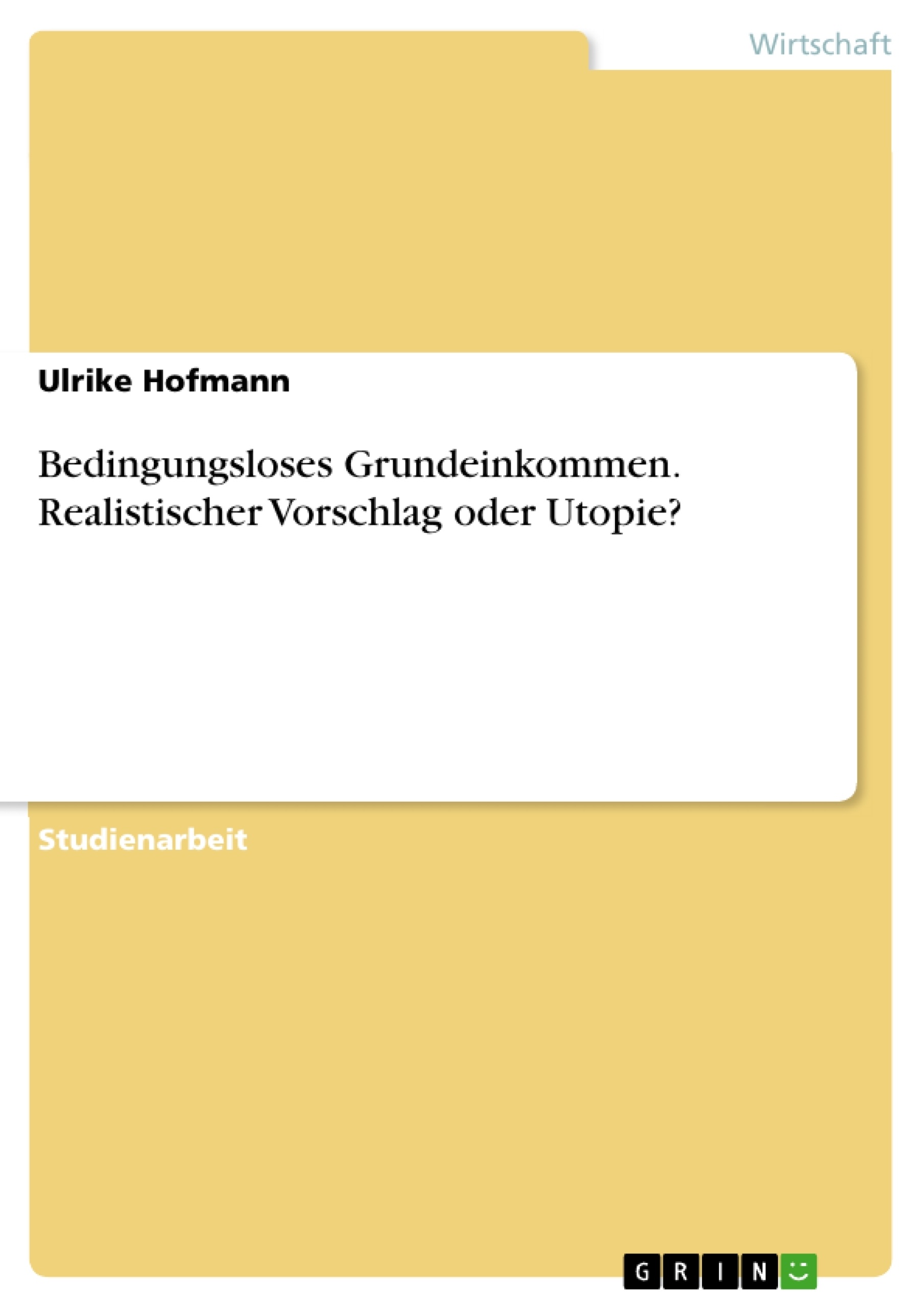In der Diskussion über ein Bedingungsloses Grundeinkommen hat sich eine Vielzahl an Definitionen und Modellen herauskristallisiert. Unter einem Bedingungslosen Grundeinkommen wird eine gesetzlich festgelegte und für jeden gleich hohe finanzielle Zuwendung verstanden, die jeder Staatsangehörige bzw. vom Staat ausdrücklich Berechtigte unabhängig von der individuellen wirtschaftlichen Lage erhält, und für die keine Gegenleistung erbracht werden muss.
Das Ziel dieser Ausarbeitung ist es, zu bestimmen, ob die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens in Deutschland zur Lösung sozialer und ökonomischer Probleme beitragen kann, und dieses als realistischer Vorschlag zu werten oder als rein utopisches Konzept einzuschätzen ist. Dazu wurden positive wie negative Folgen eines garantierten Grundeinkommens diskutiert. Es wurden diverse Vorteile, wie z.B. die Befreiung vom Arbeitszwang und der Gewinn an individueller Freiheit als auch die Bekämpfung von Armut sowie die Möglichkeit der gesellschaftlichen Teilhabe aller Bürger, aufgezeigt. Darüber hinaus birgt ein Bedingungsloses Grundeinkommen auch Gefahren, wie die Ausweitung des Niedriglohnsektors, mangelnde soziale Absicherung des Einzelnen durch die Abschaffung der Sozialversicherungen und Ungerechtigkeit durch fehlende Vermögensumverteilung.
Im Ergebnis scheint die Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens durchaus realistisch. Ungewiss ist jedoch, ob das damit verbundene Ziel einer Reduzierung von Armut tatsächlich erreicht werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedingungsloses Grundeinkommen
- Die Idee des Bedingungslosen Grundeinkommens
- Neue Modelle eines bedingungslosen Grundeinkommens
- Das Grundeinkommensmodell von Götz Werner
- Das Solidarische Bürgergeld von Dieter Althaus
- Existenzgeld
- Bedingungsloses Grundeinkommen: pro und contra
- Ökonomische Argumente
- Sozialpolitische Argumente
- Gesellschaftspolitische Argumente
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Realisierbarkeit und die potenziellen Auswirkungen eines Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) in Deutschland. Ziel ist es, das BGE als realistischen Vorschlag oder utopisches Konzept einzuschätzen, indem sowohl positive als auch negative Folgen diskutiert werden. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Modelle des BGE und bewertet deren ökonomische, sozialpolitische und gesellschaftspolitische Implikationen.
- Definition und verschiedene Modelle des Bedingungslosen Grundeinkommens
- Ökonomische Auswirkungen eines BGE
- Sozialpolitische Folgen der Einführung eines BGE
- Gesellschaftspolitische Implikationen eines BGE
- Bewertung der Realisierbarkeit eines BGE in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung positioniert die Arbeit im Kontext aktueller Diskussionen um das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE), unter Bezugnahme auf die Abstimmung in der Schweiz und Pilotprojekte in Finnland. Sie unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der vielschichtigen Konzepte und ihrer potenziellen Chancen und Risiken. Die Arbeit umreißt ihren Aufbau und fokussiert sich auf die Definition des BGE, die Vorstellung verschiedener Modelle und die Bewertung der positiven und negativen Auswirkungen einer Umsetzung in Deutschland.
Bedingungsloses Grundeinkommen: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Bedingungslosen Grundeinkommens und beschreibt seine Kernelemente. Es wird auf die unterschiedlichen Modelle und Ansätze eingegangen, darunter das Grundeinkommensmodell von Götz Werner, das Solidarische Bürgergeld von Dieter Althaus und das Existenzgeld-Konzept der BAG SHI. Es legt den Grundstein für die spätere Analyse der wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen eines solchen Systems. Die Darstellung verschiedener Modelle unterstreicht die Komplexität des Themas und die Bandbreite der diskutierten Ansätze.
Bedingungsloses Grundeinkommen: pro und contra: Dieser Abschnitt bildet den Kern der Arbeit und analysiert detailliert die potenziellen positiven und negativen Auswirkungen der Einführung eines BGE in Deutschland. Die ökonomischen Argumente befassen sich mit den Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, die Staatsfinanzen und das Wirtschaftswachstum. Die sozialpolitischen Argumente untersuchen die Auswirkungen auf Armut, soziale Ungleichheit und die soziale Sicherung. Die gesellschaftspolitischen Argumente bewerten den Einfluss auf die individuelle Freiheit, gesellschaftliche Teilhabe und die soziale Kohäsion. Dieser Kapitel bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit den verschiedenen Perspektiven und Argumentationslinien rund um die Thematik des BGE.
Schlüsselwörter
Bedingungsloses Grundeinkommen, Grundeinkommen, BGE, Sozialpolitik, Ökonomie, Armut, Arbeitsmarkt, Soziale Gerechtigkeit, Götz Werner, Dieter Althaus, BAG SHI, Gesellschaftsmodell, Realismus, Utopie.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Bedingungsloses Grundeinkommen
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Realisierbarkeit und die potenziellen Auswirkungen eines Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) in Deutschland. Sie analysiert verschiedene BGE-Modelle (z.B. von Götz Werner, Dieter Althaus, Existenzgeld), bewertet deren ökonomische, sozialpolitische und gesellschaftspolitische Implikationen und diskutiert positive sowie negative Folgen. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zum BGE, Pro- und Contra-Argumenten und ein Fazit.
Welche BGE-Modelle werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene Modelle des Bedingungslosen Grundeinkommens vor, darunter das Grundeinkommensmodell von Götz Werner, das Solidarische Bürgergeld von Dieter Althaus und das Existenzgeld-Konzept. Die detaillierte Beschreibung dieser Modelle dient als Grundlage für die spätere Analyse der Auswirkungen.
Welche Aspekte der Auswirkungen eines BGE werden untersucht?
Die Seminararbeit analysiert die ökonomischen Auswirkungen (Arbeitsmarkt, Staatsfinanzen, Wirtschaftswachstum), die sozialpolitischen Folgen (Armut, soziale Ungleichheit, soziale Sicherung) und die gesellschaftspolitischen Implikationen (individuelle Freiheit, gesellschaftliche Teilhabe, soziale Kohäsion) eines BGE in Deutschland.
Wie wird die Realisierbarkeit eines BGE bewertet?
Die Arbeit bewertet die Realisierbarkeit eines BGE in Deutschland, indem sie die verschiedenen Modelle und deren potenzielle Auswirkungen auf die genannten Bereiche untersucht und das BGE als realistischen Vorschlag oder utopisches Konzept einzuschätzen versucht.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Bedingungsloses Grundeinkommen, Grundeinkommen, BGE, Sozialpolitik, Ökonomie, Armut, Arbeitsmarkt, Soziale Gerechtigkeit, Götz Werner, Dieter Althaus, BAG SHI, Gesellschaftsmodell, Realismus, Utopie.
Welche Kapitel enthält die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition und verschiedenen Modellen des BGE, ein Kapitel zu den Pro- und Contra-Argumenten und ein Fazit. Die Einleitung setzt die Arbeit in den Kontext aktueller Diskussionen (z.B. Schweiz, Finnland) und beschreibt den Aufbau. Das Kapitel zu den Pro- und Contra-Argumenten analysiert detailliert die ökonomischen, sozialpolitischen und gesellschaftspolitischen Auswirkungen.
- Quote paper
- Ulrike Hofmann (Author), 2017, Bedingungsloses Grundeinkommen. Realistischer Vorschlag oder Utopie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/436760