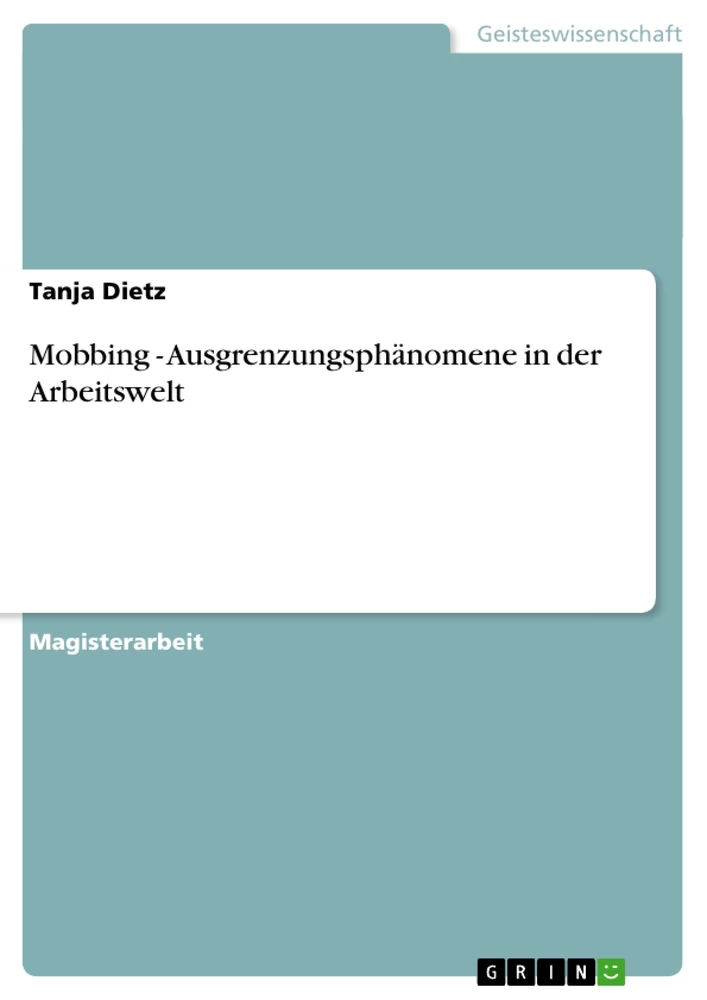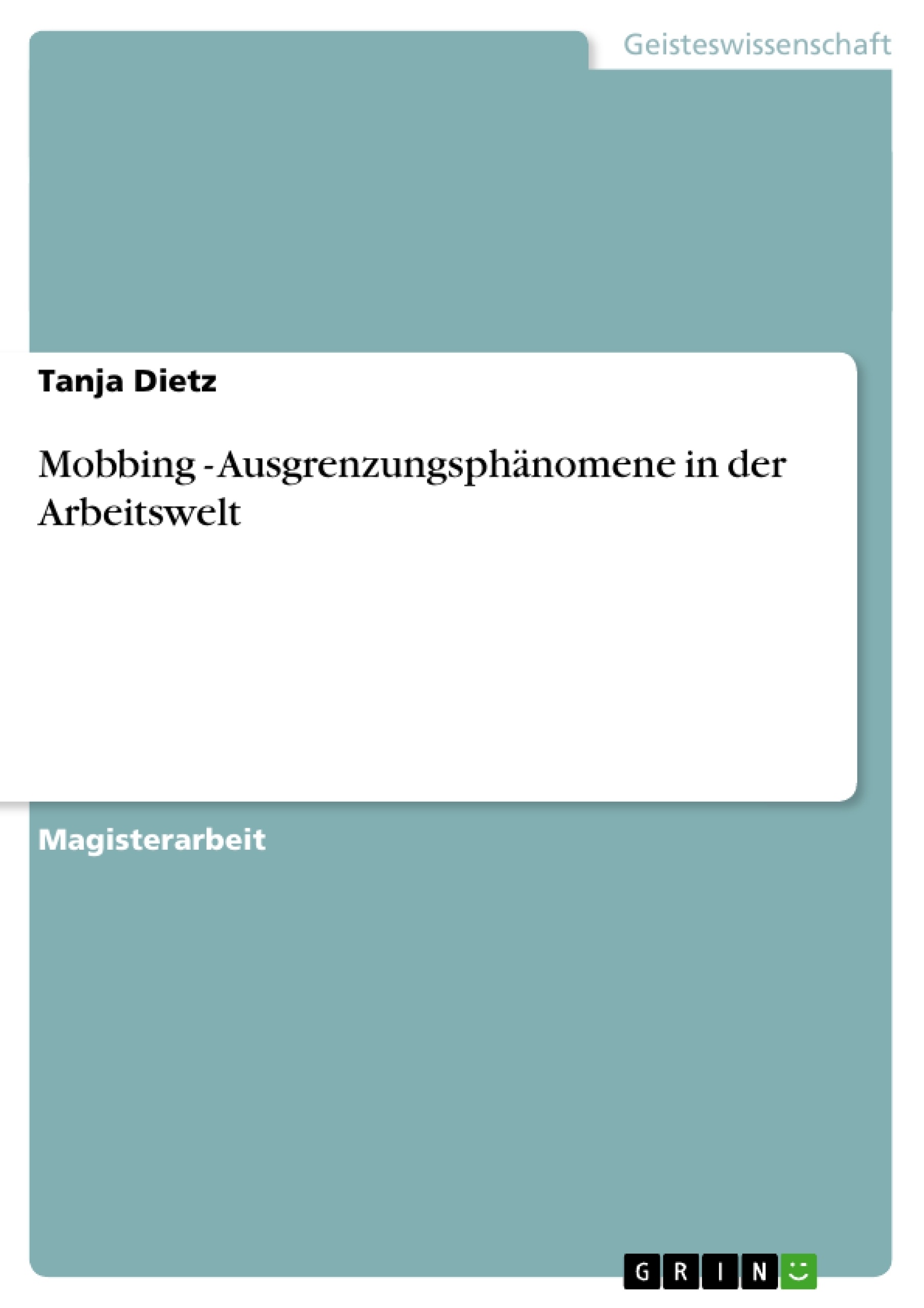„Als ich dann überlegt hatte, dass ich... lieber für mich Schluss machen wollte und ich also die Waffe in der Hand hatte, da hab‘ ich dann aber überlegt, dass ich... vielleicht mit der Waffe... zu meinem damaligen Chef gehen könnte, ne, und halt es selber richten könnte.“
Diese Aussage stammt von der Kindergartenleiterin Annegret Römer, die nach zwanzigjähriger einvernehmlicher Zusammenarbeit plötzlich von ihrem Chef, dem Bürgermeister des Ortes, schikaniert wurde. Das Gerücht, die Tochter des Bürgermeisters wolle Römers Posten übernehmen, sprach sich zu dieser Zeit bereits im Ort herum. Nachdem der Bürgermeister die Qualifikation Annegret Römers in Frage gestellt, Misstrauen in ihrer Arbeitsgruppe gestreut, Kompetenzen abgesprochen und ihr auferlegt hatte, ihren Tagesablauf minutiös aufzulisten, stand sie am Rand einer Verzweiflungstat. Diese konnte nur verhindert werden, da sie sich zuvor telefonisch ihrer Schwester anvertraute. Die fand Annegret Römer mit einer Pistole in der Hand vor. Nach monatelanger Krankschreibung und einer Rehabilitation in einer auf Mobbingopfer spezialisierten Klinik wagt die Kindergartenleiterin - mittlerweile unter einem neuen Bürgermeister - wieder die ersten Schritte zurück in den Berufsalltag.
„Mobbing“, „Bossing“ (Schikane durch den Vorgesetzten) oder „Psychoterror am Arbeitsplatz“ sind Begriffe, die in den vergangenen Jahren in Zusammenhang mit spektakulären Vorfällen durch die Medien gingen. Der wohl bekannteste Fall ist die Selbstmordserie von vier Polizisten einer Neusser Polizeiwache, die durch Kollegenmobbing in den Tod getrieben worden sein sollen. Viele Kommilitonen, Freunde und Bekannte, mit denen ich im Vorfeld der Arbeit gesprochen habe, hatten Kenntnis vom Mobbingphänomen. Ihre Aussagen reichten von „Die sogenannten Mobbingopfer sind doch selber schuld, die würden auch mobben, wenn sie könnten!“ bis hin zu „Ich bin mir sicher, dass ich auch schon gemobbt wurde“. Aus der epidemiologischen Untersuchung von Meschkutat u.a. im Jahr 2001 geht hervor, dass in Deutschland bereits jeder neunte Arbeitnehmer schon
einmal Opfer von Mobbing geworden ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Epistemologischer Ursprung des Begriffs Mobbing
- 1.2 Abgrenzung von verwandten Begriffen
- 1.3 Verbreitung von Mobbing
- 1.4 Durchschnittliche Dauer von Mobbing
- 1.5 Volkswirtschaftlicher Schaden
- 1.6 Thema und Fragestellung
- 1.7 Aufbau der Arbeit
- 2 Stand der Mobbingforschung
- 2.1 Die bisherige Mobbingforschung im Überblick
- 2.2 Mobbing am Arbeitsplatz
- 2.3 Mobbingforschung im deutschen Sprachraum
- 2.4 Definition von Mobbing
- 2.5 Subjektives und objektives Mobbing
- 2.6 Mobbingphasen
- 3 Opfer und Täter
- 3.1 Das hierarchische Verhältnis zwischen Opfer und Täter
- 3.2 Das Machtungleichgewicht zwischen Opfer und Täter
- 3.3 Geschlechtsspezifisches Mobbing
- 3.4 Mobbingrisiko differenziert nach Berufsgruppe und Status
- 3.5 Die Opfer
- 3.5.1 Alter und berufliche Position der Opfer
- 3.5.2 Opfer und Opfergruppen im Mobbingprozess
- 3.5.3 Mobbingauslösende Faktoren aus der Opferperspektive
- 3.5.4 Opfermerkmale
- 3.5.4.1 Die exponierte Stellung des Opfers
- 3.5.4.2 Opferpersönlichkeit
- 3.6 Die Täter
- 3.6.1 Alter und berufliche Position der Täter
- 3.6.2 Einzeltäter und Tätergruppen im Mobbingprozess
- 3.6.3 Die Mobbingintention
- 3.7 Mobbinghandlungen und deren Kategorisierung
- 3.7.1 Gewichtung der Mobbinghandlungen
- 3.7.2 Geschlechtsspezifische Mobbinghandlungen
- 3.7.3 Mobbinghandlungen nach Alter der Opfer und Täter
- 3.7.4 Motivation der Täter zu Mobbinghandlungen
- 3.8 Tätermerkmale
- 4 Organisationale und soziale Ursachen von Mobbing
- 4.1 Organisationale Ursachen von Mobbing
- 4.2 Soziale Ursachen von Mobbing
- 4.2.1 Die Rolle der Aggression
- 4.2.2 Die sozialen Ursachen von Aggression
- 5 Psychodynamische Ursachen von Mobbing
- 5.1 Die Rolle der Institution
- 5.2 Die Gruppe und ihre Dynamik
- 5.3 Die Führung der Gruppe
- 5.4 Mobbingursachen in der Gruppendynamik
- 5.4.1 Die Gruppe und die Funktion des Sündenbock
- 5.4.2 Der eskalierende Konflikt
- 5.5 Psychodynamik in der Täterpersönlichkeit
- 5.5.1 Die intrapsychischen Abwehrmechanismen
- 5.5.2 Die interpersonale Abwehr
- 6 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht das Phänomen Mobbing am Arbeitsplatz. Ziel ist es, die Ursachen, Auswirkungen und verschiedenen Facetten von Mobbing zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet sowohl die Opfer- als auch die Täterperspektive und analysiert die organisationalen, sozialen und psychodynamischen Faktoren, die zu Mobbing beitragen.
- Definition und Abgrenzung von Mobbing
- Ursachen von Mobbing (organisational, sozial, psychodynamisch)
- Charakteristika von Opfern und Tätern
- Auswirkungen von Mobbing auf Betroffene und Unternehmen
- Möglichkeiten der Prävention und Intervention
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Mobbing ein und definiert den Begriff, grenzt ihn von ähnlichen Phänomenen ab und beleuchtet die Verbreitung und die volkswirtschaftlichen Schäden. Es stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit dar, indem es den Leser auf die folgenden Kapitel vorbereitet. Die Einbettung des Themas in aktuelle Ereignisse mittels eindrucksvoller Beispiele wie dem Fall der Kindergartenleiterin Annegret Römer verdeutlicht die Relevanz und Dringlichkeit des Themas.
2 Stand der Mobbingforschung: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Mobbing, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Es werden verschiedene Definitionen von Mobbing diskutiert, der Unterschied zwischen subjektivem und objektivem Mobbing beleuchtet und die typischen Phasen eines Mobbingprozesses beschrieben. Der Überblick dient als Basis für die weiteren Kapitel, die auf diesen Grundlagen aufbauen.
3 Opfer und Täter: Dieses Kapitel analysiert die Rollen von Opfern und Tätern im Mobbingprozess. Es untersucht das hierarchische Verhältnis und das Machtungleichgewicht zwischen ihnen, beleuchtet geschlechtsspezifische Unterschiede und betrachtet das Mobbingrisiko in Abhängigkeit von Berufsgruppe und Status. Die detaillierte Beschreibung von Opfer- und Tätermerkmalen, einschließlich ihrer Motivationen und Handlungen, ermöglicht ein tieferes Verständnis der Dynamik von Mobbingprozessen.
4 Organisationale und soziale Ursachen von Mobbing: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die organisatorischen und sozialen Faktoren, die Mobbing begünstigen. Es untersucht die Rolle von organisationalen Strukturen, Unternehmenskultur und sozialen Dynamiken, wie z.B. die Rolle von Aggression und deren sozialen Ursachen. Die Analyse dieser Faktoren liefert wichtige Ansatzpunkte für präventive Maßnahmen.
5 Psychodynamische Ursachen von Mobbing: In diesem Kapitel werden die psychodynamischen Aspekte von Mobbing untersucht. Es beleuchtet die Rolle von institutionellen Strukturen, Gruppendynamik und Führungsstilen bei der Entstehung von Mobbing. Die Analyse der psychodynamischen Prozesse in der Persönlichkeit von Tätern und Opfern trägt zum Verständnis der tieferliegenden Ursachen von Mobbing bei.
Schlüsselwörter
Mobbing, Arbeitsplatz, Ausgrenzung, Opfer, Täter, organisatorische Ursachen, soziale Ursachen, psychodynamische Ursachen, Aggression, Gruppendynamik, Prävention, Intervention, Forschungsstand, Definition.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Mobbing am Arbeitsplatz
Was ist der Inhalt dieser Magisterarbeit?
Diese Magisterarbeit untersucht umfassend das Phänomen Mobbing am Arbeitsplatz. Sie beleuchtet die Ursachen, Auswirkungen und verschiedenen Facetten von Mobbing aus Opfer- und Täterperspektive. Die Arbeit analysiert organisatorische, soziale und psychodynamische Faktoren, die zu Mobbing beitragen, und betrachtet Möglichkeiten der Prävention und Intervention.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Definition und Abgrenzung von Mobbing, Ursachen von Mobbing (organisatorisch, sozial, psychodynamisch), Charakteristika von Opfern und Tätern, Auswirkungen von Mobbing auf Betroffene und Unternehmen sowie Möglichkeiten der Prävention und Intervention. Die Arbeit beinhaltet eine detaillierte Analyse der Opfer- und Tätermerkmale, Mobbinghandlungen und deren Kategorisierung, sowie die Rolle von Aggression und Gruppendynamik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung (Definition, Abgrenzung, Verbreitung, Forschungsfrage), Stand der Mobbingforschung (Überblick, Definitionen, Phasen), Opfer und Täter (hierarchische Verhältnisse, Geschlechtsspezifische Unterschiede, Merkmale), Organisationale und soziale Ursachen von Mobbing, Psychodynamische Ursachen von Mobbing (Institution, Gruppe, Führung, psychodynamische Prozesse) und Zusammenfassung. Jedes Kapitel baut auf den vorherigen auf und liefert einen umfassenden Einblick in das Thema.
Welche Definition von Mobbing wird verwendet?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Definitionen von Mobbing aus dem aktuellen Forschungsstand, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Sie beleuchtet den Unterschied zwischen subjektivem und objektivem Mobbing und verwendet eine fundierte Definition als Basis für die weitere Analyse.
Welche Ursachen für Mobbing werden untersucht?
Die Arbeit untersucht organisatorische Ursachen (z.B. Unternehmenskultur, Strukturen), soziale Ursachen (z.B. Aggression, soziale Dynamiken) und psychodynamische Ursachen (z.B. Gruppendynamik, Führungsstile, intra- und interpersonale Abwehrmechanismen). Die Interaktion dieser Faktoren wird analysiert, um ein umfassendes Verständnis der Mobbingursachen zu ermöglichen.
Wer sind die Opfer und Täter von Mobbing?
Die Arbeit analysiert die Merkmale von Opfern und Tätern, inklusive Alter, berufliche Position, Geschlecht und Persönlichkeitsmerkmale. Sie untersucht das hierarchische Verhältnis und das Machtungleichgewicht zwischen Opfern und Tätern und beleuchtet geschlechtsspezifische Unterschiede in Mobbinghandlungen.
Welche Auswirkungen hat Mobbing?
Die Arbeit thematisiert die Auswirkungen von Mobbing auf die Betroffenen (psychisch und physisch) und auf das Unternehmen (z.B. volkswirtschaftliche Schäden, Produktivitätsverlust). Diese Auswirkungen werden im Kontext der jeweiligen Kapitel diskutiert.
Wie kann Mobbing verhindert werden?
Die Arbeit liefert Ansatzpunkte für Prävention und Intervention, die sich aus der Analyse der organisatorischen, sozialen und psychodynamischen Ursachen ergeben. Konkrete Maßnahmen werden zwar nicht explizit genannt, aber die gewonnenen Erkenntnisse bieten eine Grundlage für die Entwicklung präventiver Strategien.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mobbing, Arbeitsplatz, Ausgrenzung, Opfer, Täter, organisatorische Ursachen, soziale Ursachen, psychodynamische Ursachen, Aggression, Gruppendynamik, Prävention, Intervention, Forschungsstand, Definition.
- Quote paper
- Tanja Dietz (Author), 2003, Mobbing - Ausgrenzungsphänomene in der Arbeitswelt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43620