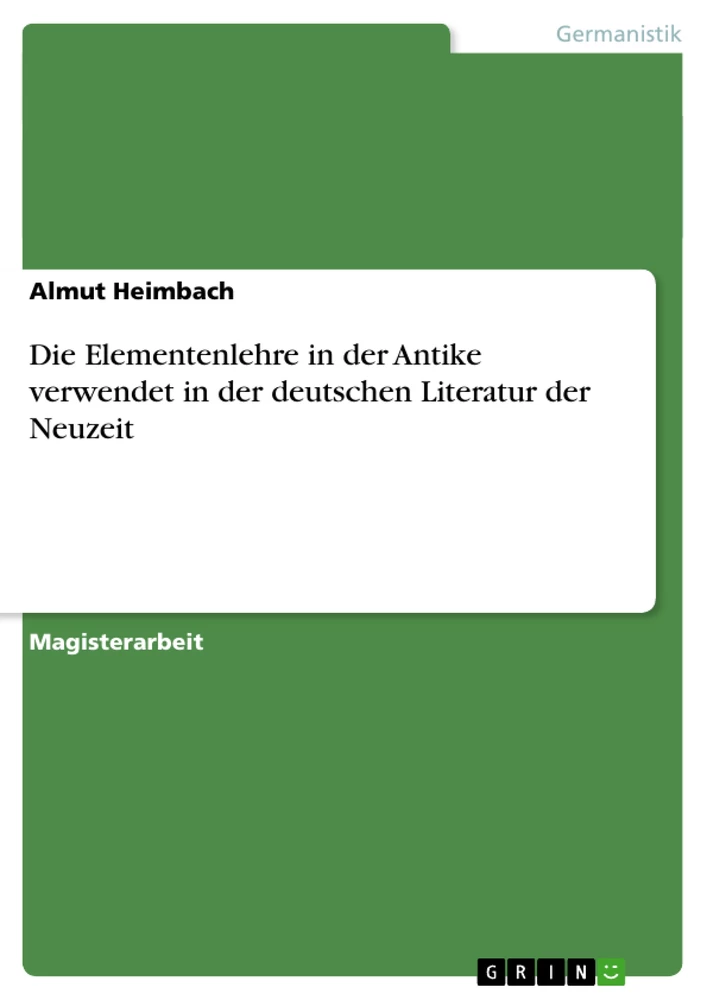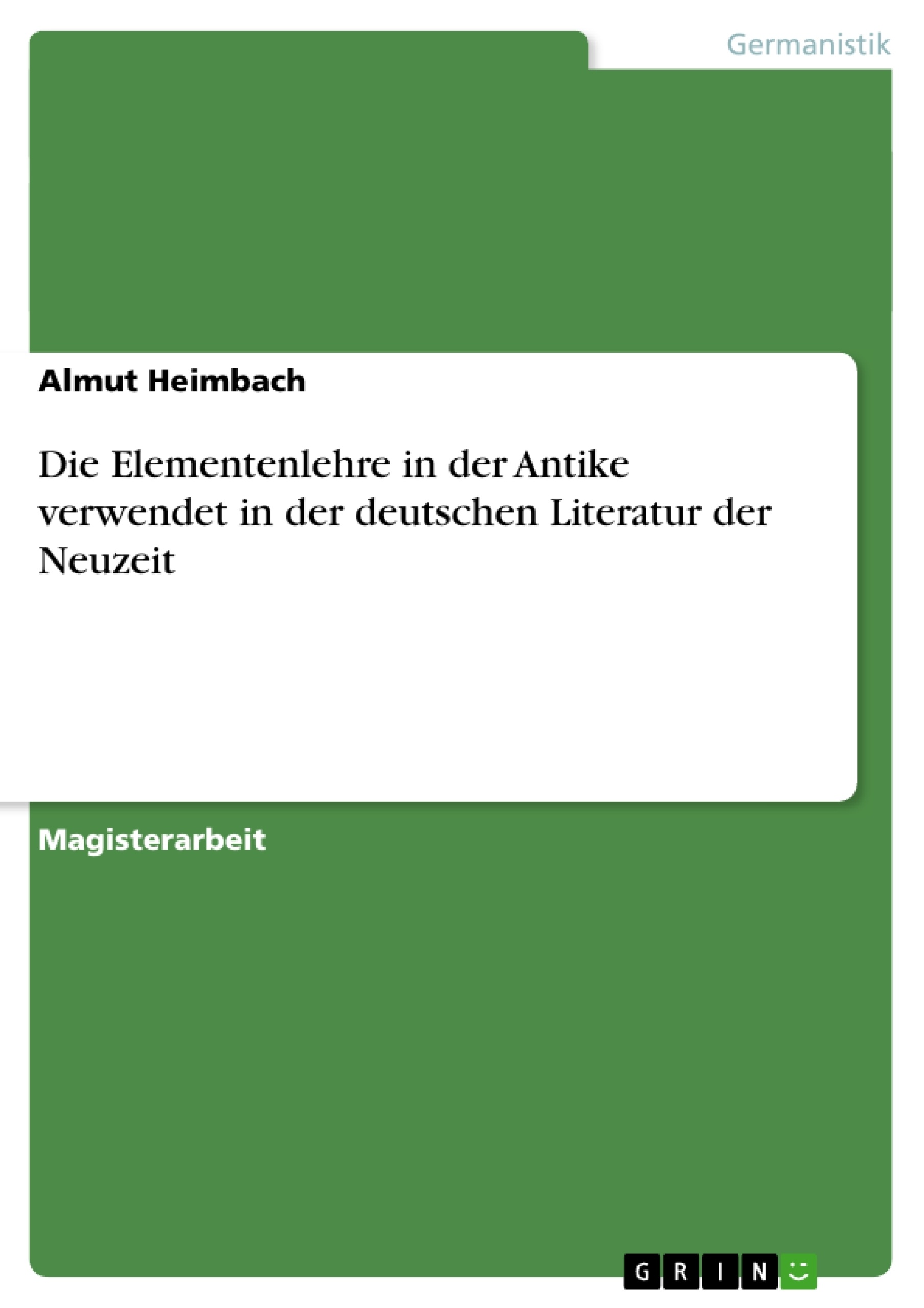Schon von jeher haben sich die Menschen die Frage gestellt, wie wohl die Vielgestaltigkeit der Schöpfung zustande gekommen sei, auf welche Prinzipien sie zurückgeführt und wie sie geordnet werden könne; und so verschieden die Kulturen waren, so unterschiedlich fielen auch die Antworten auf diese Frage aus.
Nach einer dieser Überlegungen wurde angenommen, daß alle Dinge, die wir um uns herum sehen, aus den vier Elementen Feuer, Erde, Wasser und Luft aufgebaut seien.
Das Wort „Element“ kommt vom lateinischen „elementum = Urstoff, Buchstabe“. Das Wort stammte vielleicht aus dem Etruskischen oder stellt eine Zusammenziehung der Mittelbuchstaben LMN des lateinischen und griechischen Alphabetes dar, vielleicht ist es aber auch eine Ableitung vom griechischen eléphas (Elfenbein), da die Kinder reicher Römer das Alphabet anhand von Buchstaben aus Elfenbein lernten.
So verwendeten auch Platon und Aristoteles das Wort „stoicheion“ für die Bezeichnung der Elemente, das neben seiner Bedeutung als einfache Substanz, Grundstoff, Prinzip eben auch die Bedeutung Buchstabe hatte.
Die Elementenlehre durchlief verschiedene Stadien, ehe sie in der Kombination der vier Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft bei Empedokles auftauchte, dessen Vorstellungen bis in die frühe Neuzeit hinein einen ganz wesentlichen Einfluß auf das Weltbild und die Wissenschaften im Abendland hatte.
Jede Elementenlehre baut sich auf einem ursprünglichen Elementarerlebnis auf. In den frühen Kulturen waren die Götter ein Teil der Natur, und in dieser Vorstellung fanden sich die Elemente als Grundformen und Kräfte der Natur, ohne allerdings als eigenständige, personifizierte Kräfte in Erscheinung zu treten.
So finden sich auch im Schöpfungsmythos des Buch Mose, dessen Entstehen bis in das 8. Jahrhundert vor Christus datiert wird, Himmel (Luft), Erde, Licht (Feuer) und Wasser als Urbestandteile der Schöpfung.
Die Babylonier und später die Ägypter hatten zunächst das Wasser und später auch Luft und Erde als Hauptbestandteil der Erde angesehen.
Wohingehend die Chinesen schon 600 v. Chr. die 5 Elemente Wasser, Feuer, Holz, Metall und Erde unterschieden, welche sie den Jahreszeiten, den Himmelsrichtungen und menschlichen Fähigkeiten zuordneten.
Griechen verwandte Vorstellungen, welche später in der Heilbehandlung Einfluß auf die Säftelehre Hippokrates nahmen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Die Elementenlehre in der Antike
- a) Einleitung
- b) Entwicklung einer Elementenlehre
- c) Empedokles und die vier Wurzeln des Seins
- d) Weiterentwicklung der Elementenlehre
- II. Die Elementenlehre im Mittelalter
- a) Die Vierheit der Weltordnung
- b) Weltbild
- c) Die Elemente in der Lehre von der Natur
- d) Alchemie
- e) Paracelsus
- f) Übergang zur neuzeitlichen Chemie
- g) Astrologie
- III. Die Elementenlehre in der deutschen Literatur der Neuzeit
- a) Einleitung
- b) Naturphilosophie und Romantik
- c) Klassische Wiedergabe
- d) Weltentstehen
- e) Weltbild
- f) Alchemie und Zauberei
- g) Astrologie und Temperamentenlehre
- h) Elementargeister
- IV. Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Verwendung der antiken Elementenlehre in der deutschen Literatur der Neuzeit. Ziel ist es, die Rezeption und Transformation dieses antiken Konzepts in verschiedenen literarischen Epochen und Strömungen nachzuzeichnen.
- Die Entwicklung der Elementenlehre in der Antike
- Die Übernahme und Adaption der Elementenlehre im Mittelalter
- Die Darstellung der Elemente in der Naturphilosophie und Romantik
- Die Rolle der Elementenlehre in der Literatur der Neuzeit (Alchemie, Astrologie, etc.)
- Der Wandel des Weltbildes im Kontext der Elementenlehre
Zusammenfassung der Kapitel
I. Die Elementenlehre in der Antike: Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursprüngen der Vorstellung von den vier Elementen – Feuer, Wasser, Erde und Luft – als grundlegenden Bausteinen der Welt. Es untersucht die Entwicklung dieser Lehre von frühen Ansätzen bis hin zu den systematischen Ausarbeitungen bei Philosophen wie Empedokles. Die Kapitel beleuchtet verschiedene Interpretationen des Begriffs "Element" und deren Bedeutung in philosophischen und wissenschaftlichen Kontexten der Antike. Die etymologischen Wurzeln des Wortes "Element" werden ebenso erforscht, wie die Verwendung des Begriffs "Stoicheion" bei Platon und Aristoteles. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der späteren Rezeption und Transformation dieser Konzepte in der Literatur.
II. Die Elementenlehre im Mittelalter: Das Kapitel analysiert die Weiterentwicklung und den Einfluss der antiken Elementenlehre im Mittelalter. Es untersucht, wie die Vierheit der Elemente in die mittelalterliche Weltordnung integriert wurde und welche Rolle sie in verschiedenen philosophischen und wissenschaftlichen Disziplinen spielte, unter anderem in der Naturlehre, der Alchemie und der Astrologie. Der Einfluss von Paracelsus und der Übergang zur neuzeitlichen Chemie werden ebenfalls beleuchtet, wobei die Kontinuität und der Wandel der Konzepte im Fokus stehen. Die Zusammenfassung der Kapitel zeigt die Integration der antiken Lehre in das mittelalterliche Weltbild.
III. Die Elementenlehre in der deutschen Literatur der Neuzeit: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rezeption und die literarische Darstellung der Elementenlehre in der deutschen Literatur der Neuzeit. Es untersucht die Verwendung der Elemente in verschiedenen literarischen Epochen und Strömungen, von der Naturphilosophie und der Romantik bis hin zu späteren literarischen Werken. Die Analyse umfasst verschiedene Aspekte wie die Darstellung von Weltentstehung, Weltbildern, Alchemie, Zauberei, Astrologie und die Vorstellung von Elementargeistern. Das Kapitel beleuchtet, wie die antike Lehre transformiert und in neue literarische Kontexte eingebunden wurde. Der Schwerpunkt liegt auf der literarischen Interpretation und der symbolischen Bedeutung der Elemente.
Schlüsselwörter
Elementenlehre, Antike, Mittelalter, Neuzeit, deutsche Literatur, Naturphilosophie, Romantik, Alchemie, Astrologie, Weltbild, Empedokles, Paracelsus, Elementargeister, Stoicheion.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Die Elementenlehre in der deutschen Literatur der Neuzeit
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Verwendung der antiken Elementenlehre (die Lehre von den vier Elementen: Feuer, Wasser, Erde und Luft) in der deutschen Literatur der Neuzeit. Sie verfolgt die Rezeption und Transformation dieses antiken Konzepts über verschiedene literarische Epochen und Strömungen hinweg.
Welche Epochen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Elementenlehre von der Antike über das Mittelalter bis in die deutsche Literatur der Neuzeit. Der Fokus liegt dabei auf der Rezeption und Adaption in der Neuzeit.
Welche Themenschwerpunkte werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Elementenlehre in der Antike, ihre Übernahme und Adaption im Mittelalter, ihre Darstellung in der Naturphilosophie und Romantik der Neuzeit, ihre Rolle in der Literatur (inkl. Alchemie, Astrologie etc.) und den Wandel des Weltbildes im Kontext der Elementenlehre.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel I behandelt die Elementenlehre in der Antike, Kapitel II die Elementenlehre im Mittelalter, Kapitel III die Elementenlehre in der deutschen Literatur der Neuzeit und Kapitel IV bietet eine abschließende Betrachtung.
Was wird im Kapitel zur Antike behandelt?
Kapitel I befasst sich mit den Ursprüngen der Vorstellung von den vier Elementen, ihrer Entwicklung bis zu Philosophen wie Empedokles, verschiedenen Interpretationen des Begriffs "Element", der etymologischen Wurzel des Wortes und der Verwendung von "Stoicheion" bei Platon und Aristoteles. Es legt den Grundstein für das Verständnis der späteren Rezeption.
Was wird im Kapitel zum Mittelalter behandelt?
Kapitel II analysiert die Weiterentwicklung und den Einfluss der antiken Elementenlehre im Mittelalter. Es untersucht die Integration der Vierheit der Elemente in die mittelalterliche Weltordnung, ihre Rolle in verschiedenen Disziplinen (Naturlehre, Alchemie, Astrologie), den Einfluss von Paracelsus und den Übergang zur neuzeitlichen Chemie.
Was wird im Kapitel zur deutschen Literatur der Neuzeit behandelt?
Kapitel III konzentriert sich auf die Rezeption und literarische Darstellung der Elementenlehre in der deutschen Literatur der Neuzeit. Es untersucht die Verwendung der Elemente in verschiedenen Epochen und Strömungen (Naturphilosophie, Romantik etc.), die Darstellung von Weltentstehung, Weltbildern, Alchemie, Zauberei, Astrologie und Elementargeistern sowie die literarische Interpretation und symbolische Bedeutung der Elemente.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Elementenlehre, Antike, Mittelalter, Neuzeit, deutsche Literatur, Naturphilosophie, Romantik, Alchemie, Astrologie, Weltbild, Empedokles, Paracelsus, Elementargeister, Stoicheion.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Rezeption und Transformation des antiken Konzepts der Elementenlehre in verschiedenen literarischen Epochen und Strömungen der deutschen Literatur nachzuzeichnen.
- Quote paper
- Almut Heimbach (Author), 2000, Die Elementenlehre in der Antike verwendet in der deutschen Literatur der Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43555