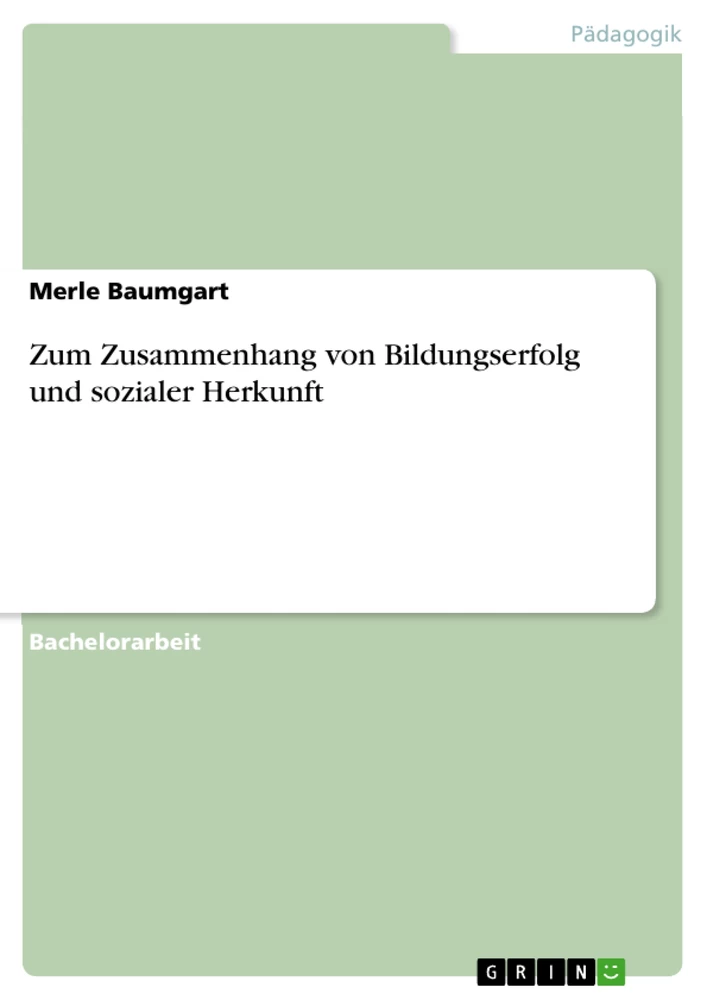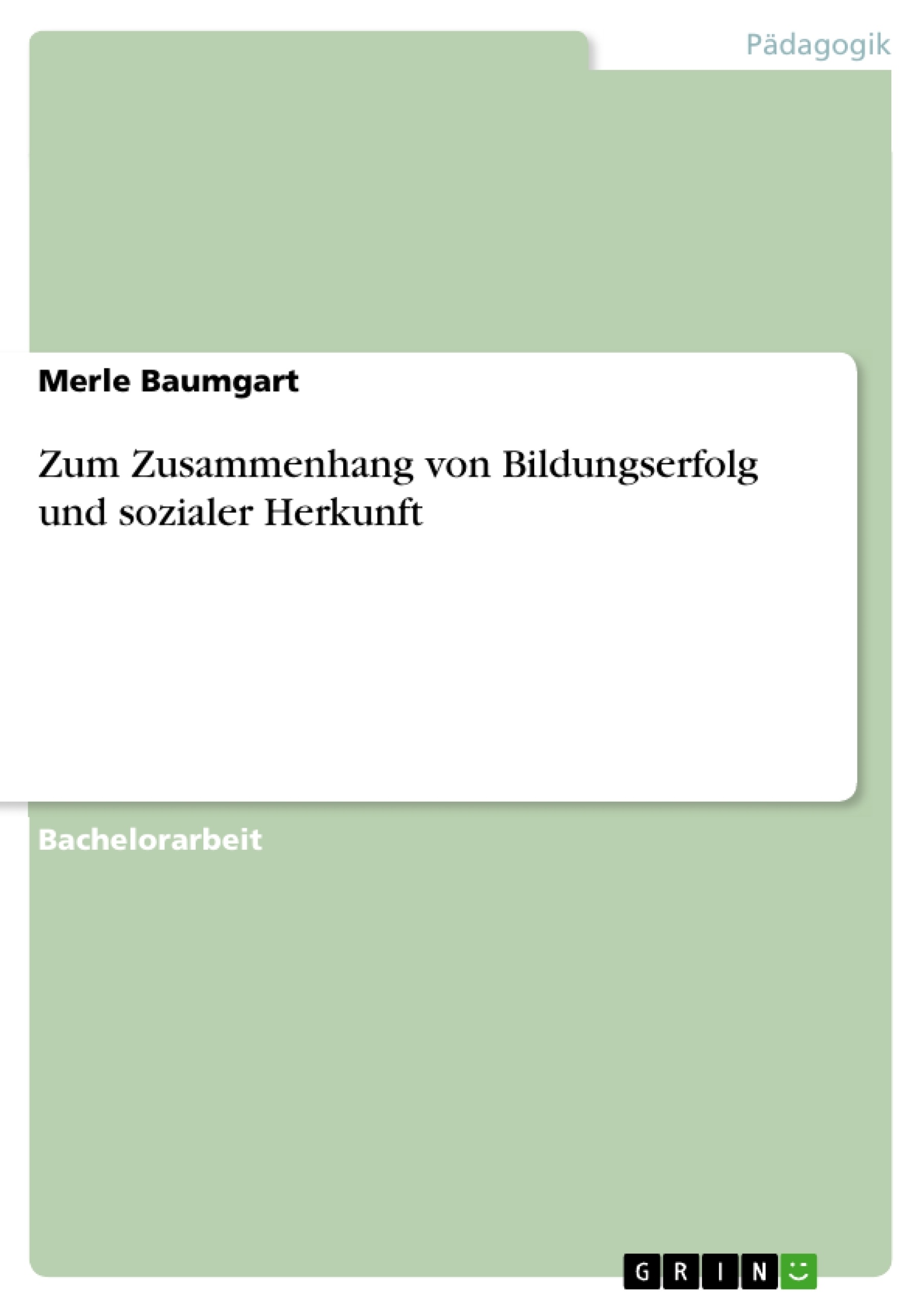„Jeder hat das Recht auf Bildung“ lautet Artikel 26 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948. An diesem Tag legten die Vereinten Nationen in einer Generalversammlung die 30 Artikel der bis heute geltenden Menschenrechte fest. Bildung gilt demnach nicht nur in der deutschen Gesellschaft seit 1948 als Menschenrecht. Doch der Weg von der Absichtserklärung zur konkreten Umsetzung scheint auch heute noch lang und voller Barrieren zu sein.
Bildung gehört in vielen Gesellschaften noch immer zu den Privilegien der wohlhabenden Haushalte, die sich Bildung leisten können und ist keineswegs als Recht für alle zu verzeichnen. Vielen Kindern und Jugendlichen aus sozial schlechter gestellten Familien bleibt die Verwirklichung ihres Rechts auf Bildung bisher verwehrt.
Wenn die wachsende Relevanz von Bildung in der Gesellschaft berücksichtigt wird, lässt sich eine folgenreiche Spaltung der Bildungsbeteiligung dokumentieren. Wissen wird im Gegensatz zu herkömmlichen Produktionsfaktoren wie Kapital, Land und Arbeit zunehmend wichtiger und gewinnt an Bedeutung in der deutschen Gesellschaft. Der Begriff der ‚Wissensgesellschaft‘ wird daher häufiger als Bezeichnung für die gegenwärtige Gesellschaftsform verwendet. Auch für eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe bekommen Bildung und Ausbildung eine immer größere Bedeutung. Beschäftigungsmöglichkeiten für gering qualifizierte Personen nehmen stetig ab.
Für die nachfolgende Arbeit komme ich daher zu folgender Fragestellung: Inwiefern hat sich der Zusammenhang von Bildungserfolg und sozialer Herkunft von Kindern und Jugendlichen seit 1948 vergrößert? In dieser Arbeit beschränke ich mich aus Platzgründen auf die soziale Herkunft von Kindern und Jugendlichen und gehe auf andere, den Bildungserfolg beeinflussende Faktoren nur eingeschränkt ein. Das gilt vor allem für die mit vielen Hoffnungen verbundene Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die dafür Sorge tragen soll, dass ein uneingeschränkter Bildungsanspruch von Menschen mit Behinderung gesichert ist. Dazu zählen auch die soziale Herkunft und die damit verbundene Bildungsbenachteiligung. Eine ausführliche Analyse der ‚schulischen Inklusion‘ würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Innerhalb der Kategorie der sozialen Herkunft soll eine statistische Analyse anhand einzelner Vergleichskohorten unterschiedlicher Abiturjahrgänge stattfinden. Diese soll die Entwicklung des Zusammenhangs von sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Bildungserfolg
- 2.2 Soziale Ungleichheit
- 2.3 Soziale Herkunft
- 3. Entwicklung des deutschen Bildungssystems
- 3.1 Bildungspolitik
- 3.2 Erziehungswissenschaft
- 3.3 Organisation und Schulstruktur
- 3.4 Sozialisation
- 4. Bildungserfolg und Soziale Herkunft
- 4.1 Abiturjahrgang 1967 und 1994
- 4.2 Abiturjahrgang 1985 und 2014
- 5. Zusammenfassung
- 6. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Bildungserfolg und sozialer Herkunft und untersucht, inwiefern dieser Zusammenhang seit 1948 verstärkt wurde. Dabei fokussiert die Arbeit auf die soziale Herkunft von Kindern und Jugendlichen und betrachtet weitere Einflussfaktoren nur eingeschränkt. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des deutschen Bildungssystems und analysiert die Entwicklung des Zusammenhangs von sozialer Herkunft und Bildungserfolg anhand statistischer Daten unterschiedlicher Abiturjahrgänge.
- Entwicklung des deutschen Bildungssystems
- Bildungserfolg und soziale Ungleichheit
- Statistische Analyse des Zusammenhangs zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg
- Entwicklung des Zusammenhangs von Bildungserfolg und sozialer Herkunft seit 1948
- Bedeutung von Bildung für die gesellschaftliche Teilhabe
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik des Bildungserfolgs und der sozialen Herkunft ein und stellt die Relevanz des Themas in der heutigen Gesellschaft dar. Sie benennt die wachsende Bedeutung von Bildung für die gesellschaftliche Teilhabe und stellt die Fragestellung der Arbeit vor: Inwiefern hat sich der Zusammenhang von Bildungserfolg und sozialer Herkunft seit 1948 verstärkt?
Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
Dieses Kapitel definiert die Kernbegriffe Bildungserfolg, soziale Ungleichheit und soziale Herkunft. Es erläutert den Anspruch auf Chancengleichheit im Bildungssystem und die verschiedenen Faktoren, die den Bildungserfolg eines Individuums beeinflussen können, einschließlich schulischer Rahmenbedingungen, politischer Grundvoraussetzungen und familiärer Hintergründe.
Kapitel 3: Entwicklung des deutschen Bildungssystems
Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung des deutschen Bildungssystems seit 1948, unterteilt in die Bereiche Bildungspolitik, Erziehungswissenschaft, Organisation und Schulstruktur sowie Sozialisation. Es beleuchtet die politischen und gesellschaftlichen Einflüsse auf die Entwicklung des Bildungssystems und seine Strukturen.
Kapitel 4: Bildungserfolg und Soziale Herkunft
Dieses Kapitel analysiert den Zusammenhang von Bildungserfolg und sozialer Herkunft anhand statistischer Daten verschiedener Abiturjahrgänge. Es untersucht die Entwicklung des Zusammenhangs im Laufe der Zeit und beleuchtet die Rolle der sozialen Herkunft als Faktor für den Bildungserfolg.
Kapitel 5: Zusammenfassung
Die Zusammenfassung fasst die zentralen Ergebnisse und Erkenntnisse der Arbeit zusammen und bewertet die Bedeutung der Ergebnisse für die Bildungspraxis und die Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Bildungserfolg, soziale Herkunft, Chancengleichheit, Bildungssystem, Bildungspolitik und Sozialisation. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des deutschen Bildungssystems seit 1948 und den Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen. Die Analyse erfolgt anhand statistischer Daten und die Ergebnisse werden in der Zusammenfassung diskutiert.
- Quote paper
- Merle Baumgart (Author), 2016, Zum Zusammenhang von Bildungserfolg und sozialer Herkunft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/435374