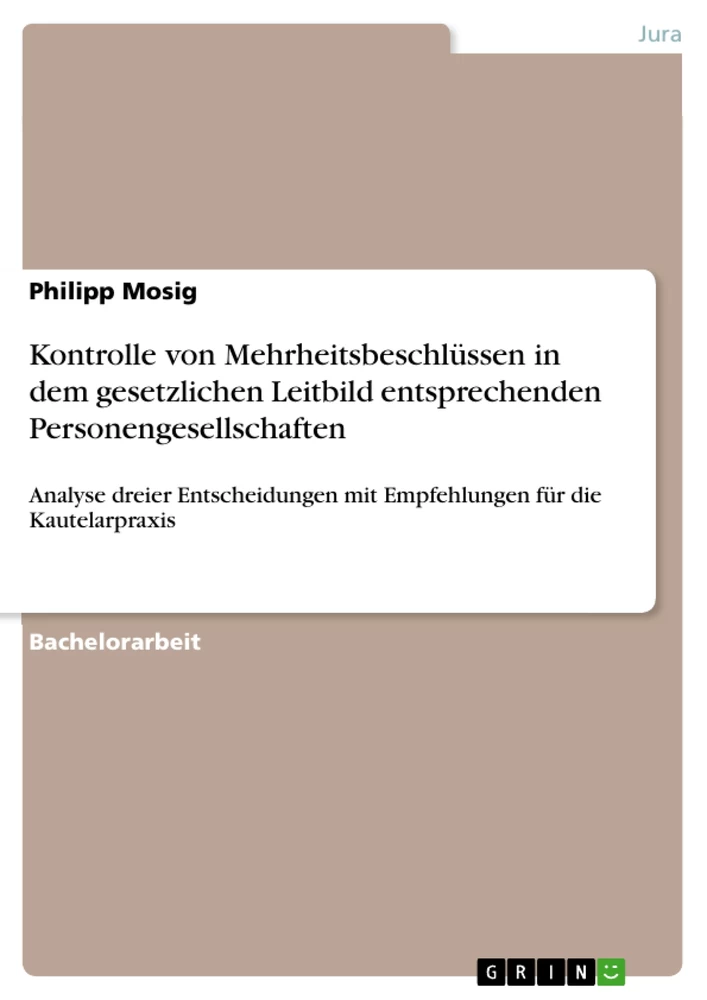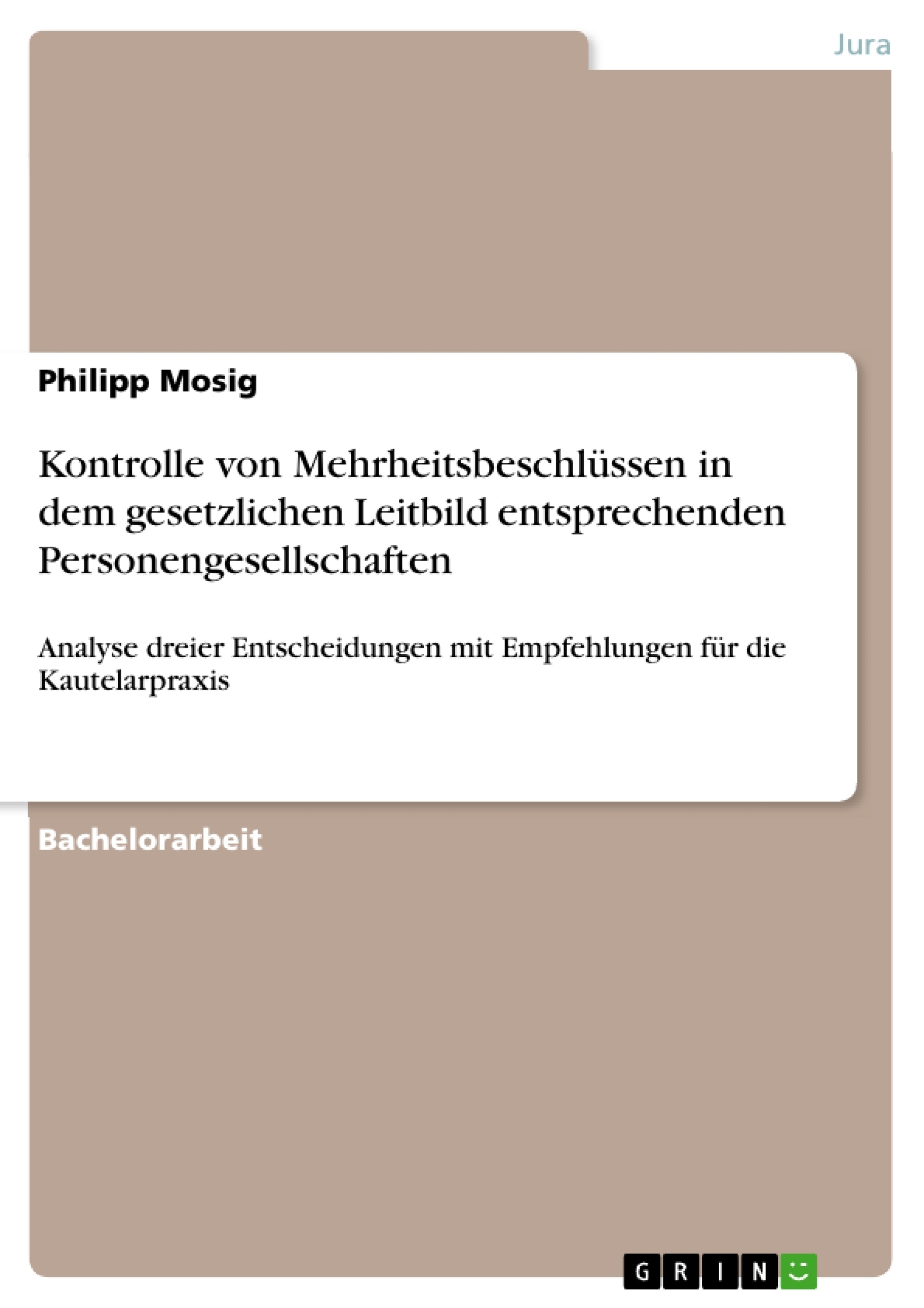Das Innenrecht der Personenhandelsgesellschaften (im weiteren Personengesellschaften) unterliegt dem Gesetzesrecht. Lässt dieses Dispositionen zu, so sollen in den jeweiligen Fällen die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages (im weiteren GV) gelten. Dies gilt auch für die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung (§§ 709 II BGB, § 119 II HGB).
Eine Abweichung vom gesetzlichen Leitbild bewirkt eine Verschiebung der gesetzlich angedachten Verteilung von Rechten und Pflichten. Bei der Personengesellschaft als zumeist am Wirtschaftsverkehr teilnehmender Organisation mehrerer Personen ist eine solche Verschiebung bei der Beschlussfassung individuell ausgestaltet. So soll vom Einstimmigkeitsprinzip abgewichen werden, um die Vorteile flexibler Mehrheitsentscheidungen zu erlangen. Ein Unternehmen welches sich am Markt halten will ist auf zeitnahe
Entscheidungen angewiesen. Das Einstimmigkeitsprinzip birgt das Risiko der Verzögerung durch die Sperrmacht eines einzelnen Gesellschafters.
Im Hinblick auf die Ausgestaltung jener Dispositionen war die Rechtsprechung immer wieder gefordert und beeinflusste durch ihre Urteile die Gestaltung von Vertragsklauseln. Geformt wurden so auch der Bestimmtheitsgrundsatz, sowie die Kernbereichslehre. Durch die Entscheidungen BGHZ 170, 283 ff., BGHZ 179, 13 ff. und NJW 2015, 859 nahm der BGH erneut Einfluss auf die Rechtslage. So erklärte er die Bedeutungslosigkeit des Bestimmtheitsgrundsatzes und der Kernbereichslehre und ersetzte diese durch neue Prüfmechanismen. Eine Analyse der damit einhergehenden Veränderung der Rechtslage durch jene Grundsatzentscheidungen wird in dieser Arbeit die Basis für die sich daraus ergebenden Empfehlungen sein. Des weiteren werden Auswirkungen auf die Kautelarpraxis dargestellt und bewertet. Somit können abschließend die bezweckten und die bewirkten Veränderungen durch den BGH nebeneinander treten.
Inhaltsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Entscheidungsregister
Einleitung
A. Wandel der Kontrolle von Mehrheitsbeschlüssen in Personenhandelsgesellschaften
I. Darstellung der Sachverhalte zu Otto', 'Schutzgemeinschaftsvertrag II', NJW 2015,
1. Die Otto-Entscheidung
2. Schutzgemeinschaftsvertrag II
3. Der Sachverhalt des NJW 2015,
II. Das gegenwärtige Kontrollsystem im Vergleich zum einstigen Rechtsstand
1. Der Werdegang des vormaligen Kontrollsystems
a) Der Bestimmtheitsgrundsatz bis zur Otto-Entscheidung
b) Die Kernberelchslehre bis Otto
c) Zusammenfassung der Kontrollmechanlsmen
2. Errichtung des neuen Kontrollsystems
3. Analyse rechtsfortblldender Elemente des Systemwechsels
a) Das 2-Stufensystem
b) Das Belastungsverbot im neuen System
c) Umgestaltung der Auslegung von Mehrheitsklauseln
aa) Auswirkungen der Abkehr von restriktiver Auslegung
bb) Relevanz der Katalogisierung seit Schutzgemeinschaftsvertrag II
cc) Nebeneffekte der allgemeinen Auslegungsregeln
dd) Das neue System im Kontext zwischenmenschlicher Konflikte
ее) Konkurrenz der Quoren
ff) Zusammenfassung formeller Divergenzen der Prüfsysteme
d) Ablösung der Kernbereichslehre
aa) Abschaffung fixer Kernrechte
bb) Entbehrlichkeit der antizipierten Zustimmung
cc) Die Treuepfllcht In der neuen materiellen Prüfung
dd) Zusammenfassung materieller Divergenzen der Prüfsysteme
B. Empfehlungen für die Kautelarpraxis
I. Grundsätzliche Gestaltungsfragen
1. Die sichere Mehrheitskompetenz
2. Der totale Minderheitenschutz
II. Abschließendes Kompendium
Literaturverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Entscheidungsregister
Reichsgericht
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bundesgericht
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Instanzgerichte
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einleitung
Das Innenrecht der Personenhandelsgesellschaften (im weiteren Personengesellschaften) unterliegt dem Gesetzesrecht. Lässt dieses Dispositionen zu, so sollen in den jeweiligen Fällen die Bestimmungen des GesellSchaftsvertrages (im weiteren GV) gelten. Dies gilt auch für die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung (§§ 709 II BGB, § 119 II HGB). Eine Abweichung vom gesetzlichen Leitbild bewirkt eine Verschiebung der gesetzlich angedachten Verteilung von Rechten und Pflichten. Bei der Personengesellschaft als zumeist am Wirtschaftsverkehr teilnehmender Organisation mehrerer Personen ist eine solche Verschiebung bei der BeSchlussfassung individuell ausgestaltet. So soll vom Einstimmigkeitsprinzip abgewichen werden, um die Vorteile flexibler Mehrheitsentscheidungen zu erlangen. Ein Unternehmen welches sich am Markt halten will ist auf zeitnahe Entscheidungen angewiesen. Das Einstimmigkeitsprinzip birgt das Risiko der Verzögerung durch die Sperrmacht eines einzelnen Gesellschaf- ters.1 Im Hinblick auf die Ausgestaltung jener Dispositionen war die Rechtsprechung immer wieder gefordert und beeinflusste durch ihre Urteile die Gestaltung von Vertragsklauseln. Geformt wurden so auch der Bestimmtheitsgrundsatz, sowie die Kernbereichslehre. Durch die Entscheidungen BGHZ 170, 283 ff., BGHZ 179, 13 ff. und NJW 2015, 859 nahm der BGH erneut Einfluss auf die Rechtslage. So erklärte er die Bedeutungslosigkeit des Bestimmtheitsgrundsatzes und der Kernbereichslehre und ersetzte diese durch neue Prüfmechanismen. Eine Analyse der damit einhergehenden Veränderung der Rechtslage durch jene Grundsatzentscheidungen wird in dieser Arbeit die Basis für die sich daraus ergebenden Empfehlungen sein. Des weiteren werden Auswirkungen auf die Kautelarpraxis dargestellt und bewertet. Somit können abschließend die bezweckten und die bewirkten Veränderungen durch den BGH nebeneinander treten.
A. Wandel der Kontrolle von Mehrheitsbeschlüssen in Personenhandelsgesellschaften
Der Wandel der Kontrolle von Mehrheitsbeschlüssen in Personenhandelsgesellschaften wird im Folgenden anhand der Chronologie aktueller Grundsatzentscheidungen, dargestellt. Die tatsächlichen Veränderungen, sowie deren Auswirkungen können dann neben dem Ausgangssystem stehen, sodass eine Bewertung mit anschließender Empfehlung möglich wird.
I. Darstellung der Sachverhalte zu Otto', 'Schutzgemeinschaftsvertrag II', BGH NJW 2015, 859
Im Laufe der Zeit hat der BGH durch Grundsatzentscheidungen immer wieder die bestehende Rechtslage verändert. Für Mehrheitsbeschlüsse sind von diesen Grundsatzentscheidungen die sog. Otto-Entscheidung, der Schutzgemeinschaftsvertrag II (im weiteren SG II), sowie NJW 2015, 859 relevant. Diese Entscheidungen sollen hier kurz im Bezug auf den ihnen zu Grunde liegenden Sachverhalt dargestellt werden. Anhand dieser Darstellungen werden sodann die sich daraus begründenden Veränderungen im Vergleich zur ehemaligen Rechtsprechung dargestellt und analysiert.
1. Die Otto-Entscheidung
Am 15.01.2007 entschied der BGH im sogenannten Otto-Fall die Streitsache der Gesellschafter der Otto GmbH & Co. KG zugunsten der Beklagten. Die drei beklagten Gesellschafter hielten zusammen 75 % des Kommandit- kapitals und weitere 75 % am Stammkapital der Komplementär-GmbH. Die Kläger hielten insgesamt 25 % sowohl am Kommanditkapital, als auch am Stammkapital der GmbH. Der zugrunde liegende Gesellschaftsvertrag lautete unter anderem: 5) 6 §״) Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der auf das Kommanditkapital entfallenden stimmen gefasst, soweit nicht einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages oder sonstige Vereinbarungen der Gesellschafter etwas anderes vorschreiben.“.2
Der Gesellschaftsvertrag bestimmte weiterhin in § 6 Absatz 6, dass Änderungen des Gesellschaftsvertrages, insbesondere Veränderungen der Einlagenverpflichtungen, die Auszahlung von Beträgen zu Lasten der Darlehenskonten und die Abberufung der Komplementärin einer qualifizierten Mehrheit von 76 % bedürfen.3 In § 6 Absatz 7 GV wurde mit einem Katalog außergewöhnlicher Geschäfte fortgefahren. Die gelisteten Geschäfte bedurften einer Zustimmung von Mehrheit 63 %.4
Streitgegenstand waren zwei Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, welche zum einen die Feststellung des Jahresabschlusses und zum ande-ren die Gewinnverwendung betrafen.5 Die Beschlüsse wurden mit 75 % der Stimmen gefasst, wobei die Kläger mit 25 % dagegen stimmte. Ziel der Klage war die Feststellung der Nichtigkeit der Beschlüsse, da es nach Ansicht der Kläger der Einstimmigkeit bedurft hätte. Da sich die Kläger hier auf § 119 I HGB beziehen und somit kein zwingendes Recht das Einstimmigkeitserfordernis begründen sollte, ist eine Mehrheitskompetenz durch Dispositionen nicht von vornherein unmöglich.6 Das Gericht prüfte den Gesellschaftsvertrag auf eine die Beschlüsse legitimierende Klausel.
Mit Bezug auf § 6 Absatz 5 GV stellte das Gericht fest, dass es keine abweichenden Vereinbarungen für die Feststellung des Jahresabschlusses gab. Absatz 6 des § 6 GV sei nicht einschlägig, sodass die erreichten 75 % der Stimmen zur wirksamen Beschlussfassung ausreichten. Das Gericht sah die Tatbestandsmerkmale der Klausel letztendlich als erfüllt an.7
Die formelle Legitimation der Generalklausel setzte eine einfache Mehrheit, sowie das Fehlen speziellerer Normen voraus. Eine einfache Mehrheit wurde erreicht. Der BGH verwies darauf, dass der Katalog keine Beschlüsse über den Jahresabschluss enthält und so eine qualifizierte Mehrheit von 63 % nicht infrage käme. Zudem stelle der Jahresabschluss kein Geschäft i.s.d. § 6 Absatz 6 GV dar, sodass auch diese Klausel nicht einschlägig sei.8 Das die Generalklausel aufgrund eines Verstoßes gegen den Bestimmtheitsgrundsatz unwirksam sei, wie dies die Revision festgestellt hatte, widerlegte der BGH und erklärte die vorliegende Generalklausel dem Bestimmtheitsgrundsatz entsprechend. Zwar wurde der Beschlussgegenstand nicht in der Generalklausel explizit genannt, wie dies die Vorinstanz voraussetzte, doch sei die Klausel trotzdem in einem ausreichenden Maße bestimmt genug.
Der Beschluss wurde daher formell legitimiert. Zudem stellte der BGH fest, dass eine materielle Verletzung von Gesellschafterrechten nicht gegeben sei.9 Der BGH wies sodann die Revision auf Kosten der Klägerin zurück.
2. Schutzgemeinschaftsvertrag II
Der SG !!-Entscheidung lag eine solche Gesellschafterstruktur zugrunde, dass das Grundkapital der gegenständlichen DGF-AG zu ca. 38 % vom Familienstamm der Klägerin gehalten wurde. Die vier Beklagten waren als Familienstamm in Besitz von insgesamt ca. 32 % des Grundkapitals. Die verbliebenen 30 % verteilten sich zu ca. 10 % auf Streubesitz und zu 20 % auf einen weiteren Familienstamm. Letzterer war in das Verfahren jedoch nicht involviert.10 Die genannten drei Familienstämme hatten mittels eines Schutzgemeinschaftsvertrages (im weiteren SGV) ein Stimmrechtskonsortium zwecks Stimmbündelung gegründet.11 Dieses befand sich stets in der Rechtsform einer Außen-GbR.12 Dem SGV lagen unter anderem die folgenden Klauseln zu Grunde:
Gemäß § 5 Nr. 2 SGV ist jedes Mitglied der Schutzgemeinschaft verpflichtet, sein Stimmrecht in den Gesellschafterversammlungen der Vertragsunternehmen so auszuüben, wie dies in den jeweils zuvor abzuhaltenden Mitgliederversammlungen der Schutzgemeinschaft mit einfacher Mehrheit (nach Gesellschaftsanteilen) beschlossen worden ist.13
Sofern von einem Konsortiumsmitglied eine vom Beschluss des Konsortiums abweichende stimme in der Hauptversammlung der DGF-AG abgegeben würde, löste dies eine Vertragsstrafe nach § 8 SGV aus. § 4 Nr. 3 SGV bestimmte weiterhin, dass der aufgrund von § 5 Nr. 2 SGV gefasste BeSchluss auch dann verpflichtend ist, wenn jener Beschlussgegenstand in der DGF-AG ein höheres Quorum bedurft hätte.
Auf Hauptversammlungen der DGAF-AG am 05.05.2000, sowie am 24.04.2001 stimmten die Beklagten entgegen der Beschlüsse der Schutzgemeinschaft. Diese Beschlüsse der Schutzgemeinschaft waren durch einfache Mehrheit gefasst worden. Die Klägerin forderte aus diesem Grund die Vertragsstrafe ein. Weiterhin klagte sie auf Feststellung der Verbindlichkeit des § 5 Nr. 2 SGV. Die Beklagten waren der Ansicht, dass keine stimmbindung durch die Beschlüsse der Schutzgemeinschaft für die besagten BeSchlüsse der AG entstanden seien. Dies wurde damit begründet, dass die Beschlüsse in der AG einer zwingenden qualifizierten Mehrheit von % bedurft hätten (§ 12 III Nr. UmwG und §§ 291, 293 AktG). Folglich müssten diese Quoren auch auf die Schutzgemeinschaft durchschlagen, trotz das diese in der Rechtsform einer GbR sei. Der BGH folgte letzterer Ansicht nicht und wies die Revision auf Kosten der Beklagten zurück.
3. Der Sachverhalt des NJW 2015, 859
In NJW 2015, 859 hatte der BGH darüber zu entscheiden, ob der BeSchluss, mit dem ein Kommanditist verpflichtet werden sollte entgegen seiner Stimme seinen Anteil abzutreten, nichtig ist. Im vorliegenden Fall waren der Kläger wie auch der Beklagte Kommanditisten der Gebrüder s. GmbH & Co. KG. Weitere Beklagte war die Gebrüder s. Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementärin. Die Beklagten fassten gemeinsam entgegen der Stimme des Klägers die Beschlüsse, dass sämtliche Anteile des Klägers wie auch der Beklagten entschädigungslos auf die M. Stiftung zu übertragen seien. Der Kläger war der Auffassung, dass es hierzu der Einstimmigkeit bedurft hätte. Die Beklagten gingen von einer Mehrheitskompetenz mit einfacher Mehrheit aus. Das zugrunde liegende Vertragswerk sah in den relevanten Passagen folgendes vor:
6 §״ Gesellschafterversammlung
(4) Die Gesellschafter haben insgesamt 100 stimmen. Davon entfallen
- auf die ... [Beklagte zu 1 (Verwaltungsgesellschaft)/ 80 stimmen,
- auf den ... [Beklagten zu 2] 10 stimmen und
- auf den ... [Kläger] 10 stimmen.
(5) Soweit nicht in diesem Gesellschaftsvertrag öderim Gesetz ausdrücklich abweichend geregelt, erfolgen die Beschlussfassungen der Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit der vorhandenen Stimmen.
(6) Beschlüsse zur Änderung des Gesellschaftsvertrags bedürfen der Einstimmigkeit.
§ 10 Verfügungen über Gesellschaftsanteile
(1) Verfügungen über Gesellschaftsanteile, insbesondere deren Abtretung, Teilung oder Belastung, und zwar auch zum Zwecke der Begründung einer Unterbeteiligung oder eines Treuhandverhältnisses, bedürfen der Einwilligung der Gesellschafterversammlung.
(2) Das Gleiche gilt sinngemäß für Verfügungen über schuldrechtliche
Ansprüche wie Abtretung von Gewinnansprüchen oder den Anspruch auf Liquidationserlös.
(3) Verfügungen, die nicht die Billigung der Gesellschafterversammlung gefunden haben, sind unwirksam.“.14
Die streitgegenständlichen Beschlüsse führten als Ermächtigungsgrundlage § 10 Absatz 1 GV an.15 Das Berufungsgericht lies dies nicht als Ermächtigungsgrundlage gelten und hatte den Fall zuvor für den Kläger entschieden. § 10 Absatz 1 GV genüge nicht, da ein Zustimmungserfordernis noch keine Mehrheitskompetenz begründe. Weiterhin stellte das Berufungsge- rieht ein Einstimmigkeitserfordernis fest, da § 6 Absatz 5 GV, also die Generalklausel, durch den Bestimmtheitsgrundsatz auf gewöhnliche Geschäfte beschränkt werde.16 Diese Rechtsauffassung korrigiert der BGH dahingehend, dass allgemeine Mehrheitsklauseln nicht durch den Bestimmtheitsgrundsatz beschränkt werden. Zudem sei in der Folge auch keine BeSchränkung einer Mehrheitsklausel auf gewöhnliche Geschäfte vorhanden. Eine Generalklausel kann für gewöhnliche, ungewöhnliche und Grundlagengeschäfte eine formelle Mehrheitskompetenz begründen.17 Der BGH stellte zudem ausdrücklich klar, dass diese Unabhängigkeit vom Beschlussgegenständ bereits seit SG II gelte.18
Die vorliegenden Vertragsklauseln legte der BGH im Rahmen subjektiver Auslegung nach allgemeinen Auslegungsgrundsätzen aus.19 Die Generalklausel § 6 Absatz 5 GV ersetzte danach das Einstimmigkeitsprinzip durch die einfache Mehrheitskompetenz überall dort, wo weder Gesetz noch GV vorrangig etwas anderes bestimmten. Da das Gesetz keine Quoren für die Zustimmung zur Abtretung von KG-Anteilen vorsieht gelte die Mehrheitskompetenz, sofern der GV nicht abweichend regelte. Der vorliegende GV nannte explizit Beschlüsse, welche der Einstimmigkeit bedurften. Der BGH legte den GV daher so aus, dass durch das Auslassen eines Quorums in § 10 Absatz 1 GV keine Abweichung von der einfachen Mehrheitskompetenz gegeben sei.20 § 10 Absatz 1 GV hätte also ausdrücklich nennen müssen, dass in diesem Fall Einstimmigkeit gelten soll. Die Auffassung des Klägers, dass hingegen Einstimmigkeit gelten müsse, da die Abtretung redaktionelle Vertragsänderungen i. s. d. § 6 Absatz 6 GV mit sich brächte lehnte der BGH ab. Er begründete dies damit, dass die Klausel sich auf den BeSchluss selbst beziehe, nicht aber auf die Vertragsänderung als Folge einer Anteilsübertragung.21 Die Beschlüsse wurden in der Folge formell legitimiert.
Der Betroffene hätte jedoch bei einer Abtretung des Gesellschaftsanteils einwilligen müssen. Die antizipierte Zustimmung sei im vorliegenden Fall trotz der Gegenstimme des Klägers gegeben. Dies begründete der BGH damit, dass es genüge das sich der Betroffene mit seinem Sonderrecht unter den Mehrheitswillen des § 6 Absatz 5 GV gestellt hat.22 Des weiteren erklärte der BGH im Rahmen der Prüfung der materiellen Legitimation die Kernbereichslehre als Instrument der Beschlussprüfung für nicht mehr relevant. Die Kernbereichslehre wurde mit NJW, 2015, 859 abgeschafft.23 statt- dessen führt der BGH nun eine ״geboten-zumutbar“-Prüfung24 durch. Auf diese ist im weiteren Verlauf der Arbeit noch an anderer stelle zurück zukommen. Da der BGH weiterhin keine materiellen Unwirksamkeitsgründe feststellen konnte, erklärte er die Beschlüsse für formell wie materiell wirk- sam.25 Ob für den Kläger jedoch eine Pflicht zur Abtretung besteht, ist für diese Arbeit nicht von Belang und ohnehin noch in einem anderen Verfahren zu klären.26
II. Das gegenwärtige Kontrollsystem im Vergleich zum einstigen Rechtsstand
Durch die drei vorgenannten Grundsatzentscheidungen schaffte der BGH sein altes Prüfsystem ab. Er führte an dessen stelle schrittweise ein neues System ein. Diese beiden Systeme sollen nun dargestellt werden, um einen anschließenden Vergleich zu ermöglichen. Das vormalige System wird Anhand seines Werdegangs dargestellt, um so dessen Verständnis in seiner gegenwärtigen Fassung besser nachvollziehen zu können.
1. Der Werdegang des vormaligen Kontrollsystems
Bis zur Otto-Entscheidung erfolgte die Kontrolle von Mehrheitsbeschlüssen in Personengesellschaften noch nach einem anderen System. Dieses setzte sich unter Anderem aus der restriktiven Auslegung durch den Bestimmtheitsgrundsatz, sowie den Schranken der Kernbereichslehre zusammen. Aufgrund der Abkehr von Bestimmtheitsgrundsatz und Kernbereichslehre durch den BGH sollen diese zunächst dargestellt werden, um die Tragweite jener Abkehr besser erfassen zu können.
a) Der Bestimmtheitsgrundsatz bis zur Otto-Entscheidung
Der Bestimmtheitsgrundsatz geht auf die Rechtsprechung des Reichsgerichtes zurück.27 Dieses nannte ihn nicht namentlich, stellte jedoch ein Konzept auf, welches vom BGH mit Urteil vom 12.11.1952 unverändert wieder aufgenommen wurde.28 Diese Entscheidung des BGH hatte die Zulässigkeit eines Mehrheitsbeschlusses zum Gegenstand. Durch diesen sollte eine sich in der Abwicklung befindliche KG wieder in eine werbende Gesellschaft umgewandelt werden. Die Mehrheitskompetenz sollte sich aus einer Klausel ergeben, nach welcher Vertragsänderungen mit % Mehrheit zu beschließen seien. Die Klausel hielt der Prüfung des BGH nicht stand. Sie scheiterte an dem nötigen Grad der Bestimmtheit, welchen der BGH aus dem Beschlussinhalt der KG herleitete. So unterschied der BGH zwischen gewöhnlichen Geschäften, ungewöhnlichen Geschäften und Grundlagen- geschäften.29 Eine Vertragsänderung stellte laut Leitsatz ein ungewöhnliches Geschäft dar. Im Hinblick darauf war die allgemein gehaltene Klausel der KG nicht bestimmt genug. Daraus folgte, dass gewöhnliche Geschäfte durchaus von allgemeinen Mehrheitsklauseln erfasst wurden.30 Der BGH zog eine ״ungewöhnlichkeits Grenze“31 anhand welcher er den individuellen Bestimmtheitsgrad festsetzte.32 Sofern eine Klausel einen MehrheitsbeSchluss über ein nicht gewöhnliches Geschäft vorsah, verlangte der BGH das sich aus dem Gesellschaftsvertrag zweifelsfrei die für den Einzelfall in Betracht kommende Maßregel ergibt.33 Er stellte zudem bereits im selbigen Urteil klar, dass es in jedem Fall keiner ausdrücklichen Auflistung der Beschlussgegenstände bedarf, sondern der Grad der Bestimmtheit viel mehr auch durch Auslegung ermittelbar sei.34 Der Bestimmtheitsgrundsatz wurde hier noch auf die Zulässigkeit des Beschlusses angewandt. Es muss jedoch zwischen der Auslegung von Mehrheitsklauseln in Gesellschaftsverträgen von Personenhandelsgesellschaften gegenüber den allgemeinen Auslegungsgrundsätzen unterschieden werden, da der Bestimmtheitsgrundsatz eine Maßgabe zur restriktiven Auslegung ist.35 Daher wurde dem Bestimmtheitsgrundsatz mit der Zeit eine verdeckte materielle Beschlusskontrolle durch diese restriktive Auslegung vorgeworfen.36 Diese restriktive Auslegung zuzüglich des Erfordernisses der sogenannten Zweifelsfreiheit nötigten die Praxis zur Anfertigung von Beschlusskatalogen.37
Zweck des Bestimmheitsgrundsatzes war der Schutz der Minderheit vor den Folgen der unbedachten Unterwerfung unter eine Mehrheitsmacht, durch ein intransparentes Vertragswerk.38 So sollte den Gesellschaftern die Möglichkeit gegeben werden mögliche Folgen ihrer Unterwerfung bereits im Vorhinein zu erfassen.39 Dem Bestimmtheitsgrundsatz kam daher auch eine Warnfunktion zu.40 Der Bestimmtheitsgrundsatz in seiner ursprünglichen Form forderte zwar nicht explizit Kataloge, ließ diese jedoch aufgrund seiner engen Zulässigkeitsvoraussetzungen als letztes zuverlässiges Instrument zurück.41 Durch die üblicherweise äußerst umfangreichen Kataloge konnte die angedachte Warnfunktion nicht zur Geltung kommen und es fand folglich eine Umgehung des Bestimmtheitsgrundsatzes statt.42 Im Zusammenhang mit der verdeckten Inhaltskontrolle war der Bestimmtheitsgrundsatz somit nicht unumstritten.43
b) Die Kernbereichslehre bis Otto
Mit seiner Grundsatzentscheidung BGHZ 20, 363 begann der BGH im Jahre 1956 den Kern der Mitgliedschaft durch die Unverzichtbarkeitserklärung des Stimmrechts zu eröffnen.44 Ein Kommanditist hatte zuvor im Wege einer Stimmrechtsvollmacht sein Stimmrecht auf einen von zwei Komplementären übertragen, widerrief diesen Akt jedoch. Der Beklagte hielt diesen Widerruf für unwirksam, sodass er auch weiterhin berechtigt sei das stimmrecht des Klägers auszuüben.
Jenen Fall entschied der BGH noch dahingehend, dass dem Stimmrechtslosen Gesellschafter trotz Stimmrechtsausschluss das Recht zustünde mit zustimmen.45 Dieses Recht begründete er damit, dass die GesellschafterVersammlung durch Beschluss die Pflichten eines Gesellschafters erhöhen kann, sofern der Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt wird.46 Ein stimmrecht im Sinne eines Vetorechts des Betroffenen erkannte der BGH hier noch nicht, sodass nur ein zwingendes Stimmrecht geschaffen wurde.47 Ein einzelner Gesellschafter konnte also bei begründeter Mehrheitskompetenz einen Eingriff in seine Sonderrechte nicht verhindern, sofern er nicht die nötige Stimmmehrheit hatte. Dies veränderte die Rechtsprechung später zu einem Vetorecht, sodass ein Gesellschafter alleine einen Eingriff mittels ZuStimmungsverweigerung verhindern konnte. Von diesem auf Stimmrechtsausschlüsse begrenzten Modell wurde der Kernbereich sodann fortgebildet.
So wurde im Rahmen der Kernbereichslehre zunächst zwischen unverzichtbaren und unentziehbaren Rechten der Mitgliedschaft unterschieden. Unverzichtbare Rechte waren nicht entziehbar, selbst wenn der Betroffene diesem Entzug zugestimmt hatte.48 Sogenannte unentziehbare Rechte waren hingegen aus wichtigem Grund entziehbar (§§ 117, 127 HGB), oder nur wenn der Betroffene dem zugestimmt hatte.49 Die Zustimmung konnte auch bereits vor dem jeweiligen Beschluss abgegeben werden. Es handelte sich dabei um die sogenannte antizipierte Zustimmung. Sie konnte durch Eingehen des Gesellschaftsvertrages abgeben werden.50 In diesem Fall war eine Klausel vorhanden, welche eine qualifizierte Mehrheit für einen Eingriff in
ein Sonderrecht vorsah. Für derartige Klauseln galt jedoch ein vom Bestimmtheitsgrundsatz unabhängiges Bestimmtheitserfordernis.51 Dies bedeutete, dass je nach Eingriffsermächtigung in ein Kernrecht andere Bestimmtheitserfordernisse auf der materiellen Ebene nötig waren als auf for- melier Ebene. Die Zustimmung an sich stellte ein eigenes Rechtsgeschäft i.s.d. § 182 BGB dar.52 Ein Beschluss der einer Zustimmung entbehrte, durch welchen jedoch in ein Sonderrecht eingegriffen würde, war schwebend unwirksam.53
Der Kernbereich wurde zwar vom BGH als die individuellen, dem Gesellschafter nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag zustehenden wesentlichen Gesellschafterrechte definiert, welche seine Stellung in der Gesellschaft maßgeblich prägen.54 Der Kreis dieser Rechte war jedoch trotz dieser Definition zu keinem Zeitpunkt abschließend festgelegt und in der Folge in seinem sicheren Bestand fraglich.55 Mit Sicherheit zum Kernbereich gehörten jedoch das Stimmrecht, Geschäftsführungsrecht, Gewinnrecht, Informationsrecht und das Recht auf Beteiligung am Liquidationserlös.56
Der Schutz der Kernbereichslehre kam bei einem Eingriff in vorgenannte Rechte zur Geltung. Zwischen unmittelbaren und mittelbaren Eingriffen wurde unterschieden.57 Mittelbare Eingriffe lösten nur in Ausnahmefällen den Kernbereichsschutz aus, hingegen der unmittelbare Eingriff im Zuge der Fortbildung der Kernbereichslehre immer das Vetorecht des Betroffenen begründete.58 Der Eingriff musste alternativlos sein. Dies bedeutet, dass der Mehrheit keine anderen, den Minderheitsgesellschafter weniger belastenden Mittel zur Wahrung des zu schützenden Gesellschaftsinteresses zur Verfügung stehen durften.59 In seiner Inhaltsprüfung entkoppelte der BGH die Kernbereichslehre vom Bestimmtheitsgrundsatz, sodass diese als unabhängige Schranke einer Mehrheitsklausel bezeichnet werden kann.60 Allerdings wurde wie bereits dargelegt, der Bestimmtheitsgrundsatz auch zur verdeckten Inhaltskontrolle genutzt. Da jedoch keine funktionale Abhängigkeit zwischen Kernbereichslehre und Bestimmtheitsgrundsatz bestand, kann trotz dieser Vermischung von einer jeweiligen Unabhängigkeit ausgegangen werden.
Die Kernbereichslehre entwickelte sich bis zur Otto-Entscheidung neben dem Bestimmheitsgrundsatz als weitere Inhaltsschranke von MehrheitsbeSchlüssen. Die Kernbereichsrechte waren nicht abschließend und für jede Gesellschaft bestimmt, denn ihre Existenz wurde teilweise von der Struktur der Personengesellschaft abhängig gemacht.61 Daneben existierte im späteren Verlauf der Rechtsfortbildung ein fixer, anerkannter und nicht abschließender Kreis an Kernrechten.62 Aufgrund genannter Tatsache, dass die Anforderungen zur Legitimation eines Eingriffs in den Kernbereich stark vom Einzelfall abhingen, waren diese Einzelfälle kautelarjuristisch schwer erfassbar. Selbst wenn eine antizipierte Zustimmung des Betroffenen vorlag, musste mit einer Anfechtung dieser gerechnet werden. Hinzukam, dass selbst wenn jene Voraussetzungen erfüllt waren, es ständiger Rechtsprechung entsprach das der Eingriff im Interesse der Gesellschaft geboten und dem Gesellschafter unter Berücksichtigung seiner schutzwerten Belange zumutbar sein musste.63 Die Folge war, dass selbst eine antizipierte ZuStimmung keine abschließende Sicherheit bieten konnte, sofern in ein Kernrecht außerhalb des fixen Kernbereichs eingegriffen werden sollte.
c) Zusammenfassung der Kontrollmechanismen
Bis zur Einführung des 2-Stufensystems in Otto wendete der BGH ein Prüfsystem an, welches sich aus Bestimmtheitsgrundsatz, Kernbereichslehre, Belastungsverbot und Treuepflicht zusammensetzte. Je nach Beschlussinhalt wurde eine unterschiedliche Bestimmtheit der Klausel gefordert. Die Differenzierung in gewöhnliche, ungewöhnliche, sowie Grundlagengeschäfte ließ lediglich bei gewöhnlichen Geschäften eine Generalklausel zu. Weiterhin wird bei unmittelbaren Eingriffen in unentziehbare Kernrechte, oder bei nachträglichen Beitragserhöhungen eine gesonderte Bestimmtheit der antizipierten Zustimmung gefordert. Dies konnte zu einem Rückfall auf das Einstimmigkeitsgebot führen. Allerdings konnte ein solcher Rückfall ebenso durch den Bestimmtheitsgrundsatz erfolgen wie durch die Kernbereichsieh- re, im ersteren Fall entsprang jenes Einstimmigkeitsgebot jedoch dem Gesetz (§ 709 I BGB, § 119 I HGB). Dem entgegen entsprang das Einstimmigkeitsgebot der Kernbereichslehre aus dem Konstrukt ״Kernbereich“ selbst. Die Rechtsfolgenseite gestaltete sich bei formellen und materiellen Mangeln daher immer gleich. Die zu beantwortende Frage war lediglich, woraus sich das Erfordernis der Einstimmigkeit ergab. Selbst bei vorliegen aller vorgenannten Bedingungen konnte der Mehrheitsbeschluss aus dem Grund der Treuwidrigkeit materiell nicht legitimiert sein. Die Gesellschafter waren schließlich bei der Stimmabgabe dazu verpflichtet auf die Interessen, sowohl der Gesellschaft als auch der Minderheitsgesellschafter Rücksicht zu nehmen.64 Ein unverhältnismäßiger Eingriff entgegen solcher Interessen führte in der Folge zu einem illegitimen Beschluss.65 Wohlgemerkt definierte der BGH, ob ein Eingriff der Treuepflicht entsprach, anhand der Formel: ״Im Interesse der Gesellschaft und dem Gesellschafter unter Beachtung seiner schutzwerten Belange zumutbar.66 Ob jedoch TreuepflichtWidrigkeit vorlag, musste stets die Seite beweisen, welche diesen Vorwurf erhob. Dies folgte aus den allgemeinen Verfahrensregeln.
2. Errichtung des neuen Kontrollsystems
Der Systemwechsel beginnt trotz diverser tendenziöser Urteile aus der Mitte der 90er erst 2007 mit der Otto Entscheidung.67 Somit hatte sich zwar eine Art der Zweistufig keit im Prüfsystem schon vorher angedeutet. Doch erst in Otto begann der BGH diese Elemente namentlich zu übernehmen. Der BGH stellt zunächst in Otto ausdrücklich fest, dass der Bestimmtheitsgrundsatz und die sog. ״Kernbereichslehre“ weiterhin Bestand haben und Teil des Minderheitenschutzes bleiben.68 Zwar gelte weiterhin die Anforderung, dass eine Mehrheitsklausel Ausmaß und Umfang der Unterwerfung unter eine Mehrheit erkennen lassen müsse. Doch sei das Verständnis des
Erfordernisses einer minutiösen Auflistung verfehlt.69 Denn das dem so ist wurde bereits bei der Wiederaufnahme des Bestimmtheitsgrundsatzes fest- gelegt.70 Auch unterscheidet der BGH weiterhin zwischen verschiedenen Bestimmtheitserfordernissen bei gewöhnlichen und ungewöhnlichen Geschäften, sowie bei Grundlagengeschäften. Das Urteil ist bis hierhin also eine reine Klarstellung.
Neu ist hingegen das Verständnis jener Bestimmtheit. So formuliert der BGH: ״Es genügt vielmehr, wenn sich aus dem Gesellschaftsvertrag - sei es auch durch dessen Auslegung - eindeutig ergibt, dass der in Frage stehende Beschlussgegenstand einer Mehrheitsentscheidung unterworfen sein soll“.71 '' Das sich eine Unterwerfung unter eine Mehrheit auch durch Auslegung ergeben kann, dient hier ebenso nur der Klarstellung. Das neue Element ist die Aufweichung der Bestimmtheit selbst. Der Bestimmtheitsgrundsatz als restriktive Auslegungsregel hat zwar weiterhin Bestand, jedoch unter der Maßgabe einer weniger verengten Auslegung.72 Missverständlich war hier jedoch die Wortwahl, da der BGH eine eindeutige73 Generalklausel verlangt, sofern von Katalogen abgesehen wird. Eine Generalklausel zeichnet sich schließlich durch das allgemeine Erfassen diverser Tatbestände aus, ohne dass sie diese explizit nennt. Wie das Erfordernis jener Eindeutigkeit zu verstehen ist, stellt der BGH erst in NJW 2015, 859 zweifelsfrei klar.
Eine weitere, nun offizielle, Neuerung ist die Einführung einer zweistufigen Prüfung von Beschlüssen. Diese wurde zwar schon im Rahmen des alten Systems praktiziert, ist im Otto-Urteil allerdings erstmals konkret als solches Prüfungsschema benannt.74 So setzte sich die erste stufe in Otto, als formelle Legitimation des Beschlusses, aus einer Prüfung der Tatbestandsmerkmale der Mehrheitsklausel und aus dem Bestimmtheitsgrundsatz zusammen. Die zweite stufe als materielle Legitimation des Beschlusses ist im Anschluss eine Inhaltsprüfung jenes Beschlusses. Diese Inhaltsprüfung setzte sich noch aus den Regeln der Kernbereichslehre, des BelastungsVerbotes und der Treuepflicht zusammen.75 Im Rahmen dieser 2-Stufenprü- fung benennt der BGH zugleich einige Termini der Kernbereichslehre um. So heißen unentziehbare Rechte nun relativ unentziehbare Rechte und unverzichtbare Rechte nun schlechthin unverzichtbare Rechte.76 Unter dem Aspekt der Beibehaltung der Kernbereichslehre im Otto-Urteil ist ein konkreter Grund hierfür nicht ersichtlich.
Eine weitere Veränderung der vormaligen Rechtslage ist die durch Otto eingeführte Umkehr der Beweislast. So hatte im alten System die Partei, welche den Vorwurf der Treuwidrigkeit erhob, diesen auch zu beweisen. Dies entsprach der allgemeinen Regel, dass ein Anspruchssteller auch jenen Anspruch zu beweisen hat. Allerdings führt der BGH in Otto nun aus, dass die Minderheit immer beweisen muss, dass ein Beschluss gegen die TreuePflicht verstößt.77 Erst Jahre später in NJW 859 spezifiziert der BGH diese generelle Beweispflicht dahin, dass sofern ein Eingriff in relativ oder absolut unentziehbare Rechte vorliegt eine Treuepflichtverletzung der Mehrheit unterstellt wird. Diese Vermutung ist dann von der Gesellschaftermehrheit zu widerlegen.78 Die Beweislast der Minderheit wurde somit etwas abgemildert. Es sei jedoch bemerkt, dass der BGH die Existenz des genannten Rechtskreises offen gelassen hat, sodass die Gewichtung der nachträglichen Änderung der neuen Beweislast ebenso offen ist. Zudem reduzierte der BGH die vor Otto noch geltende Beweispflicht des Anspruchstellers auf den Grad einer Obliegenheit.79
Im weiteren Verlauf der Schaffung eines neuen Prüfsystems erklärte der BGH im späteren Urteil SG II, dass dem Bestimmtheitsgrundsatz keine Bedeutung mehr zukommt. Der Bestimmtheitsgrundsatz wird also fast zwei Jahre nach seiner offenkundigen Aufweichung gänzlich obsolet. Die AbSchaffung des Bestimmtheitsgrundsatzes durch SG II war jedoch nicht unzweifelhaft klar. Problematisch ist hier nämlich, dass dies nicht ausdrücklich aus dem Text des Urteils hervorgeht. Zwar fand sich der Bestimmtheits- grundsatz nur noch in Anführungszeichen, jedoch stellte der BGH rein wört- lieh lediglich auf den früher verstandene^] "Bestimmtheitsgrundsatz" ab.80 Daher wurde der Bestimmtheitsgrundsatz noch längere Zeit nach SG II für anwendbar gehalten. So wandte unter anderem die Vorinstanz des NJW 2015 859, das OLG Hamm, den Bestimmtheitsgrundsatz in Az. 8U 21/12 noch immer an. Eine Bestätigung der tatsächlichen Abkehr vom Bestimmtheitsgrundsatz in SG II konnte im Ergebnis selbst gesehen werden. So haben die Beschlüsse der GbR ungewöhnliche Geschäfte zum Inhalt, welche eigentlich nicht von einer Generalklausel erfasst würden. Der BGH nimmt diese jedoch entgegen seiner früheren ständigen Rechtsprechung aus der Reichweite des Bestimmtheitsgrundsatzes.81 Dies kann als Abkehr zu verstehen sein. Andere Auffassungen des Urteils gehen hierbei jedoch vom Erhalt des Bestimmtheitsgrundsatzes in SG II aus. Dabei unter der Maßgabe, dass das Kriterium der Ungewöhnlichkeit aufgehoben sei und so nun eine Generalklausel alle drei Geschäftstypen erfasse.82 Endgültige Sicherheit, dass der Bestimmtheitsgrundsatz in SG II gänzlich aufgegeben wurde, ist einem Verweis in einem BGH Urteil von 2012 zu entnehmen.83 In diesem Urteil verweist der BGH auf Randnummer 15 der SG Il-Entscheidung mit dem Wortlaut: ״Diese Entscheidung beruhte auf der Anwendbarkeit des so genannten Bestimmtheitsgrundsatzes, dem, wie ausgeführt, für die formelle Legitimation einer Mehrheitsentscheidung nach der neueren Rechtsprechung des Senats [Verweis auf SG II Rn. 15] keine Bedeutung mehr zukommt.“. Eine Ausweitung der Ungewöhnlichkeitsgrenze84 unter Erhalt des Bestimmtheitsgrundsatzes ist aus diesem Grund zu verneinen. Der BGH hatte nach heutiger Beweislage den Bestimmtheitsgrundsatz bereits in SG II abgeschafft.
Wie die Prüfung der 1. stufe seit SG II nun ohne Bestimmtheitsgrundsatz auszusehen hatte teilte der BGH ausdrücklich erst in NJW 2015, 859 mit. So wird bereits seit SG II eine umstrittene Klausel nach allgemeinen Ausie- gungsgrundsätzen ausgelegt.85 Die restriktive Auslegung von Mehrheitsklausein beugte sich also der allgemeinen Auslegung. Seit SG II gilt somit mittels der allgemeinen Auslegungsregeln nun auch, dass sich die formelle Legitimation aus konkludenten Vereinbarungen ergeben kann.86 Dies ist jedoch ebenfalls nicht ausdrücklich in SG II genannt und folgt daher aus jener Klarstellung in NJW 2015, 859, welche bereits ausgeführt wurde.
Weiterhin wurde die 1. stufe durch SG II dahingehend reformiert, dass es nun keine verschiedenen Bestimmheitsgrade mehr gibt. Das Bestimmheits- erfordernis einer Klausel ist damit unabhängig vom Beschlussgegenstand. Somit ist die formelle Legitimation für Generalklauseln aller Geschäftstypen grundsätzlich möglich.87 Das Generalklauseln zur Begründung einer Mehrheitskompetenz auch materiell wirksam sind bestätigt das SG II Urteil an späterer stelle.88 Dies wurde anschließend in NJW 2015, 859 damit begründet, dass das Einstimmigkeitsprinzip der §§ 709 I BGB, 119 1 HGB die Einstimmigkeit für alle Geschäfte vorsehe und umgekehrt die Disposition ebenso für alle Geschäfte gelten müsse.89 So sei hierbei Voraussetzung, dass die Auslegung des GV auch jenen Beschlussgegenstand, welcher der Mehrheit unterworfen werden soll, erkennen lässt.90 Jene Auslegung wird nun auch als subjektive Auslegung benannt.91 Bei Publikumsgesellschaften ist weiterhin objektiv auszulegen.92 Die Auslegung erfolgt selbstverständlich nur in solchen Fällen, in denen der Vertragstext nicht von vornherein den Willen der Gesellschafter unzweifelhaft erkennen lässt. In jenen Fällen können dann auch außerhalb des Vertragstextes liegende Umstände, sowie die Entstehungsgeschichte der umstrittenen Klausel mit in die Auslegung einbezogen werden.93
Die 2. Stufe erfuhr in SG II eine Klarstellung unter Verweis auf das Otto-Urteil. So ist im Rahmen der materiellen Wirksamkeit eine Treuepflichtverletzung nicht mehr ausschließlich in Fällen der vermuteten Kernbereichsverletzung durchzuführen. Vielmehr erfolgt diese Prüfung nun bei jedem BeSchluss, unabhängig von dessen Gegenstand.94
Den bisherigen Endstand des hier vorstehenden Prozesses in der Rechtsfortbildung des Prüfsystems von Mehrheitsklausel in Personengesellschaften stellt NJW 2015, 859 dar. Der BGH führt eine neue Verfahrensweise auf der 2. stufe ein. So kommt es nun für den BGH nicht mehr darauf an, ob ein Eingriff in den Kernbereich vorliegt. Für die Prüfung hat die Kernbereichslehre keine Bedeutung mehr.95 Der BGH ersetzt die Schranke der Kernbereichslehre durch eine ״neue“ Prüfformel auf der 2. stufe. So kommt es bei der Beschlusskontrolle nun stattdessen darauf an, ob der Eingriff [in die individuelle Rechtsstellung des Gesellschafters] im Interesse der Ge- Seilschaft geboten und dem betroffenen Gesellschafter unter Berücksichtigung seiner eigenen schutzwerten Belange zumutbar ist.96 Diese Prüfung erfolgt ausdrücklich nicht im Bezug auf unverzichtbare Rechte, deren Bestehen der BGH offen ließ.97 Somit bleiben Eingriffe in unverzichtbare Rechte bei Anerkennung ihres Bestehens unmöglich.98 Doch lässt der BGH die Existenz solcher Rechte wie bereits festgestellt offen. Er bemerkt zusätzlich, dass selbst bei Existenz solcher Rechte deren Umfang doch fraglieh ist.99
Mit der Aufgabe der Kernbereichslehre erübrigt sich folglich auch die Prüfung auf das Vorliegen einer antizipierten Zustimmung.100 Weiterhin sind in der Folge nun nicht mehr die individuellen Bestimmtheitserfordernisse von Kernrechten zu berücksichtigen.101 Eine Ausnahme bilden hier die Anforderungen an Klauseln, welche eine nachträgliche Beitragserhöhung vorsehen. So bedarf es bei diesen zwar ebenso einer antizipierten Zustimmung. Doch weil das Erfordernis jener Zustimmung nicht aus der Kernbereichslehre sondern aus § 707 BGB folgt, hat dieses Erfordernis weiterhin Be- stand.102 Aufgrund der Tatsache, dass es weiterhin einer antizipierten ZuStimmung bei Beitragserhöhungen bedarf, gilt auch weiterhin ein gesondertes Bestimmheitserfordernis für solche Klauseln. So ist die antizipierte ZuStimmung zur Beitragserhöhung nur wirksam, wenn eine Obergrenze in der Klausel, bzw. die Begrenzbarkeit für den Gesellschafter in Ausmaß und Umfang erfassbar wiedergegeben werden.103
Es bleibt festzuhalten, dass am Ende der Rechtsfortbildung der Beschlusskontrolle durch den BGH der Bestimmtheitsgrundsatz wie auch die Kernbereichslehre aufgegeben wurden. Vielmehr erfolgt nun eine zweistufige Prüfung auf formelle und materielle Legitimation. Die formelle Legitimation setzt keine konkreten Bestimmtheitserfordernisse an Klauseln und kann sich im Wege allgemeiner Auslegungsgrundsätze konkludent oder ausdrücklich ergeben. Eine Ausnahme bilden hier Klauseln zur nachträglichen Beitragserhöhung. Die allgemeine Auslegung erstreckt sich auf jede Art von Geschäften. Die materielle Legitimation setzt voraus, dass ein Eingriff in die individuelle Rechtsstellung eines Gesellschafters im Interesse der Gesellschaft geboten und jenem Gesellschafter auch zumutbar ist. Weiterhin muss der Eingriff alternativlos sein und darf nicht treupflichtwidrig erfol- gen.104 Daraus folgt, dass das Interesse der Gesellschaft mindestens genauso groß sein muss wie das Ausmaß jenes Eingriffs.105 Unverzichtbare Rechte sind nicht durch Mehrheitsbeschluss zu entziehen, wobei der Kreis unverzichtbarer Rechte vom BGH offen gelassen wurde.
3. Analyse rechtsfortbildender Elemente des Systemwechsels
In den drei vorgenannten Grundsatzentscheidungen führt der BGH ein 2- Stufensystem ein, verabschiedet Bestimmtheitsgrundsatz und Kernbereichslehre und legt Gesellschaftsverträge nach allgemeinen Grundsätzen aus. Diese Menge an Eingriffen in vormals bedeutsame Kontrollmechanis- men kommt einem gänzlichen Systemwechsel gleich und ist nicht als feine Justierung eines noch bestehenden Systems zu verstehen. Daher stellt sich die Frage, ob das neue System im Hinblick auf seinen angedachten Zweck der Beschlusskontrolle geeigneter ist als sein Vorgänger. Zur Ermittlung des Grades jener Eignung werden die wesentlichen Veränderungen ihrem vormalige Mechanismus kritisch gegenüberstellt. Die Summe der positiven, bzw. negativen Divergenzen wird sodann Aufschluss über den Wert des neuen Systems geben.
a) Das 2-Stufensystem
Seit Otto prüft der BGH einen Beschluss namentlich auf 2 stufen. Ob dies jedoch eine tatsächliche Neuerung darstellt, soll im Folgenden erörtert werden. So wurde der Bestimmtheitsgrundsatz nicht als Prüfung einer formellen Legitimation konzipiert, sondern sollte zunächst generell Gesellschafterminderheiten schützen. Die durch ihn geforderte Bestimmtheit sollte ursprünglich eine Warnfunktion übernehmen und weiterhin zu einer formellen Kontrolle beitragen.106 Die Lösung von einer verdeckten Inhaltskontrolle durch eine restriktive Auslegung geschah bereits durch die Theorie von Karsten Schmidt, welche den Bestimmtheitsgrundsatz auf eine Prüfung der formellen Mehrheitsermächtigung reduzierte. Weiterhin würde erst eine materielle Prüfung im Rahmen der Kernbereichslehre, der Treuepflicht und der Gleichbehandlungsgrundsatzes durchgeführt.107 Diese Theorie wurde weitestgehend in der Literatur angenommen.108 Eine erste tendenzielle Bestätigung, dass der BGH zu einer Trennung von Bestimmtheitsgrundsatz als formeller Prüfung und Kernbereichslehre als materieller Prüfung i.s. K. Schmidts Theorie tendierte wurde bereits in einem Urteil des BGH von 1994 deutlich.109 Eine Bestätigung der Tendenz zur zweistufigen Prüfung stellt ein weiteres Urteil des BGH von 1996 dar.110 In jenen beiden Entscheidungen unterließ der BGH lediglich eine konkrete Benennung als Zweistufenprüfung. Das Durchführen einer namentlichen zweistufigen Prüfung in Otto ist folglich mehr eine redaktionelle Neuerung, denn einer inhaltliche. Viel mehr haben sich die Prüfwerkzeuge besagter stufen verändert, sodass nicht die Zweistufugkeit als System, sondern dessen Art der Umsetzung eine Neuerung ist.
b) Das Belastungsverbot im neuen System
Das Belastungsverbot als Teil der Beschlusskontrolle ist weder ein Part der Kernbereichslehre, noch des Bestimmtheitsgrundsatzes.111 Das es für eine Klausel zur Beitragserhöhung somit eines Bestimmtheitserfordernisses bedarf, welches das Ausmaß und den Umfang der zukünftigen Belastung erkennen lassen muss resultiert aus dem Belastungsverbot selbst.112 Eine direkte Beeinflussung durch den Wegfall des Bestimmtheitsgrundsatzes kann daher nicht gegeben sein.113 Die restriktive Auslegung ist somit von den allgemeinen Auslegungsgrundsätzen verdrängt worden. Folglich stellt sich die Frage, ob die Eingangsvoraussetzungen für Klauseln zur Beitragserhöhung erleichtert worden sind. Der BGH sieht die Prüfung der Eindeutigkeit der Klausel zur Beitragserhöhung, also ob diese Ausmaß und Umfang erkennen lässt, nicht als formelle Teilprüfung.114 Stattdessen wird besagtes Bestimmtheitserfordernis weiterhin als individuelle Voraussetzung der antizipierten Zustimmung zur Erhöhung der Beiträge verstanden, welches jedoch nicht rein formeller Natur ist.115 Es findet keine Prüfung auf Ebenen statt, sondern eine eigenständige Prüfart auf einen individuellen Beschlussman- gel.116 So führt das Fehlen einer Zustimmung zu einem nur gegenüber dem nicht zustimmenden Gesellschafter wirkenden Beschlussmangel.117 Da das wirksame Bestehen einer antizipierten Zustimmung einzig auf einer Ebene erfolgt, kann bei der Prüfung des Belastungsverbotes nicht von einer zweistufigen Prüfung gesprochen werden. Die Schaffung einer 2. Prüfungsebene durch den NJW 2014, 859 ist somit nicht gegeben. In der Hinsicht der Zweistufigkeit hat sich daher auch hier im Vergleich zum alten System nichts geändert. Eine Veränderung der Rechtsfolgen einer unwirksamen individuellen Zustimmung zur Beitragserhöhung liegt ebenso wenig vor. Mangels Abweichungen des neuen Systems im Bezug auf nachträgliche Beitragserhöhungen erübrigt sich eine weitere Diskussion der relativen UnWirksamkeit von Beschlüssen zur Beitragserhöhung.
c) Umgestaltung der Auslegung von Mehrheitsklauseln
Die erste stufe ist namentlich weiterhin eine Prüfung der formellen Legitimation. Allerdings erfolgt diese nun nicht mehr durch den Bestimmtheitsgrundsatz. Stattdessen ist durch die allgemeinen Auslegungsregeln der §§ 133, 157 BGB zu ermitteln, ob die Klausel auf derer sich der Beschluss stützt auch im individuellen Fall eine Mehrheitskompetenz vorsieht. Sämtliche Gesellschaftsformen des Personengesellschaftsrechts werden mit Ausnähme der Publikumsgesellschaft weiterhin subjektiv ausgelegt. Die Publi- kumsgsellschaft unterliegt weiterhin der objektiven Auslegung.118 In dieser Hinsicht hat sich folglich nichts geändert.
aa) Auswirkungen der Abkehr von restriktiver Auslegung
Durch die restriktive Auslegung des Bestimmtheitsgrundsatzes wurden Mehrheitsklausel vor diverse Anforderungen gestellt. So mussten sie je nach Geschäftstypus ein unterschiedliches Maß an Bestimmtheit aufweisen. Allgemeine Mehrheitsklauseln waren für ungewöhnliche Geschäfte wie auch Grundlagengeschäfte unzulässig.119 Im alten System waren die Absätze des § 709 BGB, sowie des § 119 HGB nach Sicht des BGH nicht gleich- rangig.120 So schlossen § 709 I BGB und § 119 I HGB mit dem Einstimmigkeitsgebot sämtliche Geschäftsführungsmaßnahmen ein.121 Die Absätze II beider Paragraphen, welche vorsehen das auch die Mehrheit der Stimmern entscheiden kann, galten für den BGH wie bereits dargestellt nicht für alle Geschäftstypen. Diese Ungleichbehandlung der Absätze folgt daher nicht aus dem Gesetzestext, sondern nach der Doktrin des BGH.122 Nun hat der BGH allerdings sein Verständnis der §§ 709 BGB und 119 HGB geändert und entnimmt dem Gesetzestext, dass die Disposition der Absätze zu II ebenfalls für alle Geschäfte gelte.123 In der Folge dieser Wertungsänderung, fällt ein Beschlussgegenstand bei mangelhafter Formulierung daher nicht mehr auf Einstimmigkeit sondern auf die einfache Mehrheit zurück, sofern eine qualifizierte Mehrheitsklausel zu ungenau ist. Durch die Gleichschaltung der Absätze i. V. m. der allgemeinen Auslegung, gleich ob subjektiv oder objektiv, sind Generalklauseln nun auf alle drei Geschäftstypen erstreckt. Weiterhin kann sich eine Mehrheitskompetenz aus jeder übereinkunft, also aus jedem übereinstimmend erklärten Willen, sowohl konkludent als auch ausdrücklich, ergeben.124 Da sich die Mehrheitskompetenz nach allgemeinen Auslegungsregeln ergibt, gilt für die formelle Legitimation ein weitaus geringeres Risiko der Reduzierung auf Einstimmigkeit. Die Ausweitung des Bestimmtheitsgrundsatzes auf eine verdeckte Inhaltskontrolle ist in der Folge auch abgeschafft.125 Die materielle Legitimationsprüfung ist daher von formalen Prüfaspekten bereinigt. Mit dem neuen System liegt im Hinblick auf die formelle Legitimation eine geringere Schranke für Mehrheitskompetenzen vor als noch im alten System. In der Folge sind Minderheiten im alten System auf der 1. stufe stärker geschützt gewesen.
Generalklauseln galten nur für gewöhnliche Geschäfte. Hinzukam das Kataloge restriktiv ausgelegt wurden. Klauselkataloge waren daher immer abschließend. Sofern ein Katalog in der Formulierung lückenhaft war bestand nicht das Risiko ungewollter Mehrheitskompetenz durch Ausdehnung des Katalogs. Jedoch entbehrten die Kataloge der durch den Bestimmtheitsgrundsatz angedachten Warnfunktion.126 Weiterhin schützte dann zwar die restriktive Auslegung vor unbedachter Unterwerfung unter eine Mehrheit, ließ jedoch Mehrheitsbeschlüsse scheitern, selbst wenn diese im Interesse der Gesellschaft geboten waren.127 Dem gegenüber steht die allgemeine Auslegung. Das Erreichen der formellen Beschlusslegitimation ist dahingehend vereinfacht. Die Möglichkeit konkludent eine Mehrheitskompetenz zu begründen erhöht den Grad jener Vereinfachung. Damit ein Beschlussgegenstand konkludent in den Vertrag einfließt, muss die Auslegung des Gerichts dies ergeben. Eine Auslegung erfolgt zunächst, wenn der Wortlaut nicht eindeutig ist.128 In diesem Fall können im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung auch ein Umstand, die Entstehungsgeschichte oder sonst¡- ge konkludente Willenserklärungen Einzug in den Vertrag finden.129 Da diese Auslegungsform Vorrang vor dem Gesetz hat, ist die Verdrängung der Mehrheit durch das Einstimmigkeitsprinzip auch bei lückenhaften Verträgen von der Auslegung abhängig.130 Jene Auslegung erfolgt anhand einer Anhörung der Parteien, sowie unter Heranziehung der vorliegenden Tatsa- chen.131 Allerdings sind außerhalb eines Textes liegende Tatsachen schwer zu beweisen und divergierende Aussagen zerstrittener Parteien nur allzu wahrscheinlich. Diese Tatsache schwächt die Gewichtung der Möglichkeit, dass auch konkludent Mehrheitskompetenzen begründet werden können ab. Zudem kann nun eine Vertragslücke i.v.m. einer Generalklausel zu ei- ner formellen Mehrheitskompetenz führen, anstatt wie früher zu einem Einstimmigkeitsgebot. Diese Möglichkeit einer ungewollten Abweichung vom Einstimmigkeitsprinzip ist als Risiko für jeden einzelnen Gesellschafter zu bewerten. In der Summe liegen im neuen System mehr Möglichkeiten vor einen Mehrheitsbeschluss formell zu legitimieren als im alten System. Die Gesellschaftermehrheit kann sich somit als besser gestützt betrachten.
Einstweilen ist festzuhalten, dass mit dem Systemwechsel eine Verschiebung der Schutzintensität auf der 1. stufe vorliegt. Sofern ein Vertragswerk sich auf Generalklauseln beschränkt und keine expliziten Einstimmigkeitserfordernisse vorsieht, ist die Minorität unabhängig vom Beschlussgegenstand der Mehrheit ausgeliefert. Mehrheitsbeschlüsse sind nun durch eine Herabsetzung der Schranken auf der 1. stufe gestärkt und schwerer anzugreifen. Dies verschafft der Gesellschftermehrheit Sicherheit und schützt die Flexibilität der Gesellschaft. Dies geht allerdings zu Lasten des Minderheitenschutzes.
bb) Relevanz der Katalogisierung seit Schutzgemeinschaftsvertrag II
Die Gesellschafter sind bestrebt stets ihren Willen durchzusetzen oder eine Handlung gegen ihre Meinung zu unterbinden. Daraus ergibt sich, dass die Gesellschafter ebenso bestrebt sein werden einer für sie nachteiligen Auslegung in der Rolle der Minderheit zu entgehen. Eine Favorisierung bewahrter Sicherungsinstrumente wie dem Klauselkatalog scheint vor diesem Hintergrund als sehr wahrscheinlich. Zudem bestätigt der BGH in NJW 2015, 859, dass je ausführlicher ein Katalog ist die allgemeine Mehrheitsklausel gestärkt wird.132 Es ergebe sich aus den exakten Regelungen des Katalogs, dass ausschließlich aufgeführte Beschlussgegenstände ein bestimmtes Quorum bedürfen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass dann explizit alle anderen Beschlüsse der einfachen Mehrheit unterworfen sein sollen. Eine Lücke im Katalog wirkt sich somit noch stärker aus. Sofern sich die Gesellschafter also zu einer allgemeinen Mehrheitsklausel entscheiden, werden sie das Vertragswerk nun erst recht von vornherein mit der nötigen Bestimmtheit versehen wollen, um keinen Zweifel an ihrem Willen zuzulassen. Einigen sich die Gesellschafter dann noch auf Kataloge, so werden diese noch genauer sein als zuvor, um so nicht der nachteiligen Auslegung anheim zu fallen. Die Praxis wird also durch das neue System zum Anfertigen extensiver Kataloge motiviert. Ob eine Katalogisierung weiterhin als negativ zu bewerten ist, muss daher hinterfragt werden. Letztlich war es der Bestimmtheitsgrundsatz welcher eine Warnfunktion in das Vertragswerk einfließen lassen sollte. Da dem Bestimmtheitsgrundsatz keine Bedeutung mehr zukommt, ist nach einer neuen Quelle einer Warnfunktion zu suchen. Der GV an sich ist neben einem schuldrechtlichen Vertrag auch ein organisationsrechtlicher Vertrag.133 Vor SG II ist der Bestimmtheitsgrundsatz nicht als weitere Warnfunktion neben einer Warnfunktion des GV definiert worden. Viel eher war es einzig der Bestimmtheitsgrundsatz selbst der den AnSpruch der Warnung an den GV stellte. Der BGH trifft bei der Abschaffung des Bestimmtheitsgrundsatzes für jede dessen Funktionen Ersatzmaßnahmen. Eine Alternative zur Warnfunktion ist jedoch nicht darunter, sodass diese ersatzlos aufgegeben wurde. Das ein Katalog folglich eine Warnfunktion umgeht ist nicht mehr zutreffend, da es keinen Warnanspruch mehr zu umgehen gibt. Durch die Möglichkeit der Generalklausel für alle drei Geschäftstypen, ist die Fähigkeit eines Katalogs zur Warnung neu zu bewerten. Bei einer Generalklausel wäre ein Vertragswerk ohne konkreter Nennungen der Beschlussgegenstände minder geeignet zu Warnen, da es die Unterwerfung unter die Mehrheit der Auslegung anheim stellt. Ein Katalog ermöglicht es dagegen nachzuvollziehen, welche Beschlussgegenstände konkret betroffen sind. Entgegen einer Generalklausel kann der Beschlusskatalog somit den einzelnen Gesellschafter besser informieren. Der Katalog eröffnet durch die verschriftlichte Information zumindest die Möglichkeit der Warnung unabhängig von einem Warnanspruch.
cc) Nebeneffekte der allgemeinen Auslegungsregeln
Die Abkehr von gesellschaftsrechtlichen Sonderregeln bei der Auslegung hin zu allgemeinen Auslegungsgrundsätzen stellt eine Neuerung dar, welche im Hinblick auf die Auslegung an sich in dieser Arbeit noch nicht eingeordnet wurde. Der Gesellschaftsvertrag als Mehrpersonenvertrag wirft für die Auslegung das Problem verschiedenerer von einander abweichender Empfängerhorizonte auf.134 Im Rahmen der natürlichen Auslegung wird zunächst nach dem tatsächlichen Willen jedes Gesellschafters gefragt. Daraus folgt, das eine Klausel von Gesellschafter zu Gesellschafter unterschiedlich ausgelegt werden könnte. Sofern sich diverse subjektive Ausie- gungen des tatsächlich Erklärten ergeben, kommt es auf die Schnittmenge dieser Erklärungen an. Dieser sogenannte ״größter gemeinsame Empfän- gerhorizont“135 stellt die verobjektivierte Sicht des Vertragswerkes dar.136 Es kommt in der Folge auf den tatsächlichen Bedeutungsgehalt des Erklärten, anstatt des Gewollten an.137 Diese objektive Auslegung ist gegenüber der subjektiven Auslegung bei Personengesellschaften nachrangig. Eine Ausnähme bildet hier die Publikumsgesellschaft, bei welcher stets die objektive Auslegung zur Anwendung kommt.138 Im Rahmen der objektiven Auslegung werden Umstände zudem nur dann als wirksam erklärt betrachtet, sofern deren Erklärungsgehalt jedem Kontrahierenden bekannt oder erkennbar war.139 Dies bedeutet für die Auslegung des GV im Rahmen der neuen Rechtsprechung, dass zwar eine Klausel durch außerhalb des Vertrages liegende Umstände legitimiert werden kann. Allerdings wird diese Möglichkeit dadurch beschränkt, dass jener Umstand allen Gesellschaftern erkennbar oder bekannt sein musste, sofern eine Reduzierung auf die objektive Auslegung stattfindet. Der Grad der Vereinfachungen der ersten stufe des neuen Systems wird folglich durch die allgemeinen Auslegungsregeln an sich gehemmt. Zudem folgt aus der sich ergebenen Möglichkeit der erleichterten Mehrheitskompetenz, dass ebenso die Auslegungsregeln selbst einen Motivation für die Praxis sind, Klauselkataloge anzufertigen.
dd) Das neue System im Kontext zwischenmenschlicher Konflikte
Im alten System wurde das schriftlich Fixierte zum Begründen der Mehrheitskompetenz herangezogen. Daneben gab es sonst keine Möglichkeit eine Mehrheitskompetenz zu begründen. Durch das neue System ist dies, wie dargestellt, nicht mehr der Fall. Das Risiko einer ungewollten Mehrheitskompetenz ist durch die Anwendbarkeit allgemeiner Auslegungsregeln höher als im alten System. Diese Tatsache könnte zur Verstärkung zwischenmenschlicher Probleme führen. Personengesellschaften mit ihrer per- sonalistischen Struktur zeichnen sich schließlich durch die persönlichen Beziehungen ihrer Gesellschafter aus.140 Diese persönlichen Verbindungen zusammen mit dem gemeinschaftlichen streben zur Zweckverwirklichung sollen durch die organisationsrechtlichen Aspekte des GV geordnet werden.141 Jedoch verändern sich Interessen und Vorstellungen jener ZweckVerwirklichung mit der Zeit, sodass ein Disput bei der Beschlussfassung als Mittel der Interessensumsetzung sicher ist.142 Das neue System mit der Möglichkeit der Generalklausel verändert die Wirkungskraft jenes Textes, welcher das Zusammenwirken der Gesellschafter maßgeblich prägt. Es muss daher gefragt werden, ob sprachlich veränderte Vertragstexte bei unveränderter Rechtswirkung auch das Verhalten der Gesellschafter beeinflussen. So wird gerade im Konflikt, aber sicherlich im Streitfall das Vertragswerk hinzugezogen werden. Daher liegt die Frage nahe, ob das neue System das Konfliktverhalten in einer Personengesellschaft verändert. Denn bevor die Gesellschafter schließlich vor Gericht ziehen, muss es zunächst zu einem streit über den Beschluss und in dessen Rahmen auch über die Klausel kommen.143 Ist dies der Fall bietet ein Katalog wesentlich mehr Möglichkeiten prägnant zu argumentieren und so die Streitsache außergerichtlich zu klären. Die Minorität wäre durch die vertraglichen Tatsachen leichter von einer Aussichtslosigkeit eines Prozesses zu überzeugen. Hingegen kann eine Generalklausel die Parteien zu Spekulationen auf ihr Recht verleiten. Durch genannte persönliche Organisationsstruktur der Ge- Seilschaft, ist hier das Risiko das auf dieser spekulativen Grundlage aus sachfernen Gründen nicht nachgegeben wird vorhanden. Sofern die Gesellschafter einen Konflikt also austragen wollen, schürt eine Generalklausei das Risiko der Selbsttäuschung 'doch im Recht zu sein', statt durch einen Katalog vor Tatsachen gestellt zu werden. Wohlgemerkt ist das LG Hamburg im Fall Otto schon am 18.08.2004 zu einer Entscheidung gekommen. Beendet wurde der Rechtsstreit erst durch das BGH Urteil 2 !4 Jahre später. Jeder Beschluss auf Basis der Generalklausel könnte dann nach Auffassung einiger Gesellschafter formell illegitim sein. Somit herrschen in diesem Zeitraum streit und Zwietracht was wiederum die Qualität der Führung der Gesellschaft schmälert. Dies lähmt das Unternehmen und schädigt sämtliche stakeholder.144 Ein daraus resultierender Niedergang des Unternehmens und ein damit einhergehender volkswirtschaftlicher Schaden ist vor diesem Hintergrund nicht auszuschließen. Unter diesem Aspekt ist die Aufweichung der Anforderungen an den Vertragstext als negativ zu bewerten. Ein klarer Vertragstext schafft klarere Verhaltensregeln und bie- tet weniger Platz für Spekulationen.
Für die Regelung der zwischenmenschlichen Beziehungen weiterhin relevant, ist und bleibt der GV auch im Hinblick auf die Erörterung des Willens der Parteien im Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Das neue System differenziert nämlich nicht zwischen Abschlussdaten der GV. Es gilt daher für sämtliche GV. Der neue Maßstab den Willen der Parteien zu bestimmen kann durchaus zu anderen Ergebnissen kommen als das vormalige System. Daraus ergibt sich, dass der Text eines GV, welcher vor Otto entstand gegenwärtig einen anderen Willen zum Ausdruck bringen kann als im Zeitpunkt seines Abschlusses. So ist zum Beispiel die Formulierung: ״Be- Schlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst.“ vor Otto ein möglicher Ausdruck, dass die Gesellschafter das Tagesgeschäft flexibel entscheiden wollten. Im Zeitpunkt des Abschlusses werden sie von notarieller Seite darüber belehrt worden sein, dass diese Klausel ohnehin nur für gewöhnliche Geschäfte gilt, sie also zum Beispiel im Hinblick auf Grundlagengeschäfte ihre Sperrminorität behalten. Durch SG II, spätestens aber NJW 2015, 859 verändert der BGH bei jenem Beispielstatut die angedachte Wirkung. Somit nimmt der BGH durch die Reform seiner Rechtsprechung Einfluss auf den im Vertrag zum Ausdruck gebrachten Willen, da er dem geschriebenen Wort eine andere Bedeutung zukommen lässt. Für Gesellschafter mit Altvertragen bedeutet dies, dass sie ihr Vertragswerk jener Rückwirkung anpassen müssten. Praktisch ist hier jedoch zunächst zu bedenken, dass sich die Gesellschafter jener nachträglichen Veränderung ihres Vertrages gewahr werden müssen. Für Geschäftsleute wird es sicherlich nicht täglich relevant sein, ihr Statut gezielt auf Veränderungen durch Rechtsfortbildung überprüfen zu lassen. Zumal gerade in Deutschland mit einem Anteil von ca. 99 %145 an KMU selbst bei einem entsprechenden Überprüfungswillen diese laufenden Überprüfungen ein Großteil der Unternehmen nur schwer finanzieren kann. Selbst wenn die vorgenannten Hürden durch die Gesellschafter genommen wurden und es zu einem entsprechenden Informationsfluss kam, ist dies noch nicht die Lösung. Viel eher beginnt mit dem Eintritt des Bewusstseins der Gesellschafter, dass nämlich ihr GV lückenhaft ist, das eigentliche Problem. Denn durch SG II wurden Sperrminoritäten ihrer Macht beraubt, sofern der GV ihnen diese nicht zuvor ausdrücklich eingestand. Im Hinblick auf die vormalige Existenz von Kernbereichsschutz und Bestimmtheitsgrundsatz erscheint es jedoch als unwahrscheinlich, dass quasi als 3. Sicherung eine solche Klausel für jeden einzelnen Gesellschafter installiert wurde. Wesentlich wahrscheinlicher ist daher genannter Machtverlust, beziehungsweise eine Machtverschiebung von einem auf viele. Nun handelt es sich bei einer Personengesellschaft um eine Rechtsform, welche sich auch durch die persönlichen Aktivitäten der Gesellschafter auszeichnet. Dass es also über die Jahre des Betriebs der Gesellschaft dazu gekommen ist, dass einem Gesellschafter seine Sperrminorität geneidet wurde, oder diese von einer Mehrheit als störend, schädlich, oder überflüssig empfunden wurde liegt in der Natur des Menschen. Nach dem diese Mustergesellschaft also erfahren hat, dass Einzelne diese Macht durch BGH-Rechtsfortbildung an die Mehrheit verloren haben, ist doch die Motivation diese Macht jenen Einzelnen zurückzugeben fraglich. Viel eher stellt diese Begebenheit eine ״gute Gelegenheit“ dar sich von den Sperrminoritäten von subjektiv empfundenen ״Querulanten“ zu befreien. Sofern nämlich eine Vertragsanpassung auf die ursprüngliche Machtverteilung stattfinden soll, muss diese Anpassung beschlossen werden. Jener Beschluss zur Anpassung unterliegt allerdings der neuen Rechtsprechung, sodass hier die Minderheit von der Mehrheit abhängig, um ist in ihren alten Rechtskreis zurückzufinden. Sofern genannter Beschluss gefasst wurde, müssen sich die Gesellschafter zudem einigen, wie die Anpassung ausgestaltet wird. Es kommt also zu einer Diskussion der Machtverteilung in einer eingespielten Gesellschaft mit all ihren zwischenmenschlichen Abgründen des Neids, der Missgunst und eventuell auch alter Konflikte. Die Anpassung von Altverträgen an die neue Rechtsprechung erscheint daher zunächst als sinnvoll, doch muss sie letztlich auch ihr Risiko wert sein.
ее) Konkurrenz der Quoren
Eine Generalklausel ist zunächst für jeden Beschlussgegenstand, unabhängig von dessen expliziter Fixierung im GV, vom Einstimmigkeitsprinzip abweichend. Sind dann Beschlussquoren vorgesehen müssen diese einen exakten Beschlussgegenstand nennen, um nicht selbst von der Generalklausel verdrängt zu werden. Diese Konkurrenz tritt auch auf, sofern zwei explizite Quoren für einen bestimmten Beschluss einschlägig erscheinen. Sieht zum Beispiel eine Klausel für Beschlussgegenstand X 60 % vor und für Beschlussgegenstand Y 75 %, so besteht folgendes Risiko: Hat der Ver- tragsgestalter Gegenstand Y nicht hinreichend bestimmt so wird nur deutlieh das nicht Einstimmigkeit gelten soll. Es ist dann zu klären, ob nicht das Quorum des Gegenstandes X aufgrund einer möglichen Gegenstandsnähe auch für Y gelten soll. Eine Ausweitung von X auf Y im Rahmen allgemeiner Auslegung ist nicht von vornherein ausgeschlossen. Ein niedrigeres Quorum kann also durchaus ein höheres Quorum verdrängen. Dies stellt ein Risiko dar, welches bis SG II durch restriktive Auslegung unterbunden wurde. Sofern jetzt mehrere Quoren im Vertrag festgelegt sind kann es durch die Möglichkeit einer Generalermächtigung für alle drei Geschäftstypen in Verbindung mit der allgemeinen Auslegung der übrigen Klauseln zu Konkurrenzproblemen kommen. Die Vertragsgestaltung wird durch dieses Risiko weiterhin zur Katalogisierung der Beschlussgegenstände motiviert.
ff) Zusammenfassung formeller Divergenzen der Prüfsysteme
Die neue Rechtsprechung stabilisiert eine formelle Mehrheitskompetenz und stärkt die Flexibilität der Willensbildung von Personengesellschaften. Es ist nun wesentlich leichter eine Mehrheitskompetenz zu begründen und diese auch bei ungenauen Vertragsformulierungen zu erhalten. Ein Zurückfallen auf das Einstimmigkeitsprinzip ist hingegen die Ausnahme. Dies geschieht auf Kosten des Minderheitenschutzes, welcher eine enorme Verkürzung erfährt. Der Austausch der restriktiven Auslegung gegen die allgemeine Auslegung verstärkt die Genauigkeitsanforderungen an Kataloge. Diese werden in Zukunft auch die Funktion des Minderheitsschutzes durch BeWahrung des Einstimmigkeitsprinzips übernehmen müssen. Wie sich die neuen Gestaltungsmöglichkeiten auf das Konfliktverhalten der Gesellschafter auswirken, ist aufgrund der Neuheit des Systemwechsels noch zu beobachten. Was die Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern aus Altverträgen jedoch in jedem Fall beeinflussen wird, ist das neue Verständnis der §§ 709 II BGB und 119 II HGB. Altverträge werden eine gänzlich andere Herausforderung in der Anpassung darstellen als Neuverträge, obwohl beide den selben Prüfmechanismen des BGH unterworfen sind. Der Faktor Mensch darf hier nicht unterschätzt werden.
d) Ablösung der Kernbereichslehre
Die Kernbereichslehre ist abgeschafft. Sie wurde durch die interesse-zu- mutbarkeits146 Prüfformel ersetzt. Diese Prüfformel birgt zwar nicht gänzlich neue Maßstäbe, jedoch erscheinen einhergegangene Reformen wahrscheinlich. Schließlich fällt mit der Kernbereichslehre nach dem Bestimmtheitsgrundsatz die letzte Hürde zur Gleichschaltung der Absätze I und II der §§ 709 BGB und 119 HGB. Die damit einhergehenden Veränderungen aber auch Verbliebenes werden im Folgenden aufgezeigt und bemessen. Dies wird sodann eine Analyse der Entscheidung zum Systemwechsel auf der materiellen Ebene ermöglichen.
aa) Abschaffung fixer Kernrechte
Bis zu seinen beiden Entscheidungen von 1984 hat der BGH den fixen Part der Kernrechte nicht vorgegeben.147 Seit jenen Entscheidungen existierte ein sicher vorhandener Kreis an Kernrechten, zu welchem solche Rechte traten die aufgrund der Struktur der Gesellschaft zugesichert wurden. So existierten Rechte aufgrund der Kernbereichslehre selbst und nicht aufgrund des zugrunde liegenden Sachverhalts. Dies machte die Entscheidungen unflexibel und realitätsfern. Das weitere Hinzuziehen von Rechten die sich aus der Struktur der Gesellschaft ableiteten brachte hingegen Flexibilität und die Möglichkeit der Realitätsnähe in das System. Da der Kreis der fixen Kernrechte schon vor der jeweiligen Entscheidung des Gerichtes aufgrund seiner Begründung durch die Kernbereichslehre bestand, war das Erfordernis einer antizipierten Zustimmung bei derlei Rechten ebenso fixiert. Der Bedarf einer antizipierten Zustimmung und die jeweiligen Anforderungen waren folglich leichter kalkulierbar. Hingegen waren jene Kernrechte die sich aus der Struktur der Gesellschaft ergaben nicht schon vor der Entscheidung sicher. Sie waren somit schwerer zu kalkulieren. Allerdings sind durch Jahrzehnte der ständigen Rechtsprechung viele Entscheidungen zur Ableitung von Kernrechten aus der Struktur der Gesellschaft vorhanden gewesen. Daraus folgt, dass das Entstehen dieses Parts der Kernrechte zunehmend kalkulierbar wurde. Diese Kalkulation wurde allerdings dadurch erschwert, dass es eines wichtigen Grundes bedurfte um einen Eingriff zu rechtfertigen.148
Die Veränderungen jener Kalkulierbarkeit des Entstehens einer Schranke durch das neue System ist dem vergleichend gegenüberzustellen.
Ob ein Eingriff begründet ist hängt unter Anderem nun von einer interesse- zumutbarkeits-Prüfung i.v.m. nicht generell anerkannten unverzichtbaren Rechten ab. Das Entstehen von diesen unverzichtbaren Rechten ist im Einzelfall von der Struktur der Gesellschaft abhängig, allerdings mit selbiger Prüfformel wie bereits 1995.149 Das folglich die Unmöglichkeit eines Eingriffs aus der Struktur der Gesellschaft entspringt ist im Hinblick auf das alte System keine Neuerung. Da der fixe Kernbereich aufgelöst ist, ist neu dass vor einem Urteil keine Schranken mehr bekannt sind. Das Bestehen oder nicht Bestehen ist nun immer einzelfallabhängig. Dies erhöht im Vergleich zum alten System das Potential der Entscheidungen flexibel und realitätsnah zu sein. Die Realstruktur einer Gesellschaft bestimmt sich im Gerichtsverfahren und somit auch der Rechtskreis einer betroffenen Person. Es fehlen jedoch (noch) Einzelfallentscheidungen, sodass die endgültige Definition der ״konkreten Struktur der Gesellschaft“ unklar ist. Derzeit ist es bei Personengesellschaften möglich im Rahmen der zulässigen vertraglichen Dispositionen beliebig die Struktur einer Gesellschaft zu gestalten und so auch anomale Konstrukte zu erschaffen.150 Eine gänzlich einheitliche und somit eindeutige Bedeutung des BGH-Verständnisses von ״Struktur“ ist noch nicht absehbar. Aufgrund jener bewiesener Unklarheit ergibt sich eine im Vergleich zum alten System höhere Unkalkulierbarkeit des Entstehens von Beschlussschranken. Es kommt bei der Entstehung dieser Beschlussschranken auch auf eine ״besondere Stellung des Gesellschafters“ in der Gesellschaft an. Da die konkrete Struktur der Gesellschaft unklar ist und die besondere Stellung des Gesellschafters von ihr abhängt, strahlt diese Unklarheit auch auf die Definition besagter Stellung aus. Somit bleibt die erhöhte Unkalkulierbarkeit des Entstehens von Beschlussschranken im neuen System erhalten.
Es liegen daher im neuen System Begriffe vor, welche noch nicht ausreichend durch die Rechtsprechung ausgefüllt sind. Wie auch im Werdegang der Kernbereichslehre wird hier noch durch weitere Urteile eine Ausfüllung zu erwarten sein. Folglich wird das neue System wie auch vormals die Kernbereichslehre an Kalkulierbarkeit zunehmen. Es ist daher zu klären, ob durch diese prognostizierte Rechtsfortbildung die Kalkulierbarkeit des alten Systems erreicht werden kann. Der BGH hat bis SG II den Bestimmtheits- grundsatz aufgeweicht und durch den NJW 2014, 859 die Kernbereichsieh- re abgeschafft. Zwei Werkzeuge zur Sicherstellung eines generellen Maßstabes sind offenkundig nicht mehr im Sinne des BGH. Stattdessen tendiert der BGH nun zu flexiblen Mechanismen, welche gänzlich einzelfallabhängig sind. Das nun Einzelfallentscheidungen dazu führen, dass doch wieder ein fixer und genereller Maßstab entwickelt wird, ist aufgrund der aufgezeigten Tendenz des BGH höchst unwahrscheinlich. Das dass neue System also zur Kalkulierbarkeit des alten Systems aufschließt ist daher zu bezweifeln. Demnach liegt mit dem Kalkulationsdefizit der neuen Rechtsprechung ein Rückschritt in der Erfassbarkeit gestatteter Eingriffe in die individuelle Rechtsstellung eines Gesellschafters vor.
bb) Entbehrlichkeit der antizipierten Zustimmung
Sofern im alten System dem betroffenen Gesellschafter ein Kernrecht zugestanden wurde, musste er im Falle eines Eingriffs diesem Eingriff erst Zustimmen oder ein wichtiger Grund vorliegend sein. Erstere, meist antizipierte Zustimmung konnte jedoch nicht einmalig für alle Kernrechte im Sinne einer Generalzustimmung erteilt werden. Es bedurfte je Kernrecht einer individuellen Zustimmung. Daraus resultierten von Kernrecht zu Kernrecht diverse Bestimmtheitserfordernisse an antizipierte Zustimmungen. Dies machte das alte System sachverhaltsnäher. Die Mehrheitskompetenz wurde allerdings vor formelle Schranken auf materieller Prüfungsebene gestellt, welche aufgrund der Fallabhängigkeit zusätzliche Variablen bargen. Durch diese erhöhten Schranken wurde in der Folge auch das Bestehen der Mehrheitskompetenz erschwert, wodurch das Risiko eines Zurückfal- lens in das starre Einstimmigkeitsprinzip zunahm. Die Flexibilität des Unternehmens wurde somit durch die diversen Bestimmtheitserfordernisse auf der materiellen Beschlussebene gehemmt.
Im neuen System wird die Bestimmtheit, im Sinne des Ausdrucks der Zuständigkeit der Mehrheit, einzig auf der 1. stufe geprüft. Formelle Probleme sind daher für die 2. stufe nicht mehr relevant. Die materielle Prüfungsebene ist daher nun von formellen Prüfaspekten bereinigt. Der Prüfaufwand richtet sich nun einzig auf die interesse-zumutbarkeits-Prüfung, sodass hier einzig Sachaspekte des Einzellfalls einen Eingriff rechtfertigen können. Zwar gab es durch die Kernbereichslehre diverse Bestimmtheitserfordernisse, jedoch waren diese schon vor einem Disput vorgegeben. Im neuen System ergibt sich für die materielle Legitimation aufgrund reiner Inhaltsabhängigkeit des gegenwärtigen Zeitpunkts ein höheres Maß an Realitätsnähe. Durch diese Abhängigkeit des Urteils zum Sachverhalt wird die einstige Beeinflussbarkeit per GV im Vergleich zum alten System erschwert.
Im Zusammenhang mit der Beeinflussbarkeit der Entscheidung des Gerichts auf der materiellen Ebene ist zu fragen, ob eine solche Beeinflussung durch das Vertragswerk denn überhaupt noch möglich ist. So ist für die materielle Legitimation einzig relevant, ob ein Eingriff im Interesse der Gesellschaft geboten und dem Gesellschafter zumutbar ist. Sofern also die Zumutbarkeit beeinflussbar ist, würde das neue System kalkulierbarer werden. Fraglich ist daher, ob sich die Schutzwürdigkeit des betroffenen Gesellschafters abschwächt, sofern er antizipiert einem Eingriff zugestimmt hat. Diese antizipierte Zustimmung ist jedoch nicht mit jener der Kernbereichslehre zu verwechseln. Viel eher soll diese in ihrer Wirkungsweise imitiert werden. So kommt es zwar durch die Aufgabe der Kernbereichslehre exklusive nachträglichen Belastungen nicht mehr auf eine Zustimmung an. Jedoch drückt diese vorab aus, dass der erklärende Gesellschafter von sich aus mitteilt, dass er selbst den Eingriff in seine Rechte und sein Vermögen für sich zumutbar hält. Ob diese Zustimmung als Rechtsgeschäft mindestens die Zumutbarkeitzu Gunsten der Gesellschaft verschiebt, oder sich daraus sogar eine Zustimmungspflicht für den Gesellschafter ergibt ist noch unklar. Aufgrund mangelnder Rechtsprechung zu derartigen ״neuen“ Zustimmungen, bleibt eine Klärung vorgenannter Frage auf eine Prüfung ihrer Zulässigkeit beschränkt. So ist die Ausgestaltung des Innenverhältnisses grundsätzlich der Privatautonomie unterworfen.151 In der Folge unterliegt der GV, und somit auch die hier durchzuführende Prüfung, den Schranken der Privatautonomie.152 Eine antizipierte Zustimmung zur VerSchiebung der Zumutbarkeit ist daher den §§ 134, 138 BGB unterworfen. Einschlägig erscheinen in diesem Kontext die Fallgruppen der übervorteilung, der Abhängigkeit und der Selbstentmündigung. Für alle drei Fallgruppen gleichsam bedeutend ist zunächst der Aspekt des Wertungswandels. So ist für den Eintritt der Sittenwidrigkeit der Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsgeschäfts ausschlaggebend.153 Sofern das Rechtsgeschäft schon im Zeitpunkt der Vornahme sittenwidrig war, bleibt es unabhängig eines Wertungswandels sittenwidrig.154 Ist das Rechtsgeschäft im Zeitpunkt seines Abschlusses noch nicht sittenwidrig und noch nicht abgewickelt, wird jedoch nach objektiven Maßstäben durch Wertungswandel sittenwidrig, so begründet es keinerlei Rechte mehr.155 Für die These der neuen antizipierten Zustimmung bedeutet dies, dass es immer auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses ankommt und die Vereinbarung einen möglichen Wertungswandel einschließen muss. Die antizipierte Zustimmung im alten System wurde als Rechtsgeschäft betrachtet.156 Folglich unterlag sie mindestens den selben Restriktionen der Privatautonomie, wie sie hier für eine neue antizipierte Zustimmung vermutet wurden. Dieses Rechtsgeschäft konnte in der Vergangenheit unter der Maßgabe der§§ 134, 138 BGB wirksam abgeschlossen werden. Daher ist eine nähere Untersuchung im Bezug auf eine neue antizipierte Zustimmung im Hinblick auf die Tatbestandsmerkmale der Übervorteilung, der Abhängigkeit und der Selbstentmündigung nicht mehr nötig. Die Vergangenheit hat eine Zulässigkeit unter jenen Aspekten nicht verneint, sodass diese Schranken einer Klausel, welche eine Zustimmung enthielte, nicht grundsätzlich einzuschließen sind. Aufgrund der verschärften individuellen Fallabhängigkeit der künftigen BGH-Entscheidungen ist jedoch zu beachten, dass eine Klausel nun umso eher kraft Wertungswandels als sittenwidrig betrachtet werden könnte.
Der Bedarf an einer antizipierte Zustimmung kann jedoch im Bezug auf Beitragserhöhungen fortbestehen. Schließlich wurden bisher Zustimmungspflichten für einzelne Gesellschafter nur in Fällen der Beitragserhöhung an- genommen.157 In jenen Fällen wurde dies mit der Treuepflicht des Betroffenen begründet. Folglich würde, sofern eine Zustimmungpflicht bejaht wird, eine Verschiebung der Zumutbarkeit ebenso aus der Treuepflicht heraus begründet werden. Die neue materielle Prüfformel des BGH wägt jedoch ohnehin bereits nach geboten-zumutbar im Sinne der Treuepflicht ab, sodass der Quell der Bejahung der Zumutbarkeit der Selbe wäre. Folglich spielt die Beantwortung der Frage, ob eine antizipierte Zustimmung eine Zustimmungspflicht begründet, keine Rolle. Wie sich eine antizipierte ZuStimmung auch nach Aufgabe der Kernbereichslehre auf die Zumutbarkeit auswirkt, bleibt daher letztlich noch vom BGH zu entscheiden.
cc) Die Treuepflicht in der neuen materiellen Prüfung
Zu Zeiten der Anwendbarkeit der Kernbereichslehre wurde eine treupflichtwidrige Ausübung der Mehrheitsmacht nur bei mittelbaren Eingriffen in Kernrechte geprüft.158 Die Relevanz der Treuepflicht wurde hier folglich am Kriterium der Unmittelbarkeit festgemacht. Diese Unterscheidung zweier Kategorien der Schwere eines Eingriffs als Auslöser eines Prüfmechanismus erscheint bei der Anzahl denkbarer Eingriffe unflexibel, jedoch umso antizipierbarer.
Diesen zwei Kategorien gegenüber wird seit SG II der Beschluss immer, also fallunabhängig, auf eine Verletzung der Treuepflicht geprüft.159 Ob eine Treuepflichtverletzung vorliegt muss seit Otto zunächst generell die Minderheit beweisen. Insoweit fand eine Beweislastumkehr zu Gunsten der Mehrheit statt. Sofern jedoch ein Eingriff in relativ oder absolut unentziehbare Rechte vorliegt wird eine Treuepflichtverletzung unterstellt. Diese Vermutung ist dann von der Gesellschaftermehrheit zu widerlegen.160 Eine stufung der Prüfintensität auf materieller Ebene findet also nur noch bei der Beweislast statt. Wobei hier der Bruch mit ursprünglichen Verfahrensregeln zu beachten ist. So ist es nicht mehr der Anspruchssteller, welcher hier seinen Anspruch geltend machen muss. Dies ist im Bezug auf die Treuepflicht nur noch der Fall, wenn in unentziehbare Rechte eingegriffen wird. Deren Existenz ist allerdings vom BGH weder abgelehnt noch eingeräumt worden. Folglich ist die Beweislast zu Ungunsten der ohnehin schon weniger geschützten Minderheit verschoben worden, ohne das eine konkrete Begründung dafür vorliegt.
Im Verhältnis zur Treuepflicht hat nun eine Ausdehnung der Prüfintensität stattgefunden. Es wird immer eine Treuepflichtverletzung geprüft, sodass entsprechend jeder Sachverhalt gleich gewürdigt wird. Die Beweise zur Umsetzung sind jedoch von der Minderheit zu erbringen, sodass diese Ausdehnung in ihrer Bedeutung noch kritisch zu beobachten ist. Allerdings führt eine Mehrung der Prüfintensität immer auch zu einer Erhöhung des Risikos, dass der Mehrheitsbeschluss materiell nicht legitimiert wird. Die Wandlung von einer kategorieabhängigen Treuepflichtprüfung hin zu einer gene- rellen Prüfung ist für Minderheitsgesellschafter nützlich, sofern ihnen denn Beweise vorliegen. Durch die somit ausgedehnte Einzelfallabhängigkeit wird auch hier das neue System auf Kosten der Rechtssicherheit Einzelner flexibler.
Im Zusammenhang mit der Treuepflicht ist auch die neue materielle Prüfformel zu analysieren. So geht der BGH ״nun“ davon aus, dass ein Eingriff im Interesse der Gesellschaft geboten und dem Gesellschafter unter Beachtung seiner schutzwerten Belange zumutbar sein muss. Im Anschluss prüft der BGH sodann immer eine Treuepflichtverletzung. Allerdings entspricht die geboten-zumutbar-Prüfformel der neuen 2. stufe exakt der Treuepflichtprüfformel des alten Systems.161 Sofern also die 2. stufe keine neue Formel für die Treuepflicht erhalten hat hieße dies, dass letztlich zwei Mal die Treuepflicht geprüft wird. Es würde lediglich das Etikett gewechselt. Das hingegen das neue Prüfsystem auf der 2. stufe tatsächlich eine neue Prüfformel speziell für die Treuepflicht erhalten hat, geht aus keiner Äußerung des BGH hervor. Es ist also von einer doppelten Treuepflichtprüfung auszugehen. Welchen Sinn dies für die materielle Prüfung habe soll ist gegenwärtig nicht zu erschließen.
dd) Zusammenfassung materieller Divergenzen der Prüfsysteme
Die Kernbereichslehre schützte jeden einzelnen Gesellschafter vor der Mehrheit und auch vor sich selbst. Eine unbedachte Unterwerfung unter einen Mehrheitswillen wurde durch das Vetorecht für den Betroffenen abgemildert. Mit dem Wegfall der Kernbereichslehre gibt es keinen Schutzmechanismus mehr, der dem Gesellschafter ein Vetorecht zuspricht. Zwar ist die Treuepflichtprüfung nun immer durchzuführen. Dem stehen allerdings eine Auflösung des fixen Kernbereichs, eine unwägbare Bestimmung der vermögensmäßigen Gesellschafterstellung, sowie die Aufhebung formeller Schranken auf der materiellen Ebene gegenüber. Hinzu kommt eine VerSchiebung von antizipierbaren Anforderungen an einen Eingriff hin zu ganzlieh einzelfallabhängigen Qualifikationen. Ob das neue System im Hinblick auf seine materiellen Prüfsysteme die Minderheit weniger schützt kann nur im Bezug auf die Liquidation des fixen Kernbereichs unterstellt werden. Ob jedoch die neue Prüfformel des geboten-zumutbarkeit dies aufwiegt werden kommend Entscheidungen zeigen müssen. Nach heutigem Stand kann rückblickend auf die dargestellten Veränderungen und deren Gewichtung keine abschließende Feststellung getroffen werden. Da der Schutz nach einer unbedachten Unterwerfung nun auf materieller Ebene geringer ist als zuvor, wird jeder einzelne Gesellschafter selbst die Lücken im Vertrag ausfüllen wollen. Dies bedeutet, dass den Gesellschaftern nun mehr denn je daran gelegen sein wird Fehler die ihre eigenen Vermögenswerte schmälern könnten vorab zu eliminieren, da dies nachträglich nun schwerer ist. Möglichkeiten die materielle Prüfebene vorab zugunsten des Einzelnen zu beeinflussen sind noch nicht bekannt. Folglich werden die Gesellschafter den Schwerpunkt ihrer vertraglichen Vorbereitungen auf Eingriffe in ihre individuelle Rechtsstellung auf die formelle Ebene verlegen. Die Veränderungen im neuen System auf der 2. stufe sind folglich eine Motivation für die Gesellschafter auf der 1. stufe ihren Willen so exakt wie möglich zum Ausdruck zu bringen. Das der Wegfall der Kernbereichslehre also das Bedürfnis nach Beschlusskatalogen fördert ist nicht auszuschließen. Diese Vermutung deckt sich mit der bereits getroffenen Feststellung zur Aufgabe des Bestimmtheitsgrundsatzes.
B. Empfehlungen für die Kautelarpraxis
In den vorstehenden Ausführungen sind Beweise zu tiefgreifenden Veränderungen im neuen Beschlussprüfsystem des BGH erbracht worden. Wie mit diesen neuen Standards umzugehen sein sollte wird in den hier nachstehenden Empfehlungen dargestellt.
I. Grundsätzliche Gestaltungsfrage
Das neue System hat eine Verschiebung der Schutzintensität bewirkt. Es ist daher zunächst festzuhalten, dass jede Vertragsgestaltung, ob Altvertrag oder Neuvertrag, dieser Verschiebung Rechnung tragen muss. So wird hier zunächst der optimale Schutz der Mehrheitskompetenz betrachtet werden und sodann der optimale Schutz eines Einzelnen. In der Folge wird dann jeder Gestalter in Abhängigkeit insbesondere von Klient und Gesellschaftszweck zwischen diesen beiden Polen Beschlusskompetenzen verteilen müssen.
1. Die sichere Mehrheitskompetenz
Die absolute Herrschaft der Mehrheit muss zunächst durch eine Disposition vom Einstimmigkeitsprinzip gegeben sein. Dies ist durch folgende Formulierung grundsätzlich möglich: ״Beschlüsse sind durch einfache Mehrheit zu fassen.“. Dadurch wird eine generelle einfache Mehrheit verankert, welche nicht dem Einstimmigkeitsprinzip weicht. Sofern nämlich nun noch spezifi- sehe Mehrheiten bestimmt werden und diese durch allgemeine Auslegung nicht dem ihnen zugedachten Quorum entsprechen, fallen diese auf die allgemeine Mehrheitsklausel zurück. Sofern diese spezielleren Quoren zum Beispiel als Schutz vor der einfachen Mehrheit aber auch als Schutz vor der Sperrminorität eingebracht werden sollen, empfiehlt sich folgender ZuSatz: ״Beschlüsse sind mit einfacher Mehrheit zu fassen, sofern der GV nicht abweichend regelt oder das Gesetz zwingen etwas anderes vorsieht.“. Jene abweichenden Regelungen sollten auslegungssicher in einem Katalog festgehalten werden, damit nicht ein spezielleres Quorum aufgrund von Vertragslücken auf die einfache Mehrheit reduziert wird. Um den Katalog sowohl in der Zukunft als auch in der Gegenwart auslegungssicher zur halten, sollte er nicht Abschließend sein. So empfiehlt sich für den Katalog zu verwenden, dass ״insbesondere nachstehende Beschlüsse einer anderen Mehrheit als der Einfachen unterworfen sein sollen.“ Ein abgeschlossener Katalog würde Gesetzesänderungen in Beschlussgegenständen nicht erfassen und würde zudem bei Lückenhaftigkeit sofort auf die einfache Mehrheit zurückfallen. Der nicht abschließende Katalog gibt der allgemeinen Auslegung noch die Möglichkeit eine Vertragslücke innerhalb des Katalogs zu schließen.
Aufgrund der Tatsache, dass einfache Mehrheiten auch deshalb so leicht zu etablieren sind, weil speziellere Mehrheiten nun wesentlich schneller auf die einfache Mehrheit zurückfallen können, empfiehlt sich Folgendes. So kann zwischen die hier vorgenannte Generalklausel und die Einführu- rungsklausel des Kataloges noch eine Sicherung vor der einfachen Mehrheit eingebaut werden. Der Katalog sollte zunächst diverse Gebiete für qualifizierte Mehrheiten vorsehen. Diesen Gebieten werden dann exakte Beschlussgegenstände nicht abschließend per Katalog zugeordnet. An dieser Stelle setzt die Sicherung ein. Der empfohlene Wortlaut, hier Beispielhaft für das Gebiet der Vertragsänderung, ist: ״ Vertragsänderungen werden entgegen [§ der Generalklausel] mit Y % der stimmen gefasst, sofern der nachstehende Katalog nichts anderes regelt“. Für das Beispiel der Vertragsänderungen bedeutet dies, dass sofern ein Katalog lückenhaft ist, nicht die einfache Mehrheit, sondern die ״salvatorische Mehrheit“ Y gilt. Wenn die Gesellschafter nun gänzlich sicherstellen wollen, dass die im Katalog verwendete Mehrheit auch zulässig ist, so besteht weiterhin die Möglichkeit die entsprechenden Mehrheit, sowie deren Beschlussgegenstände aus dem Gesetz zu entnehmen.162 Der Autor schließt sich beim Formulierungsvorschlag jenem Konzept Karsten Schmidts an, welcher bereits 1994 und leicht verändert 2008 die folgenden Regelung empfiehlt:
״[...] § Y: Gesellschafterbeschlüsse
(1) Die von den Gesellschaftern in Angelegenheiten der Gesellschaft zu treffenden Bestimmungen erfolgen durch Beschlüsse. Die Beschlüsse werden in Gesellschafterversammlungen gefasst. [...]
(3) Die erforderlichen Mehrheiten bestimmen sich nach dem Recht der GmbH.“:163
Die Beschlussgegenstände werden hier Abstrakt der qualifizierten Mehrheit unterwofen. So soll immer dann eine qualifizierte Mehrheit für einen BeSchlussgegenstand gelten, sofern das Gesetz ein Quorum für diesen vorsieht. In solchen Fällen findet dann auch das gesetzliche Quorum Anwed- nung. Dieses Konzept zu 100 % zu übernehmen wird vom Autor jedoch nicht empfohlen. Als Ergänzung zu den Katalogen wird lediglich der Bezug zu den Quoren eines Gesetzes empfohlen, sofern absolute Rechtssicherheit erlangt werden soll. Für die Klauselformulierung bedeutet dies am Beispiel des GmbHG, dass sofern das GmbHG für einen nachstehenden BeSchlussgegenstand des Kataloges kein anderes Quorum vorsieht das Quorum des Katalogs gilt. Sieht das GmbHG für einen aufgeführten oder nicht aufgeführten Beschlussgegenstand ein anderes Quorum vor, so soll dieses gelten. Die Quoren des Katalogs werden also subsidiär zu jenen des GmbhG angewandt.
Zusammengefasst bedeutet dies, dass zunächst von der Einstimmigkeit per Generalklausel abgewichen wird. Sodann wird für jedes Themengebiet eine Klausel mit einer generellen Mehrheit für das Themengebiet eingeführt, welche jedoch nur zur Anwendung kommt, sofern ein nachstehender Katalog nicht abweichend qualifiziert regelt. Die im Katalog verankerten Mehrheiten können hier auch aus dem Gesetz entnommen werden. Dieser Vorschlag schützt einzig eine Mehrheitskompetenz unter totaler Vernachlässigung der Bedürfnisse der Minderheit. Daher ist dieser Vorschlag auch nur als einer der zwei Pole zu betrachten, zwischen welchen letztlich eine individuelle Balance gefunden werden muss.
2. Der totale Minderheitenschutz
Dem zuvor dargestellten Vorschlag zur Mehrheitsprotektion ist als zweiter Pol ein Modell des totalen Minderheitenschutzes gegenüberzustellen. Zunächst wird jedoch die Frage zu beantworten sein, ob es im Angesicht des dispositiven Einstimmigkeitsprinzips überhaupt eines weiteren Modells bedarf. Schließlich würde eine permanente und unangreifbare Einstimmigkeit erreicht, sofern erst gar nicht vom gesetzlichen Leitbild abgewichen wird. Dieser Überlegung ist jedoch die Folge einer totalen Sperrminorität im Hinblick auf Sinn und Zweck des Minderheitenschutzes entgegenzusetzen. Der Minderheitenschutz hat, wie bereits dargelegt, zweckmäßig den Schutz der individuellen Rechts- und Vermögensposition inne. Wird nun also nicht vom Einstimmigkeitsprinzip abgewichen, wird das Unternehmen unflexibel und ist in seiner Entscheidungsfindung gehemmt. Mindestens das unmittelbare Wachstum des Unternehmens, aber mit Sicherheit die ferne Zukunft des Unternehmens würden in Abhängigkeit von der Vielzahl an Gesellschaftern unter dem Einstimmigkeitsgebot leiden. Daraus folgt, dass mit einer Schädigung des Unternehmens auch eine Schmähung der individuellen Vermögensposition einhergeht. Letztlich schlägt der Wertverlust, welcher aus dem Einstimmigkeitsprinzip folgte auf jenes durch was ursprünglich geschützt werden sollte. Vor diesem Hintergrund ist jedem Gesellschafter zu empfehlen, in bestimmten Fällen vom Einstimmigkeitsprinzip abzurücken, um einer Selbstschädigung durch die Schutzinstrumente zu entgehen. Jedoch ist es nun so, dass das Einräumen überhaupt irgendeinereiner Mehrheitskompetenz die Ausdehnung dieser mit sich bringen könnte. Sofern sich also ein Gesellschafter aus der Sicherheit des Gesetzes wagt, muss er dies gründlich tun.
Eingangs sei klargestellt, dass eine Generalklausel unter keinen Umständen in Frage kommt. Der Gesellschaftsvertrag darf keinen Anhaltspunkt enthalten, dass sich der betreffende Gesellschafter der Mehrheit unterwerfen will. Dies muss auch für nicht vorgesehene Beschlüsse gelten. Das Vertragswerk hat hier die Aufgabe eine Auslegung um jeden Preis zu verhin- dem. Das Vertragswerk sollte daher stets den Unwillen zur Mehrheitskompetenz erkennen lassen. Ein nicht abschließender Negativkatalog mit Beschlussgegenständen, welche ausdrücklich nicht einer Mehrheit unterworfen werden sollen, muss neben einem zweitem Katalog eingebracht werden. Jener zweite Katalog muss wiederum abschließend sein und ausdrücklich Beschlussgegenstände aufführen, welche der Mehrheit unterworfen sein sollen. Jedem Beschlussgegenstand muss explizit ein qualifiziertes Quorum zuteil werden, sodass eine ausgedehnte einfache Mehrheit innerhalb des Kataloges nicht unterstellt werden kann. Von einem Bezug auf das Gesetz wird abgeraten, da sich Gesetze, sowie deren Verständnis verändern können, was letztlich auch der Grund für die hiesige Arbeit ist. Dem abschließenden Katalog sollte der Zusatz vorangestellt werden, dass in keinem anderen Fall die einfache oder qualifizierte Mehrheit zu gelten hat. Auf diese Weise kann das Risiko der Ausdehnung des Katalogs weiter reduziert werden. Basierend auf vorgenannten Ausführungen lautet der Formulierungsvorschlag des Autors für den Positivkatalog: ״Einzig die nachfolgenden Beschlussgegenstände unterliegen nicht der Einstimmigkeit, sondern der jeweils zugeordneten qualifizierten Mehrheit. Sofern einem Beschlussgegenständ nicht zweifelsfrei ein Quorum zugewiesen werden kann, gilt ausnahmslos Einstimmigkeit.“.
II. Abschließendes Kompendium
Die Vertragsgestaltung muss stets die Struktur der Gesellschaft, die Persönlichkeiten der Gesellschafter, deren Interessen, und viele weitere Faktoren sowohl für die Zukunft als auch für die Gegenwart berücksichtigen. Bei der Summe an möglichen Variablen ist jedes Vertragswerk gänzlich individuell. Somit kann es keine einheitliche Formulierungsempfehlung geben. Letztlich muss individuell ein Mittelwert auf der Strecke zwischen den beiden dargestellten Polen gefunden werden. Unabhängig davon welcher Wille nun zum Ausdruck gebracht werden soll, kann es nur eine einzige Generalempfehlung zur Formulierung selbst geben. So stimmt der Autor mit der einhelligen Auffassung der Literatur überein, dass der Kautelarpraxis zu klaren und insbesondere unzweifelhaften Formulierungen zu raten ist.164
1 MünchKomm z. HGB/Enzinger, § 119 Rn. 4.
2 BGHZ 170, 283, Rn. 8.
3 BGHZ 170, 283, Rn. 8.
4 BGHZ 170, 283, Rn. 8.
5 BGHZ 170, 283, Rn. 2.
6 BGHZ 170, 283, Rn. 6.
7 BGHZ 170, 283, Rn. 8.
8 BGHZ 170, 283, Rn. 8.
9 BGHZ 170, 283, Rn. 11.
10 BGHZ 179, 13, Rn. 1.
11 BGHZ 179, 13, Rn. 2.
12 BGHZ 179, 13, Rn. 2.
13 BGHZ 179, 13, Rn. 2.
14 NJW2015, 859, Rn. 3.
15 NJW 2015, 859, Rn. 2.
16 NJW 2015, 859, Rn. 6.
17 NJW 2015, 859, Rn. 9; NJW 2015, 859, Rn. 13.
18 NJW 2015, 859, Rn. 12.
19 NJW 2015, 859, Rn. 24.
20 NJW 2015, 859, Rn. 25; NJW 2015, 859, Rn. 26.
21 NJW 2015, 859, Rn. 29.
22 NJW 2015, 859, Rn. 18.
23 NJW 2015, 859, Rn. 19.
24 Werthebruch, DB 2014, 2875, (2877).
25 NJW 2015, 859, Rn. 33.
26 NJW 2015, 859, Rn. 34.
27 RGZ 151, 321, (3261).
28 BGHZ 8, 35, (41 1).
29 Handelsgesetzbuch/ßom, § 109 Rn. 18.
30 Schäfer, Gesellschaftsrecht, § 7 III, (S.461).
31 Werthenbruch, NZG 2013, 641, (642).
32 Werthenbruch, NZG 2013, 641, (642).
33 BGHZ 8, 35, (41 1).
34 BGHZ 8, 35, (42).
35 Kurzkommentar zum Handelsgesetzbuch/Rof/7, § 119 Rn. 37 c.
36 NJW 2015, 859, Rn. 16; Kurzkommentar zum Handelsgesetzbuch/Fre/fag, § 109 Rn. 69.
37 Werthenbruch, NZG 2013, 641, (643).
38 Marburger, NJW 1984, 2252, (2253).
39 Uechtritz, DB 1995, 90, (91).
40 MünchHandbuch d. Gesellschaftsrechts Bd. 2/Weipert, § 14 Rn. 53.
41 MüchKomm z. BGB/Sc/7ärer, § 709 Rn. 87; Schmidt, ZHR 1996, (212 f.)
42 MüchKomm z. BGB/Sc/7ärer, § 709 Rn. 87.
43 MüchKomm z. BGB/Sc/7ärer, § 709 Rn. 87, 88.
44 MüchKomm z. BGB/Sc/7ärer, § 709 Rn. 91.
45 BGHZ20, 363, Rn. 13.
46 BGHZ20, 363, Rn. 13.
47 Schäfer, ZGR2013, (250).
48 BohlkenlSprenger, DB 2010, 263, (264); Handelsgesetzbuch/ßom, § 109 Rn. 17.
49 MünchKomm z. HGB/Enzinger, § 119 Rn. 70; Priester, NZG 2015, (531).
50 BGHZ 85, 350, (365); MünchKomm z. BGB/Ulmer/Schäfer, § 709 Rn. 98.
51 Schmidt, ZGR 2008,1, (16); NJW 1995,194, (195).
52 Weber, DStR 2010, 702, (703).
53 MünchKomm Z. HGB!Enzinger, § 119 Rn. 104.
54 Uechtritz, DB 1995, 90, (92); Kindler, Grundkurs Handels- und Gesellschaftsrecht, 1. Teil, § 11 Rn. 82 (S. 2841).
55 Schäfer, ZGR 2013, (254); BeckOK z. BGBl Schöne, § 709 Rn. 35.
56 NJW 1995, 194, (195); MünchKomm z. HGB /Enzinger, § 119 Rn. 65.
57 MünchKomm z. HGB/Enzinger, § 119 Rn. 64.
58 Schäfer, ZGR 2013, 237, (255).
59 Uechtritz, DB 1995, 90, (92).
60 Uechtritz, DB 1995, 90, (92).
61 Uechtritz, DB 1995, 90, (91 ); NJW 2015, 859, Rn. 19.
62 NJW 1985, 972, (974).
63 Uechtritz, DB 1995, 90, (91).
64 HeckschenlBachmann, NZG 2015, 531, (535).
65 Heckschen/Bachmann, NZG 2015, 531, (535).
66 NJW 1995, 194, (195).
67 NJW 1995,194, (195); BGHZ 132, 263, (268); Schmidt, ZGR 2008,1, (16).
68 BGHZ 170, 283, Rn 9.
69 BGHZ 170, 283, Rn. 9.
70 BGHZ 8, 35, (42).
71 BGHZ 170, 283, R. 9.
72 Werthenbruch, NZG 2013, 641, (642).
73 BGHZ 170, 283, Rn. 9.
74 BGHZ 170, 283, Leitsatz a; BGHZ 170, 283, Rn. 10; Schmidt, ZHR 1994, 205, (218); Schmidt, ZGR 2008,1,(16).
75 BGHZ 170, 283, Rn. 10; GeseWscbaftsrecWHenssler/Strohn, VII. Rn. 63; Schmidt, ZGR 2008,1, (16).
76 BGHZ 170, 283, Rn. 10; Schäfer, NZG2014, 1401, (1404).
77 BGHZ 170, 283, Rn. 10;
78 NJW 2015, 859, Rn. 12;
79 BGHZ 170,283, Rn. 10.
80 BGHZ 179, 13, Rn. 15.
81 Werthenbruch, NZG 2013, 641, (643).
82 Werthenbruch, NZG 2013, 641, (642).
83 Schäfer, ZGR 2013, (242); ZIP 2013, 65, Rn. 15.
84 Werthenbruch, NZG 2013, 641, (642).
85 NJW 2015, 859, Rn. 14.
86 NJW 2015, 859, Rn. 14.
87 Schäfer, ZGR2013, (244); BGHZ 179, 13, Rn. 9, 10.
88 BGHZ 179, 13, Rn. 13.
89 NJW 2015, 859, Rn. 16.
90 NJW 2015, 859, Rn. 13.
91 NJW 2015, 859, Rn. 15.
92 NJW 2015, 859, Rn. 15.
93 NJW 2015, 859, Rn. 24.
94 BGHZ 179, 13, Rn. 17.
95 NJW 2015, 859, Rn. 19.
96 NJW 2015, 859, Rn. 19.
97 NJW 2015, 859, Rn. 19.
98 Werthenbruch, DB 2014, (2880).
99 NJW 2015, 859, Rn. 19.
100 Werthenbruch, DB 2014, (2877).
101 Werthenbruch, DB 2014, (2877).
102 Werthenbruch, DB 2014, (2878).
103 NZG2009, 501, Rn. 14.
104 NJW2015, 859, Rn. 11.
105 Werthenbruch, DB 2014, (2880).
106 MünchKomm z. BGB/Sc/7ärer, § 709 Rn. 87.
107 Schmidt, ZHR (1994), 205, (215 f.).
108 Hermanns, ZGR (1996), 103, (105 f.); Priester, DStR (2008), 1386, (1387); Handelsgesetzbuch/ OetkerIWeitemeyer, § 119 Rn. 35.
109 NJW 1995, 194, (195).
110 BGHZ 132, 263, (268).
111 MünchKomm z. HGB/Schmidt, § 105 Rn. 172.
112 Werthenbruch, DB (2014), 2875, (2877 f.).
113 HeckschenlBachmann, NZG 2015, 531, (536).
114 NJW 2015, 859, Rn. 17.
115 NJW 2015, 859, Rn. 17.
116 NJW 2015, 859, Rn. 17.
117 Werthebruch, DB 2014, 2875, (2878).
118 MünchKomm z. HGB/Schmidt, § 105 Rn. 150; NJW 2015, 859, Rn. 15.
119 Handelsgesetzbuch/We/remeyer, § 109 Rn. 20.
120 Giedinghagen/Fahl, DStR2007, 1965, (1966).
121 Giedinghagen/Fahl, DStR 2007, 1965, (1966).
122 Vgl. NJW 2015, 859, Rn. 15.
123 Vgl. NJW 2015, 859, Rn. 15.
124 Schmidt, ZIP (2009) 737, (738); NJW 2015, 859, Rn. 14.
125 MünchKomm z. BGB/Sc/7ärer, § 709 Rn. 90.
126 MünchKomm z. BGB/Sc/7ärer, § 709 Rn. 87.
127 MünchKomm z. BGB/Sc/7ärer, § 709 Rn. 87.
128 Handelsgesetzbuch/Werhenbruch, § 105 Rn. 92.
129 Handelsgesetzbuch/Werhenbruch, § 105 Rn. 96.
130 NJW 1979, 1705, (1706); NJW 1993, 3193, (3194).
131 NJW 2015, 859, Rn. 15.
132 NJW 2015, 859, Rn. 15.
133 MünchKomm z. HGBISchmidt, § 105 Rn. 114.
134 Fleischer, DB 2013, 1466, (1472).
135 Fleischer, DB 2013, 1466, (1474).
136 Fleischer, DB 2013, 1466, (1472).
137 Handkommentar z. BGB/Dorner/Schule, § 133 Rn. 8, 9.
138 MünchKomm z. HGB/Schmidt, § 105 Rn.150.
139 Handkommentar z. BGB/DörnerlSchule, § 133 Rn.10.
140 MünchHandbuch d. Gesellschaftsrechts Bd. VMöhrle, § 47 Rn. 19.
141 MAH PersGesR./von Unger, §12 Rn. 1.
142 MAH PersGesR./von Unger, §12 Rn. 4.
143 MAH PersGesR./von Unger, §12 Rn. 7.
144 MAH PersGesR./von Unger, §12 Rn. 15.
145 Wirtschaftlicher Wandel und Mittelstand/Sraab, s. 123, 127; Chancengleichheit für KMU Im globalen E-Buisiness/D/efma/r, s. 52; Lt. Website des IfM-Bonn, (Stand 2014).
146 Werthebruch, DB 2014, 2875, (2877).
147 NJW 1985, 972, (972 f.); NJW 1985, 974, (974 f.).
148 Priester, NZG 2015, 529, (531).
149 NJW2015, 859, Rn. 19; NJW 1995, 194, (195).
150 MAH PersGesR./Mutter/Angsten, § 1 Rn. 151.
151 Komm Z. HGBIKindler, § 109 Rn. 1.
152 Komm z. HGB IKindler, § 109 Rn. 2.
153 Komm z. BGB/Mansei, § 138 Rn. 3.
154 Komm z. BGB/Mansei, § 138 Rn. 3.
155 Komm z. BGB/Mansei, § 138 Rn. 3, 4.
156 Weber, DStR 2010, 702703) ל).
157 Gesellschaftsrecht/Servaf/us, § 707 Rn. 63.
158 Schäfer, ZGR 2013, 237, (255);
159 BGHZ 179, 13, Rn. 6; BGHZ 179, 13, Rn. 7.
160 NJW 2015, 859, Rn. 12, 13.
161 NJW 2015, 859, Rn. 19; NJW 1995, 194, (195).
162 Schmidt, ZGR2008, 1, (11 f.).
163 Schmidt, ZGR2008, 1, (11 f.).
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments?
Dieses Dokument analysiert den Wandel der Kontrolle von Mehrheitsbeschlüssen in Personenhandelsgesellschaften im deutschen Recht, insbesondere unter Berücksichtigung aktueller BGH-Entscheidungen wie "Otto", "Schutzgemeinschaftsvertrag II" und NJW 2015, 859.
Welche zentralen Entscheidungen werden in dem Dokument behandelt?
Die zentralen Entscheidungen sind die "Otto"-Entscheidung (BGHZ 170, 283), der "Schutzgemeinschaftsvertrag II" (BGHZ 179, 13) und die Entscheidung NJW 2015, 859. Diese Entscheidungen werden im Hinblick auf ihre Sachverhalte und ihre Auswirkungen auf das Kontrollsystem von Mehrheitsbeschlüssen analysiert.
Was war der Bestimmtheitsgrundsatz und warum ist er relevant?
Der Bestimmtheitsgrundsatz war ein Rechtsprinzip, das forderte, dass Mehrheitsklauseln in Gesellschaftsverträgen hinreichend bestimmt sein müssen, um den Gesellschaftern die Tragweite ihrer Unterwerfung unter eine Mehrheit zu verdeutlichen. Das Dokument beschreibt, wie der BGH diesen Grundsatz in der Rechtsprechung aufgegeben hat.
Was ist die Kernbereichslehre und welche Rolle spielte sie?
Die Kernbereichslehre schützte bestimmte wesentliche Gesellschafterrechte (Kernrechte) vor Eingriffen durch Mehrheitsbeschlüsse. Das Dokument erläutert, wie der BGH diese Lehre ebenfalls abgeschafft und durch eine neue Prüfformel ersetzt hat.
Welche neue Prüfformel hat der BGH eingeführt?
Der BGH hat die Kernbereichslehre durch eine neue Prüfformel ersetzt, nach der ein Eingriff in die individuelle Rechtsstellung eines Gesellschafters im Interesse der Gesellschaft geboten und dem betroffenen Gesellschafter unter Berücksichtigung seiner eigenen schutzwerten Belange zumutbar sein muss.
Wie hat sich die Auslegung von Mehrheitsklauseln verändert?
Früher wurden Mehrheitsklauseln restriktiv ausgelegt. Nunmehr erfolgt die Auslegung nach allgemeinen Auslegungsgrundsätzen der §§ 133, 157 BGB, wobei zwischen subjektiver und objektiver Auslegung unterschieden wird.
Was sind die Empfehlungen für die Kautelarpraxis?
Das Dokument gibt Empfehlungen für die Gestaltung von Gesellschaftsverträgen, um entweder eine sichere Mehrheitskompetenz oder einen totalen Minderheitenschutz zu gewährleisten. Es betont die Notwendigkeit klarer und unzweifelhafter Formulierungen.
Was ist die Bedeutung der antizipierten Zustimmung?
Im alten System war die antizipierte Zustimmung relevant für Eingriffe in Kernrechte. Im neuen System ist sie grundsätzlich entbehrlich, kann aber im Einzelfall im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung eine Rolle spielen. Für nachträgliche Beitragserhöhungen ist weiterhin eine antizipierte Zustimmung erforderlich.
Wie wirkt sich der Systemwechsel auf Altverträge aus?
Der neue Maßstab zur Bestimmung des Willens der Parteien kann durchaus zu anderen Ergebnissen als das vormalige System führen. Es wird darauf hingewiesen, dass Gesellschafter mit Altverträgen ihr Vertragswerk jener Rückwirkung anpassen müssten.
Welche Rolle spielt die Treuepflicht im neuen System?
Im neuen System wird jeder Beschluss auf eine Verletzung der Treuepflicht geprüft, unabhängig davon, ob ein Eingriff in Kernrechte vorliegt. Die Beweislastverteilung hat sich jedoch zugunsten der Mehrheit verschoben.
- Quote paper
- Philipp Mosig (Author), 2015, Kontrolle von Mehrheitsbeschlüssen in dem gesetzlichen Leitbild entsprechenden Personengesellschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/435335