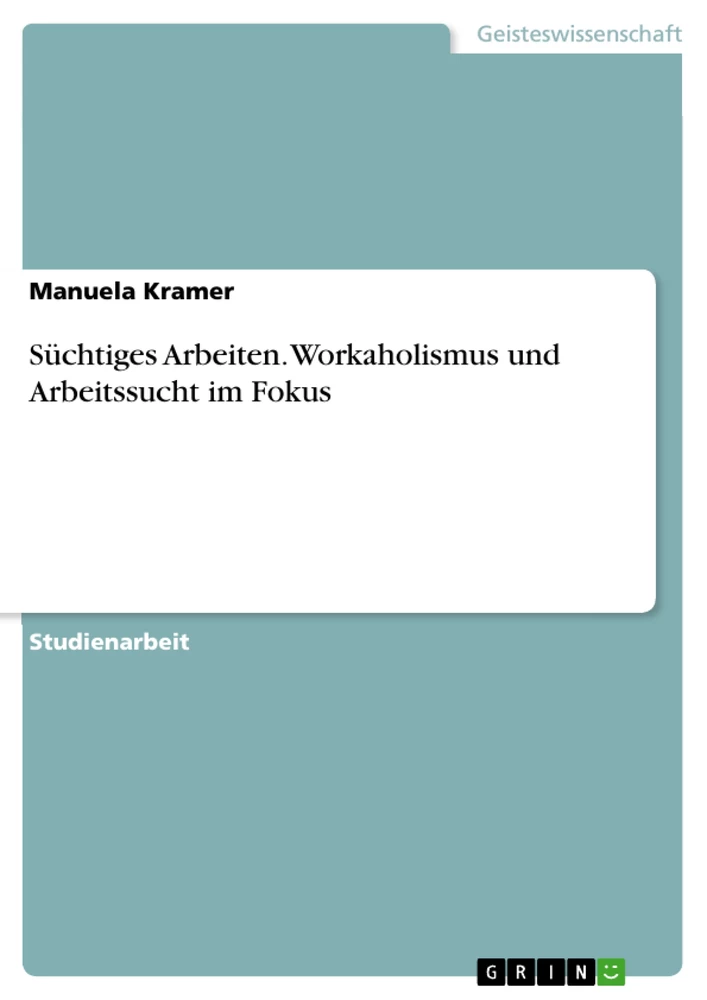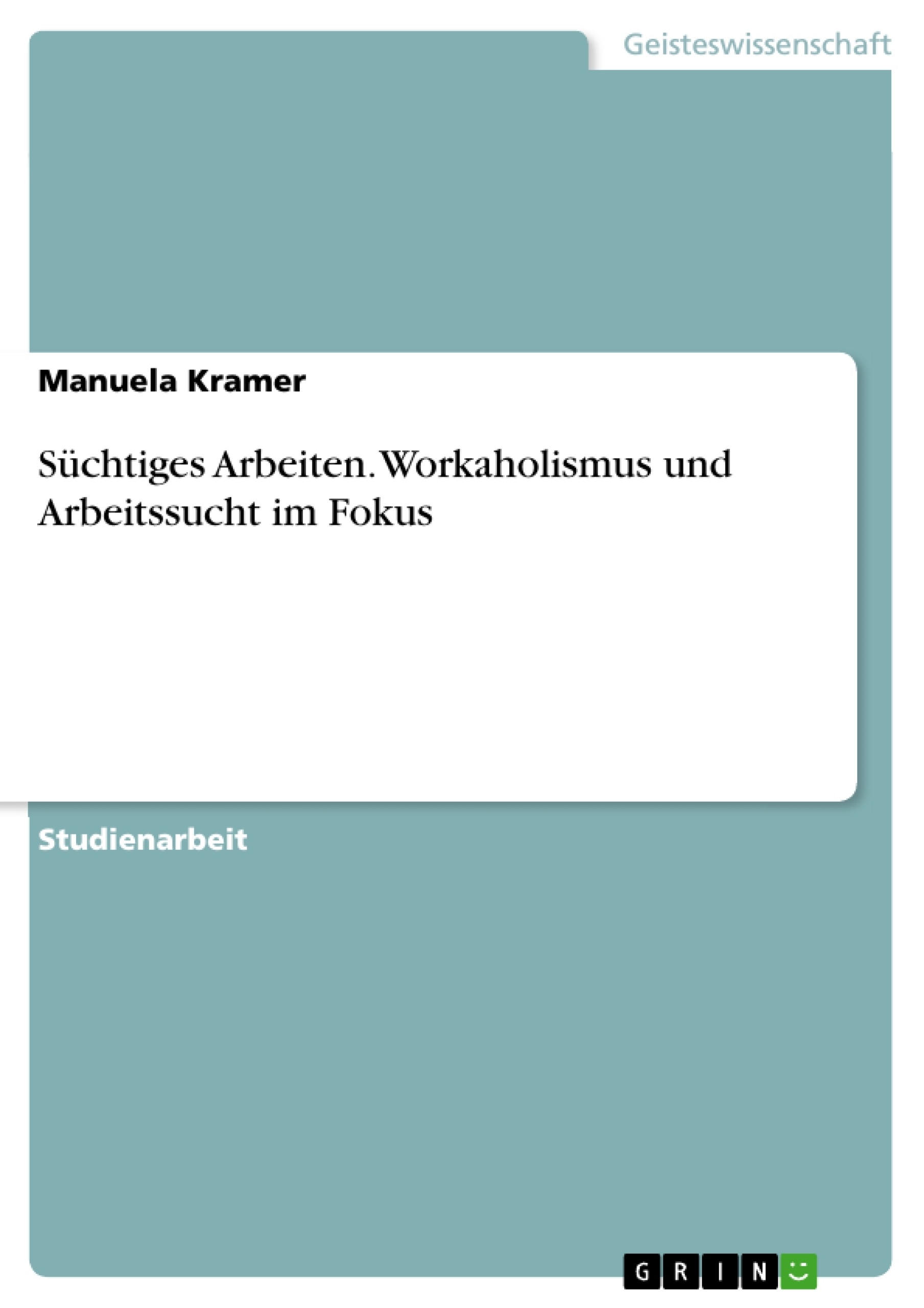Während Arbeitssucht als Phänomen längst bekannt ist, ist es gesellschaftlich noch nicht als Krankheit anerkannt. Auch in Expertenkreisen ist Workaholismus sehr umstritten und noch unzureichend erforscht. Wird Vielarbeiten gefördert und belohnt in unserer Gesellschaft, auch auf Kosten der Gesundheit und der sozialen Beziehungen? Widerspricht das Krankheitsbild der gängigen Moral, wie sie in Sprichwörtern wie ‚Arbeit adelt‘, ‚ohne Fleiß kein Preis‘ oder ‚Arbeit macht das Leben süß‘ zum Ausdruck kommt?
Besonders in Deutschland genießt Arbeit einen sehr hohen Stellenwert, werden doch v.a. den Deutschen die Tugenden Fleiß, Tüchtigkeit und Disziplin zugeschrieben. Es ist daher vielleicht besonders in Deutschland schwierig, Akzeptanz für dieses zwar weit verbreitete, nicht aber genügend beachtete und behandelte Phänomen zu schaffen. Während in anderen Ländern, z.B. Amerika die ,Anonymen Workaholics‘ als Selbsthilfegruppe für Arbeitssüchtige ins Leben gerufen wurde, ist diese Initiative in Deutschland noch relativ unbekannt.
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Arbeitssucht und stellt den hinter diesem Begriff verborgenen Sachverhalt dar bzw. erläutert ihn. Einführend werden einige wichtige Begriffe im Zusammenhang mit Arbeit, Sucht und Arbeitssucht definiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Arbeitssucht
- 2.1. Begriffsdefinitionen
- 2.2. Ursachen, Merkmale und Folgen der Arbeitssucht
- 2.3. Typologie der Arbeitssucht
- 2.4. Therapie der Arbeitssucht
- 3. Empirische Studien zur Arbeitssucht
- 3.1. Arbeitssucht und psychisches & physisches Wohlbefinden
- 3.2. Arbeitssucht und außerberufliche Zufriedenheit
- 3.3. Arbeitssucht und Arbeitszeit
- 3.4. Arbeitsbezogenheit und Arbeitszeit an der WISO
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Arbeitssucht (Workaholism) und beleuchtet die damit verbundenen Aspekte. Ziel ist es, den Begriff der Arbeitssucht zu definieren, Ursachen, Merkmale und Folgen zu beschreiben und empirische Studien dazu vorzustellen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Arbeitssucht“
- Ursachen und Merkmale von Arbeitssucht
- Folgen von Arbeitssucht für das psychische und physische Wohlbefinden sowie die außerberufliche Zufriedenheit
- Zusammenhang zwischen Arbeitssucht und Arbeitszeit
- Empirische Untersuchung zur Arbeitsbezogenheit und Arbeitszeit.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Arbeitssucht ein und stellt die gesellschaftliche Relevanz und den Forschungsstand dar. Es wird die Problematik der Anerkennung von Arbeitssucht als Krankheit in der Gesellschaft, insbesondere in Deutschland, angesprochen, im Gegensatz zu Ländern wie den USA, wo Selbsthilfegruppen bereits etabliert sind. Der Fokus liegt auf der Definition wichtiger Begriffe im Kontext von Arbeit, Sucht und Arbeitssucht und der Vorstellung des weiteren Aufbaus der Arbeit.
2. Arbeitssucht: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Begriff der Arbeitssucht. Es werden zunächst verschiedene Definitionen von Arbeit und Sucht vorgestellt und die Schwierigkeit, Arbeitssucht als pharmakologische Sucht einzuordnen, erläutert. Die drei klassischen Suchtkriterien (Kontrollverlust, Dosissteigerung, Entzugserscheinungen) werden im Kontext der Arbeitssucht diskutiert. Das Kapitel behandelt auch die Ursachen, Merkmale und Folgen von Arbeitssucht und bietet einen Einblick in verschiedene Typologien und Therapieansätze, z.B. die Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT).
Schlüsselwörter
Arbeitssucht, Workaholism, Sucht, psychisches Wohlbefinden, physisches Wohlbefinden, außerberufliche Zufriedenheit, Arbeitszeit, Empirische Studie, Typologie, Therapie, REBT.
Häufig gestellte Fragen zu: Arbeitssucht - Eine empirische Untersuchung
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Arbeitssucht (Workaholism). Sie definiert den Begriff, beschreibt Ursachen, Merkmale und Folgen und präsentiert empirische Studien dazu. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel über Arbeitssucht mit Unterkapiteln zu Definitionen, Ursachen, Merkmalen, Folgen, Typologien und Therapieansätzen, ein Kapitel mit empirischen Studien zu Arbeitssucht und psychischem/physischem Wohlbefinden, außerberuflicher Zufriedenheit und Arbeitszeit, sowie eine Zusammenfassung. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung von Arbeitssucht und der Erforschung des Zusammenhangs mit Arbeitszeit und Wohlbefinden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Definition und Abgrenzung des Begriffs „Arbeitssucht“, Ursachen und Merkmale von Arbeitssucht, Folgen von Arbeitssucht für das psychische und physische Wohlbefinden sowie die außerberufliche Zufriedenheit, den Zusammenhang zwischen Arbeitssucht und Arbeitszeit und eine empirische Untersuchung zur Arbeitsbezogenheit und Arbeitszeit.
Wie wird Arbeitssucht definiert?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Definitionen von Arbeit und Sucht und diskutiert die Schwierigkeit, Arbeitssucht als pharmakologische Sucht einzuordnen. Die drei klassischen Suchtkriterien (Kontrollverlust, Dosissteigerung, Entzugserscheinungen) werden im Kontext der Arbeitssucht diskutiert. Die Arbeit vergleicht auch die Anerkennung von Arbeitssucht als Krankheit in verschiedenen Ländern (z.B. Deutschland vs. USA).
Welche Ursachen, Merkmale und Folgen von Arbeitssucht werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Ursachen, Merkmale und Folgen von Arbeitssucht. Dies beinhaltet die Auswirkungen auf das psychische und physische Wohlbefinden sowie die außerberufliche Zufriedenheit. Verschiedene Typologien der Arbeitssucht werden vorgestellt.
Welche Therapieansätze werden erwähnt?
Die Arbeit gibt einen Einblick in verschiedene Therapieansätze zur Behandlung von Arbeitssucht, z.B. die Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT).
Welche empirischen Studien werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert empirische Studien zum Zusammenhang zwischen Arbeitssucht und psychischem & physischem Wohlbefinden, Arbeitssucht und außerberuflicher Zufriedenheit, Arbeitssucht und Arbeitszeit sowie zur Arbeitsbezogenheit und Arbeitszeit an einem Beispiel (WISO).
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Arbeitssucht, Workaholism, Sucht, psychisches Wohlbefinden, physisches Wohlbefinden, außerberufliche Zufriedenheit, Arbeitszeit, Empirische Studie, Typologie, Therapie, REBT.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, inklusive der Einleitung, welche die gesellschaftliche Relevanz und den Forschungsstand darlegt. Das Kapitel zur Arbeitssucht wird detailliert zusammengefasst, ebenso das Kapitel zu den empirischen Studien.
- Quote paper
- Manuela Kramer (Author), 2005, Süchtiges Arbeiten. Workaholismus und Arbeitssucht im Fokus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43512