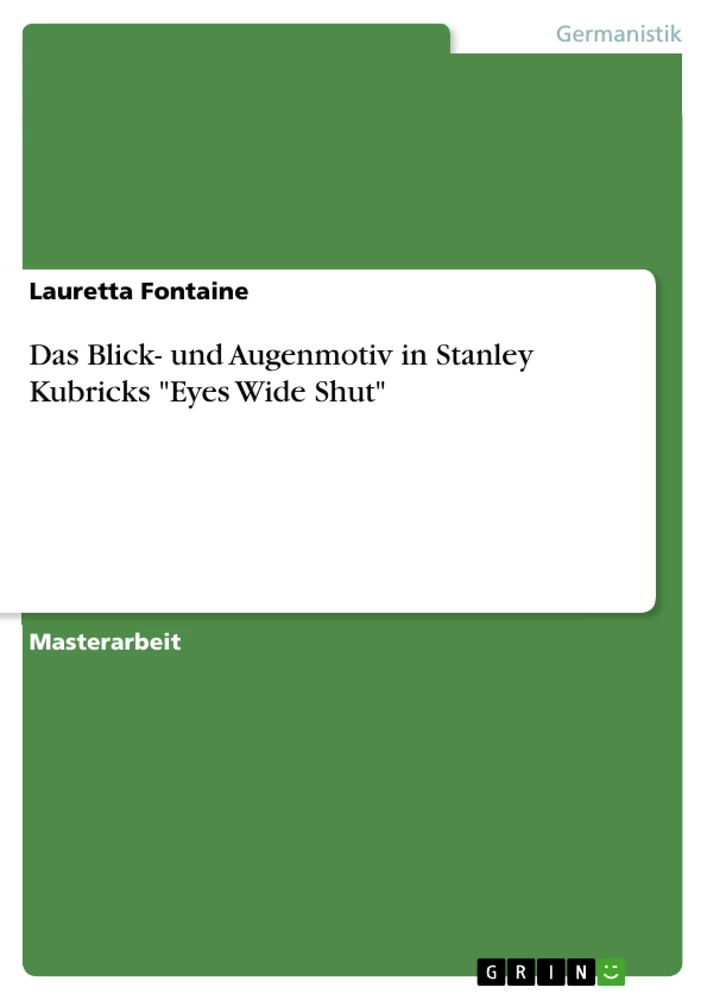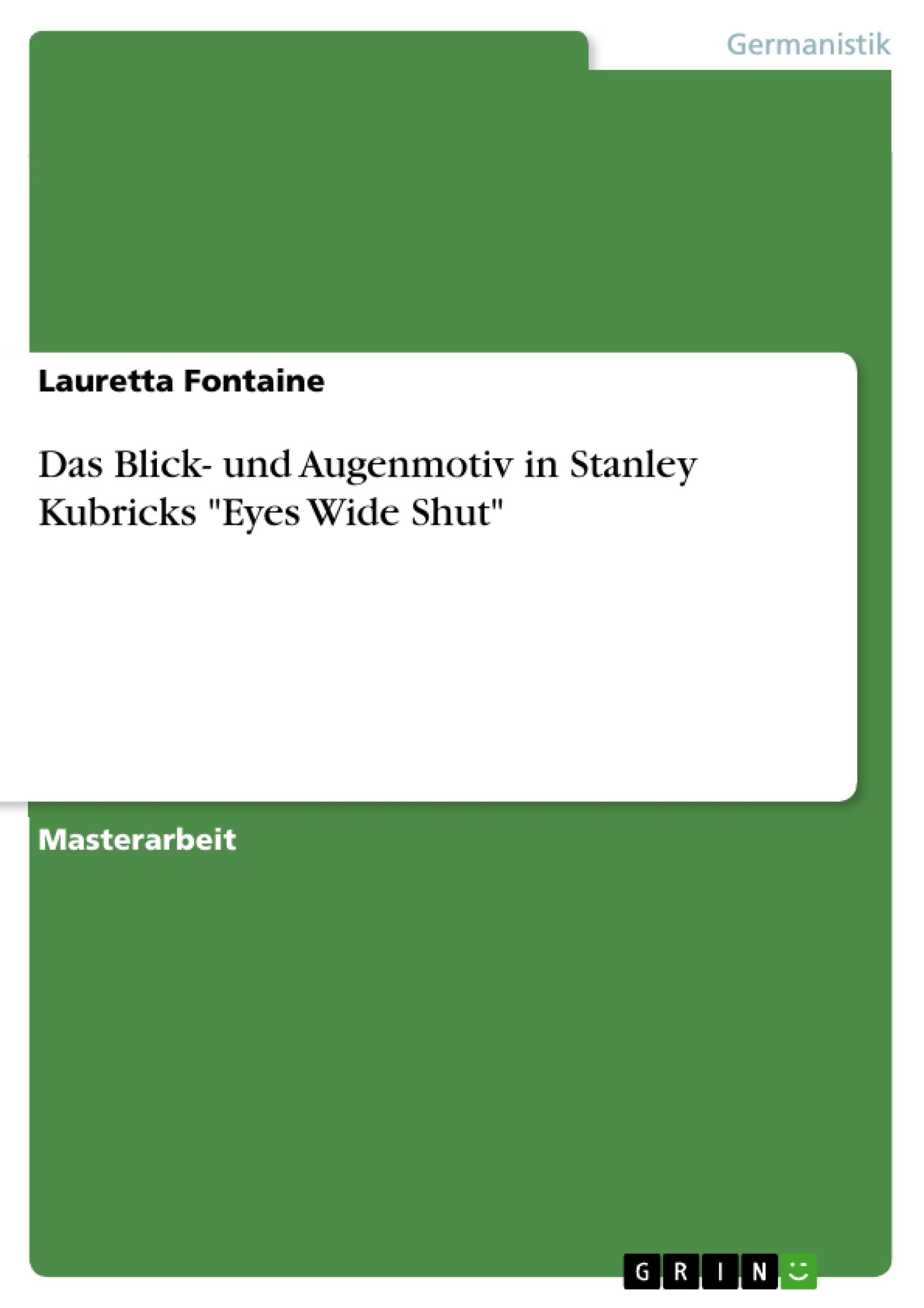„When I first experienced Eyes Wide Shut, it left me empty. I became Bill Harford, wandering the streets of a cardboard New York, desperately trying to connect with all that I was presented with on (and off) screen.” So beschreibt der Filmwissenschaftler Randolph Jordan die Wirkungsmacht des letzten, im Jahre 1999 posthum erschienen Filmes von Kult-Regisseur Stanley Kubrick. Zwölf Jahre hatte es gedauert bis die Verfilmung von Arthur Schnitzlers Traumnovelle aus dem Jahre 1925 in die Kinos kam. Eyes Wide Shut ist keine klassische Adaption, sondern mehr eine Neuinterpretation von Schnitzlers Prosaerzählung.
In den Fokus rückt ein grundlegender Diskurs „über das Sehen, den Film und das Kino.“ Kubrick verlagert den Plot aus dem Wien der 1920er Jahre in das moderne New York und wählt in der Besetzung das damalig verheiratete Hollywood-Paar Nicole Kidman und Tom Cruise. Die filmische Handlung kreist um den Arzt Bill Harford und seine Frau Alice. Ihre Ehe gerät in eine Krise als Alice ihrem Mann offenbart, dass sie ihre Familie für außerehelichen Sex mit einem Marineoffizier verlassen hätte. Für Bill beginnt daraufhin eine nächtliche Odyssee durch die Straßen von New York, die in einem Alptraum endet. Er landet auf einer Party, auf der „die oberen Zehntausend, hinter venezianischen Masken verborgen, eine Orgie“ feiern. Bill wird als Eindringling entlarvt und von den „geheimnisvollen, Sexspielchen‘“ ausgeschlossen. Er entgeht nur knapp dem Tod und kehrt zu Alice zurück.
Der genderthematische Diskurs von Laura Mulvey über männlich besetzte Schaulust und die Objektivierung der Frau rückt in den Fokus des Films. Wie setzt Kubrick die filmischen Mittel ein, um das Motiv von Blick und Auge aufzuzeigen? Welche Bedeutung hat die Motivik auf der Figurenebene? Und wie gelingt ihm die Einbindung des Zuschauers? Diesen und weiteren Fragen soll in der hier vorliegenden Arbeit nachgegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Der Regisseur Stanley Kubrick und sein Film Eyes Wide Shut
- Leben und Werk
- Themen und Motive
- Rezeption von Eyes Wide Shut
- Inhalt des Films Eyes Wide Shut
- Theoretische Grundlagen
- Das Augenmotiv
- Die Geschichte und Bedeutung des Augenmotivs
- Voyeurismus und das Auge im Kino
- Das Blickmotiv
- Sigmund Freud: Ödipuskomplex und Kastrationskomplex
- Sigmund Freud: Fetischismus
- Sigmund Freud: Der Begriff der Skopophilie
- Laura Mulvey: Visuelle Lust und narratives Kino
- Jacques Lacan: Das Blickmodell
- Die Maske: Zwischen Schaulust und Scham
- Das Augenmotiv
- Das Blick- und Augenmotiv in Stanley Kubricks Eyes Wide Shut
- Alices Enthüllung
- Im Badezimmer der Harfords
- Die Prostituierte auf Zieglers Weihnachtsfeier
- Das Vorspiel im Spiegel
- Alices Geständnis
- Rainbow Fashions und die Orgienfeier
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit widmet sich dem Blick- und Augenmotiv in Stanley Kubricks Film "Eyes Wide Shut". Der Fokus liegt auf der Analyse der filmischen Mittel, mit denen Kubrick das Motiv von Blick und Auge aufzeigt, sowie auf der Bedeutung dieser Motivik auf der Figurenebene. Darüber hinaus wird untersucht, wie Kubrick den Zuschauer in sein System mit einbezieht.
- Die Bedeutung des Augenmotivs in Kubricks Film im Kontext der Geschichte und Bedeutung des Motivs
- Der Einfluss von Sigmund Freuds Theorien, insbesondere Ödipuskomplex, Kastrationskomplex und Fetischismus, auf das Blickmotiv im Film
- Die Rolle von Laura Mulveys Theorie der visuellen Lust und der männlich besetzten Schaulust im Film
- Die Anwendung von Jacques Lacans Blickmodell im Film
- Die Bedeutung der Maske als Symbol der Schaulust und Scham
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Wirkungsmacht von Stanley Kubricks "Eyes Wide Shut". Es werden die zentralen Themen des Films, die Beziehung zwischen Traum und Realität, Begehren von Mann und Frau und die Frage nach der Liebe, vorgestellt.
Das Kapitel "Forschungsstand" gibt einen Überblick über die medienwissenschaftliche Literatur zu Stanley Kubrick und seinen Filmen, insbesondere im Hinblick auf das Augenmotiv. Es werden wichtige Werke, die sich mit Kubricks Leben und Werk sowie den Motiven in seinen Filmen auseinandersetzen, vorgestellt.
Das Kapitel "Der Regisseur Stanley Kubrick und sein Film Eyes Wide Shut" beleuchtet Kubricks Leben und Werk, seine Themen und Motive sowie die Rezeption von "Eyes Wide Shut". Es wird eine kurze Inhaltsangabe des Films gegeben, wobei der Fokus auf die Beziehung zwischen Bill und Alice Harford und Bills nächtliche Odyssee durch New York liegt.
Im Kapitel "Theoretische Grundlagen" werden die beiden Motive Auge und Blick differenziert betrachtet. Zunächst wird die Geschichte des Augenmotivs vorgestellt und in den kinematographischen Kontext eingeordnet. Anschliessend wird auf Freuds Theorien, insbesondere den Ödipus- und Kastrationskomplex und dem damit verbundenen Begriff des Fetischismus eingegangen. Daraus resultiert der Begriff der Skopophilie, der in diesem Kapitel dargestellt wird. Anschliessend wird das Blickmodell von Lacan sowie der männlich geprägte Blick nach Mulvey vorgestellt. Zum Schluss wird der Schambegriff unter Einbeziehung des Motivs der Maske erläutert.
Das Kapitel "Das Blick- und Augenmotiv in Stanley Kubricks Eyes Wide Shut" verknüpft die in den vorherigen Kapiteln dargestellten theoretischen Grundlagen mit ausgewählten Szenen des Films. Es werden die Motivik von Auge und Blick analysiert und die Bedeutung der einzelnen Szenen im Kontext des Films beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, Blickmotiv, Augenmotiv, Voyeurismus, Schaulust, Scham, Sigmund Freud, Ödipuskomplex, Kastrationskomplex, Fetischismus, Skopophilie, Laura Mulvey, Jacques Lacan, Maske, Film, Kino.
- Quote paper
- Lauretta Fontaine (Author), 2018, Das Blick- und Augenmotiv in Stanley Kubricks "Eyes Wide Shut", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/434764