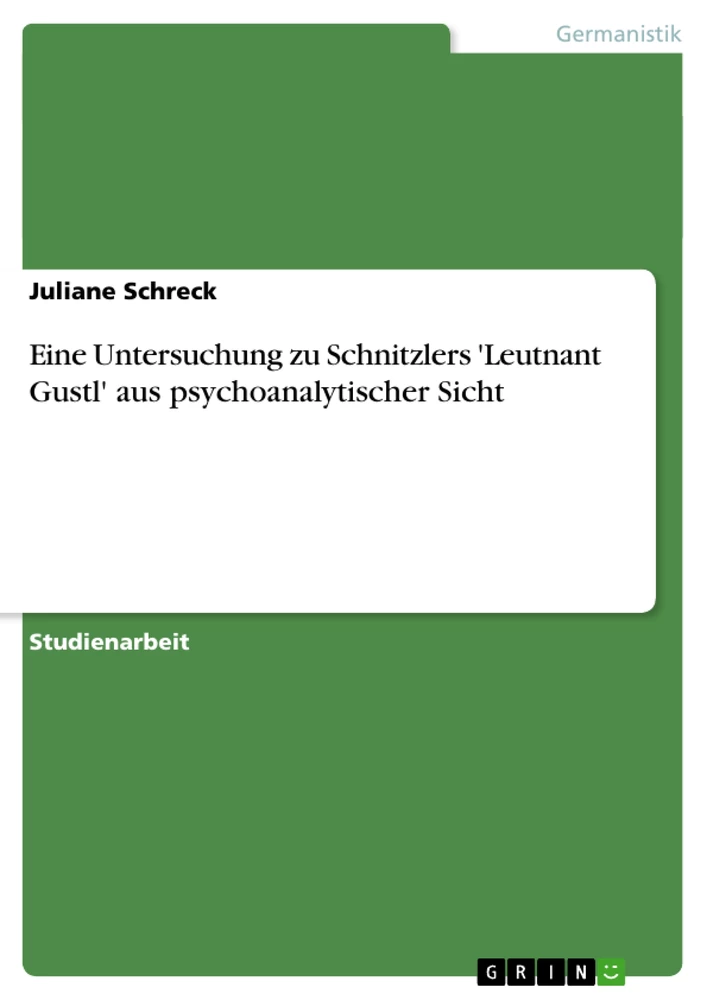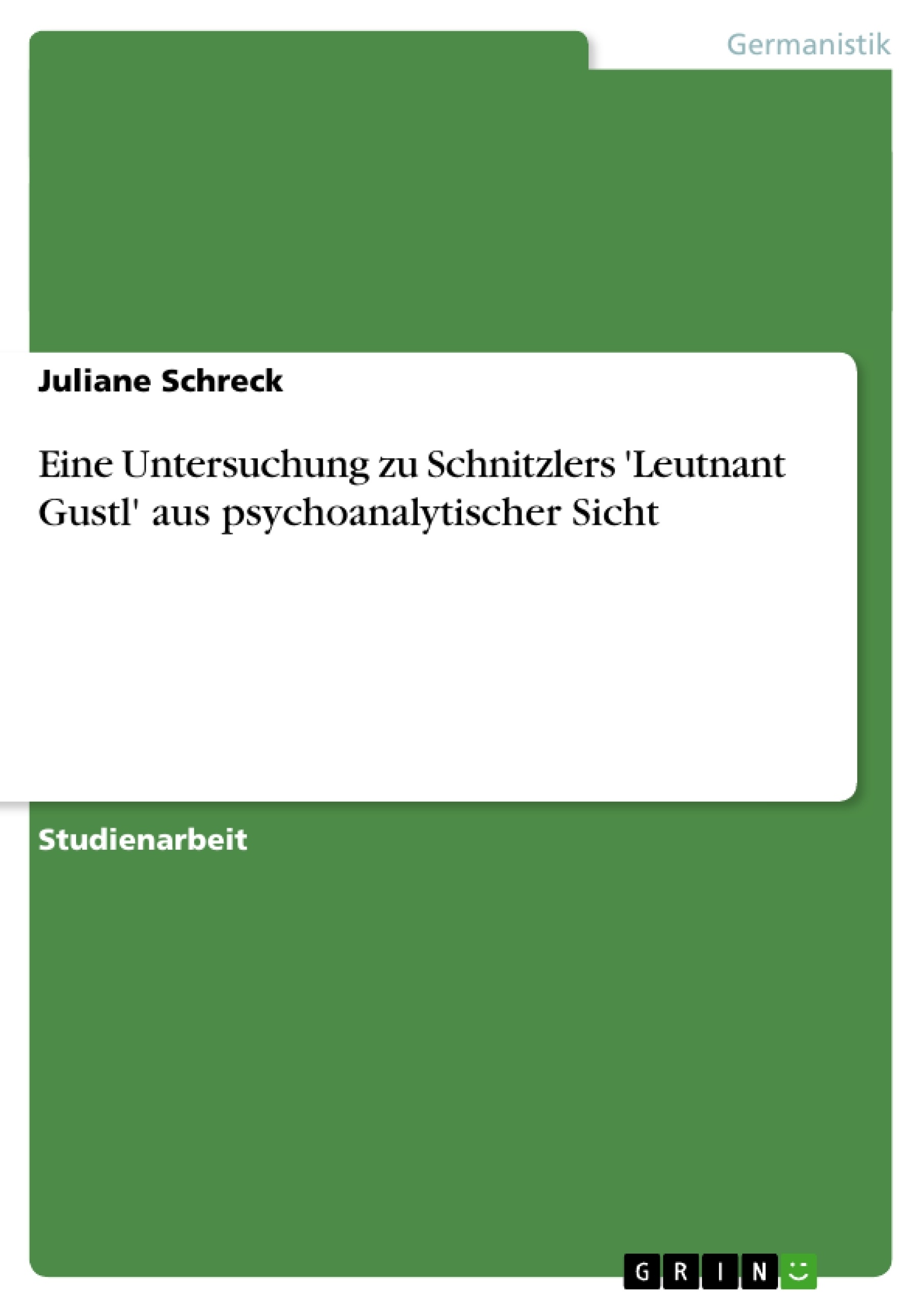„Die alte Psychologie hat die Resultate der Gefühle, wie sie sich am Ende im Bewusstsein ausdrücken, aus dem Gedächtnis gezeichnet; die neue zeichnet die Vorbereitungen der Gefühle, bevor sie sich noch ins Bewusstsein hinein entschieden haben.“
Dies schrieb Bahr 1891 und schuf damit die theoretische Basis für das Schaffen von Arthur Schnitzler, der neun Jahre später seinen „Leutnant Gustl“ veröffentlichen sollte. Schnitzler absolvierte ein Medizinstudium, welches er mit der Promotion abschloss und wandte sich der Literatur zu. Auf beiden Gebieten faszinierte ihn die Auseinandersetzung mit dem Inneren der Menschen, den seelischen Befindlichkeiten.
„Die „Ich-Form“ reicht also nicht mehr aus, weil sie das Nervöse gerade weglässt, und die fachmännische „Ich-Form“ kann höchstens eine Not-Unterkunft gewähren, bis dem Bedürfnisse eine verlässlichere Heimstätte gesichert ist. Diese Methode, das Unbewusste auf den Nerven, in den Sinnen, vor dem Verstande, zu objektivieren, verlangt das ganze Geschrei nach der neuen Psychologie.“ Es kam Schnitzler darauf an, von seinem „Leutnant Gustl“ ein Bewusstseinsprotokoll anzufertigen. Er legte durch Erweiterung und Ausbau der Versuche Dujardins und Garsins eine Erzählform vor, die als „literarisches Psychogramm" bezeichnet werden kann: den Inneren Monolog.
Es fasziniert mich, Einblick in ein literarisches Werk zu bekommen, in dem neben der meisterlichen Erzählkunst Aspekte aus der Anfangsphase der Psychoanalyse um 1900 zu finden sind. Das Werk ist weder nur ein literarisches, noch ein vollkommen wissenschaftliches. Beides ergänzt sich zu einer bemerkenswerten literarischen Arbeit mit wissenschaftlichen Elementen.
Ziel dieser Arbeit soll es deshalb sein, das Werk aus beiden Blickwinkeln zu betrachten. Im ersten Teil wird das Verhältnis von Schnitzler und Freud untersucht, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufdecken zu können. Die darauf folgende Charakteristik der Hauptfigur des Werkes stellt im Überblick den heutigen Forschungsstand zum „Leutnant Gustl“ dar und geht auf die sozialen Systeme, die Familie und die Armee ein, mit denen Gustl fest verbunden ist. Daraufhin wird kurz der innere Monolog näher beleuchtet.
Als besonders interessant erscheint die Frage, inwieweit Gustl als Hysteriker gesehen werden kann. Es werden neue Thesen entwickelt und auf ihre Brauchbarkeit untersucht.
Ein Nachwort fasst die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Freud und Schnitzler – Doppelgänger oder Kontrahenten?
- 2. Charakteristik Gustl's
- 2.1 Die Rolle der Familie
- 2.2 Die Rolle des Militärs
- 2.3 Die Rolle des Duellwesens
- 2.4 Gustls Begehren
- 3. Innerer Monolog – Sprache des Unbewussten?
- 4. Gustl als Hysteriker
- Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Arthur Schnitzlers "Leutnant Gustl" aus psychoanalytischer Sicht. Sie analysiert das Werk aus literarischer und wissenschaftlicher Perspektive, um die Bedeutung des Inneren Monologs und die psychoanalytischen Elemente aufzudecken. Die Arbeit möchte das Verhältnis von Schnitzler und Freud untersuchen und die Rolle der Psychoanalyse in Schnitzlers Werk beleuchten.
- Das Verhältnis von Schnitzler und Freud
- Die psychoanalytische Interpretation von "Leutnant Gustl"
- Die Rolle der Familie, des Militärs und des Duellwesens im Leben von Gustl
- Gustls Begehren und der innere Monolog als Ausdruck des Unbewussten
- Die Frage, ob Gustl als Hysteriker interpretiert werden kann
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die theoretische Grundlage für die Arbeit dar und führt in das Thema der psychoanalytischen Betrachtung von "Leutnant Gustl" ein. Sie beleuchtet die Bedeutung des Inneren Monologs und den Einfluss der Psychoanalyse auf Schnitzlers Schaffen.
Kapitel 1 analysiert das Verhältnis von Freud und Schnitzler, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Hinblick auf ihre Ansichten über die Psychoanalyse und die Rolle des Unbewussten herausgearbeitet werden. Es wird deutlich, dass Schnitzler sich intensiv mit Freuds Theorien auseinandersetzte, jedoch auch eigene Wege in der Erforschung des menschlichen Bewusstseins beschritt.
Kapitel 2 widmet sich der Charakterisierung der Hauptfigur "Leutnant Gustl". Es werden die sozialen Systeme, die Familie und die Armee, analysiert, die Gustl prägen und seine psychischen Konflikte beeinflussen. Darüber hinaus werden seine Beweggründe und sein Begehren im Kontext seiner sozialen Umgebung betrachtet.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem inneren Monolog als sprachlicher Ausdruck des Unbewussten. Schnitzlers innovative Erzähltechnik wird in Bezug auf die psychoanalytische Interpretation von "Leutnant Gustl" untersucht.
Kapitel 4 stellt die Frage, inwieweit Gustl als Hysteriker betrachtet werden kann. Es werden neue Thesen entwickelt und anhand von analytischen Werkzeugen geprüft.
Schlüsselwörter
Psychoanalyse, Arthur Schnitzler, "Leutnant Gustl", Innerer Monolog, Bewusstsein, Unbewusstes, Freud, Familie, Militär, Duellwesen, Begehren, Hysterie, Literatur, Wissenschaft
- Quote paper
- Juliane Schreck (Author), 2002, Eine Untersuchung zu Schnitzlers 'Leutnant Gustl' aus psychoanalytischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43386