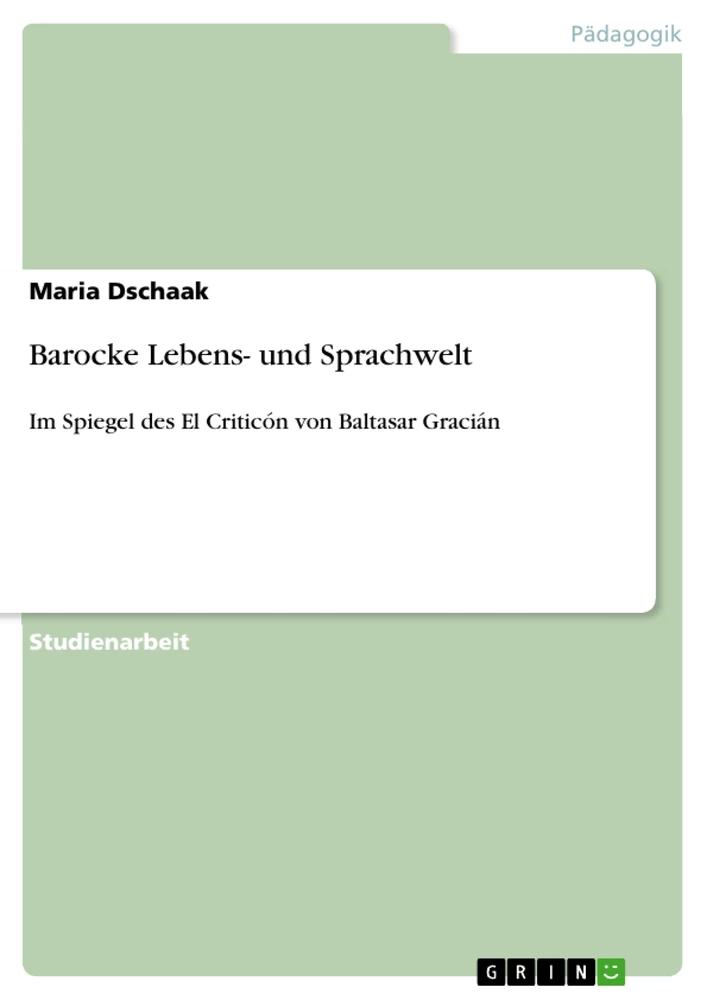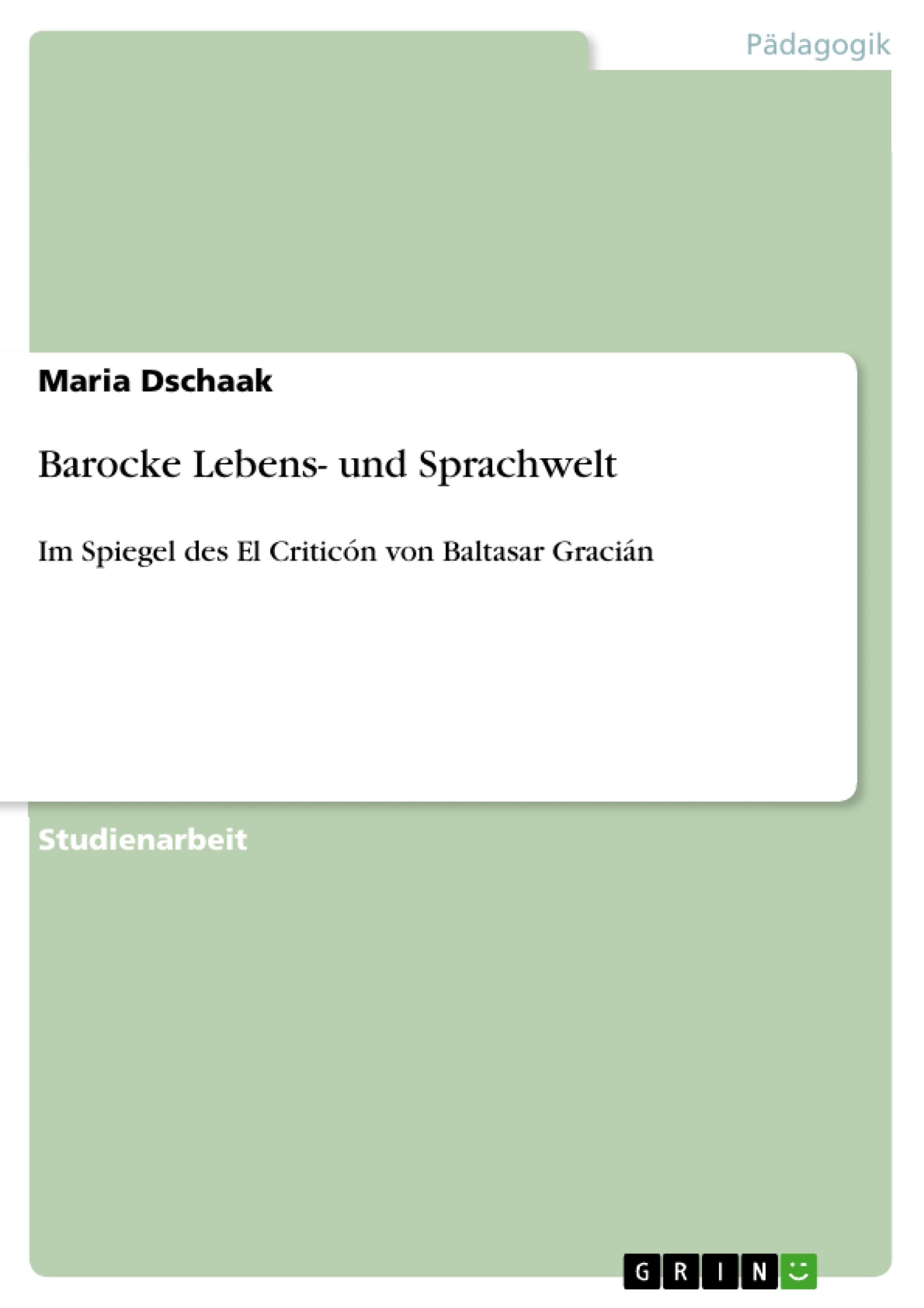Die folgende Studie widmet sich nun einem Werk, das in der Glanzzeit der Rhetorik entstanden ist und zu den Klassikern der spanischen Barockliteratur gehört. Obwohl sich der eigentliche Handlungsfaden des El Criticón von Baltasar Gracián in wenigen Worten wiedergeben lässt, entzieht sich dieses Werk einer eindeutigen Gattungszuweisung. Die gattungstypologische Zuordnung als Roman ist aufgrund seiner Handlungsarmut und seiner Fülle an allegorischen Figuren problematisch. Diese lassen das Werk eher als eine Satire auf seine Zeit und die Welt begreifen.
Durch das Motiv des Schiffbruchs und der Suche Critilos nach seiner verlorenen Geliebten eröffnen sich zusätzlich Parallelen zum heliodorschen Roman. Eine Auseinandersetzung mit Gracián und El Criticón fordert auch immer schon eine Auseinandersetzung mit der Geisteswelt des Barock und seiner Bildlichkeit. Daher widmet sich diese Studie zunächst der Weltanschauung des Barocks, um dann im Folgenden Graciáns Umgang mit dem epochalen Gedankengut in Form von unterschiedlichen Darstellungen von bestimmten Topoi zum Gegenstand zu machen. Daraufhin finden Graciáns poethologisches Konzept und seine sprachtheoretischen Reflexionen Erwähnung, die das Fundament der in 3.3 aufgeführten sprachlichen und stilistischen Merkmale bilden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Barock
- 2.1 Epochale Charakteristika
- 2.2 Funktion der Sprache und Rhetorik
- 3. Baltasar Gracián: El Criticón
- 3.1 Topik
- 3.1.1 Topos des teatrum mundi
- 3.1.2 Topos der verkehrten Welt
- 3.2 Poethologische Konzepte: agudeza und concepto
- 3.3 Sprachliche und stilistische Merkmale
- 3.3.1 Metapher und Allegorie
- 3.3.2 Wortspiele
- 3.3.3 Die Antithese
- 3.3.4 Semantik versus Syntax
- 3.1 Topik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie befasst sich mit dem Werk „El Criticón“ von Baltasar Gracián, einem bedeutenden Vertreter der spanischen Barockliteratur. Sie analysiert die Bedeutung der Rhetorik in Graciáns Werk und setzt dieses in den Kontext der Barockzeit und ihrer Weltsicht. Darüber hinaus werden Graciáns poethologische Konzepte und sprachtheoretische Reflexionen untersucht.
- Die Rolle der Rhetorik im spanischen Barock
- Die Weltanschauung des Barock
- Graciáns Nutzung von Topoi in „El Criticón“
- Graciáns poethologische Konzepte
- Sprachliche und stilistische Merkmale in „El Criticón“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung der Rhetorik in der Geschichte der Literatur und öffentlichen Kommunikation dar. Sie beleuchtet die Entwicklung der Redelehre von der Antike bis zur Neuzeit und verdeutlicht ihre Bedeutung für die literarische Produktion. Anschließend wird die Epoche des Barock als Hintergrund für Graciáns Werk „El Criticón“ eingeführt.
Kapitel 2 beleuchtet die charakteristischen Merkmale des Barock, wobei der Fokus auf der Weltanschauung dieser Epoche und der Funktion der Rhetorik liegt. Das Gleichnis vom „Theatrum mundi“ wird als zentrales Element der barocken Weltsicht vorgestellt.
Kapitel 3 analysiert Graciáns Werk „El Criticón“. Es werden die Topik des Textes, seine poethologischen Konzepte und seine sprachlichen und stilistischen Merkmale untersucht. Dabei werden die Metaphern, Allegorien, Wortspiele, Antithesen und die Beziehung zwischen Semantik und Syntax in Graciáns Werk beleuchtet.
Schlüsselwörter
Barock, Rhetorik, Baltasar Gracián, El Criticón, Topos, Poethologie, Sprachliche Merkmale, Stilistische Merkmale, Metapher, Allegorie, Antithese, Semantik, Syntax.
- Citar trabajo
- Maria Dschaak (Autor), 2008, Barocke Lebens- und Sprachwelt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/433608