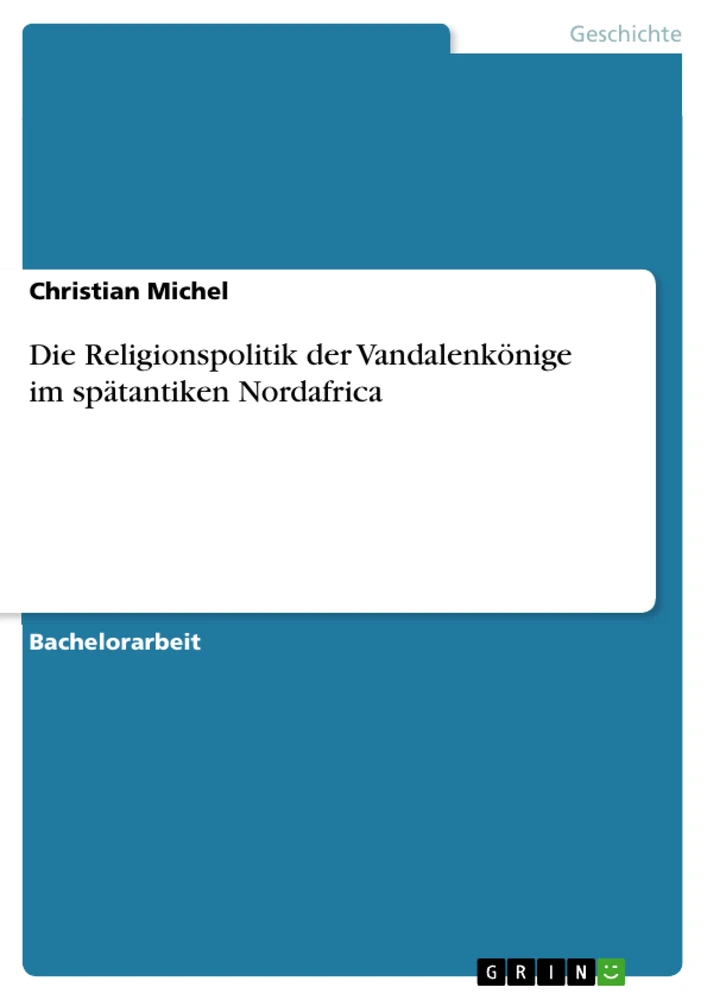Mit der Eroberung Karthagos und der Gefangennahme König Gelimers durch oströmische Truppen unter dem magister militum Belisar endete im Jahr 534 die Herrschaft der Vandalen in Nordafrica. Mit ihren Spuren verlieren sich auch die der arianischen Kirche. War zuvor die katholische Kirche jahrzehntelang den Repressionen der vandalischen Herrscher ausgesetzt, verkehrten sich die Verhältnisse nun in das genaue Gegenteil. So verfügte Kaiser Justinian, dass der Besitz der arianischen völlig in den der katholischen Kirche übergehen sollte, gleichzeitig wurde den Arianern die freie Religionsausübung untersagt. Die Geschehnisse verdeutlichen dabei eindrücklich, wie eng die vandalische Herrschaft mit dem Arianismus verbunden war. Diese Tatsache lässt aber gleichzeitig die Frage nach der Bedeutung der Religion für das Vandalenreich aufkommen. So ist es ja gerade die Religionspolitik der Vandalenkönige, die in der Forschung bis heute extrem kontrovers diskutiert wird und in vielen Punkten überhaupt noch nicht thematisiert wurde. An diese Diskussion möchte die vorliegende Arbeit anknüpfen und die Religionspolitik der vandalischen Könige analysieren. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, welche Faktoren die Religionspolitik der Herrscher bestimmten. Zunächst soll dafür nach den Motiven der Könige selbst gefragt werden. Welche Ziele verfolgten sie mit ihrer Religionspolitik und welche Folgen hatte diese für die eigene Herrschaft? Die Ergebnisse gilt es dann den individuellen Handlungsspielräumen der Könige gegenüberzustellen, die sich durch außen wie innenpolitische Entwicklungen veränderten. Im Zentrum steht dabei die Frage, welche Akteure die Religionspolitik beeinflussten und welche Rolle gerade die arianische Kirche und ihr katholisches Pendant dabei spielten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Einstieg und Fragestellung
- 2. Die Religionspolitik der Vandalenkönige in Quellen und Forschung
- 2.1. Quellenkritische Betrachtungen
- 2.2. Die Religionspolitik der Vandalenkönige in der Forschung
- 3. Aufbau der Arbeit
- II. Geiserichs Erbe
- 1. Religionspolitische Maßnahmen Geiserichs
- 1.1. Von der Überfahrt nach Africa bis zur Eroberung Karthagos
- 2.1. Von der Eroberung Karthagos bis zum Tod Geiserichs
- 2. Die arianische Kirche als eigenständiger Akteur?
- III. Die Religionspolitik Hunerichs: Geschichte einer Verfolgung?
- 1. Anfängliche Politik des Ausgleichs
- 2. Die Verfolgung unter Hunerich und Geiserichs Thronfolgeordnung
- 3. Das Religionsgespräch von 484 und die Rolle der arianischen Geistlichkeit
- IV. Die Religionspolitik Gunthamunds, Thrasamunds und Hilderichs - Ein Ausblick
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Religionspolitik der vandalischen Könige in Nordafrika. Ziel ist es, die Faktoren zu identifizieren, welche die Religionspolitik der Herrscher bestimmten, sowohl ihre eigenen Motive und Ziele als auch die Auswirkungen auf ihre Herrschaft. Die Arbeit untersucht die Handlungsspielräume der Könige im Kontext innen- und außenpolitischer Entwicklungen und beleuchtet die Rolle verschiedener Akteure, insbesondere der arianischen und katholischen Kirche.
- Motive und Ziele der vandalischen Könige in ihrer Religionspolitik
- Einfluss der arianischen und katholischen Kirche auf die Religionspolitik
- Handlungsräume der Könige im Kontext innen- und außenpolitischer Entwicklungen
- Auswirkungen der Religionspolitik auf die Herrschaft der Vandalen
- Analyse der verfügbaren Quellen und deren Limitationen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Religionspolitik der Vandalenkönige ein und stellt die Forschungsfrage nach den Faktoren, die diese Politik bestimmten. Sie beleuchtet das Ende der vandalischen Herrschaft im Jahr 534 und die damit verbundene Ablösung der arianischen Kirche durch die katholische Kirche. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und betont die kontroverse und bisher unzureichend erforschte Natur der Religionspolitik der Vandalen.
II. Geiserichs Erbe: Dieses Kapitel untersucht die religionspolitischen Maßnahmen Geiserichs, beginnend mit seiner Ankunft in Afrika bis zu seinem Tod. Es analysiert seine Politik im Kontext der Eroberung Karthagos und der Herausforderungen, die sich aus dem Umgang mit der katholischen Mehrheit der Bevölkerung ergaben. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, inwieweit die arianische Kirche als eigenständiger Akteur die Politik Geiserichs beeinflusste oder von ihm instrumentell genutzt wurde.
III. Die Religionspolitik Hunerichs: Geschichte einer Verfolgung?: Das Kapitel befasst sich mit der Religionspolitik von Hunerich, seinem anfänglichen Versuch eines Ausgleichs zwischen Arianern und Katholiken, und der darauf folgenden Verfolgung der katholischen Kirche. Es analysiert die Hintergründe, das Ausmaß und die Folgen dieser Verfolgung und untersucht die Rolle des Religionsgesprächs von 484 und die Position der arianischen Geistlichkeit in diesem Kontext. Das Kapitel hinterfragt die Darstellung Victors von Vita und relativiert den Aspekt des reinen "Katholikenhasses".
IV. Die Religionspolitik Gunthamunds, Thrasamunds und Hilderichs - Ein Ausblick: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über die Religionspolitik der Nachfolger Geiserichs und Hunerichs. Es skizziert die Kontinuitäten und Brüche in der Religionspolitik unter diesen Königen, ohne jedoch in detaillierte Analysen einzugehen. Es dient als Brücke zum Fazit und der Zusammenfassung der gesamten Thematik.
Schlüsselwörter
Religionspolitik, Vandalen, Nordafrika, Arianismus, Katholizismus, Geiserich, Hunerich, Quellenkritik, Victor von Vita, Herrschaft, Religionskonflikt, Innenpolitik, Außenpolitik, römische Quellen, kirchliche Akteure.
Häufig gestellte Fragen zur Religionspolitik der Vandalenkönige in Nordafrika
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Religionspolitik der vandalischen Könige in Nordafrika vom Ende des 5. bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf den Faktoren, die diese Politik bestimmten, den Motiven und Zielen der Herrscher sowie den Auswirkungen auf ihre Herrschaft. Es werden die Handlungsspielräume der Könige im Kontext innen- und außenpolitischer Entwicklungen beleuchtet, und die Rolle verschiedener Akteure, insbesondere der arianischen und katholischen Kirche, wird untersucht.
Welche Könige werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Religionspolitik von Geiserich, Hunerich, Gunthamund, Thrasamund und Hilderich. Die Analyse von Geiserich und Hunerich ist dabei besonders detailliert, während die Herrschaft der anderen Könige einen kürzeren Überblick bietet.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die verfügbaren Quellen, inklusive römischer Quellen und der Schriften von Autoren wie Victor von Vita. Die Quellenkritik spielt eine wichtige Rolle, und die Limitationen der Quellen werden explizit angesprochen.
Welche Hauptthemen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Motive und Ziele der vandalischen Könige in ihrer Religionspolitik, den Einfluss der arianischen und katholischen Kirche, die Handlungsspielräume der Könige im Kontext der innen- und außenpolitischen Lage, die Auswirkungen der Religionspolitik auf die Herrschaft der Vandalen und die Analyse der verfügbaren Quellen und ihrer Limitationen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, ein Kapitel zu Geiserichs Erbe, ein Kapitel zur Religionspolitik Hunerichs, ein Kapitel zu den nachfolgenden Königen und ein Fazit. Jedes Kapitel untersucht spezifische Aspekte der Religionspolitik der jeweiligen Herrscher.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der Religionspolitik der Vandalenkönige zu liefern, indem sie die komplexen Wechselwirkungen zwischen religiösen, politischen und gesellschaftlichen Faktoren untersucht. Sie hinterfragt vereinfachende Darstellungen und relativiert beispielsweise die Vorstellung eines reinen "Katholikenhasses" unter Hunerich.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Religionspolitik, Vandalen, Nordafrika, Arianismus, Katholizismus, Geiserich, Hunerich, Quellenkritik, Victor von Vita, Herrschaft, Religionskonflikt, Innenpolitik, Außenpolitik, römische Quellen, kirchliche Akteure.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Welche Faktoren bestimmten die Religionspolitik der vandalischen Könige in Nordafrika?
- Quote paper
- Christian Michel (Author), 2015, Die Religionspolitik der Vandalenkönige im spätantiken Nordafrica, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/433467