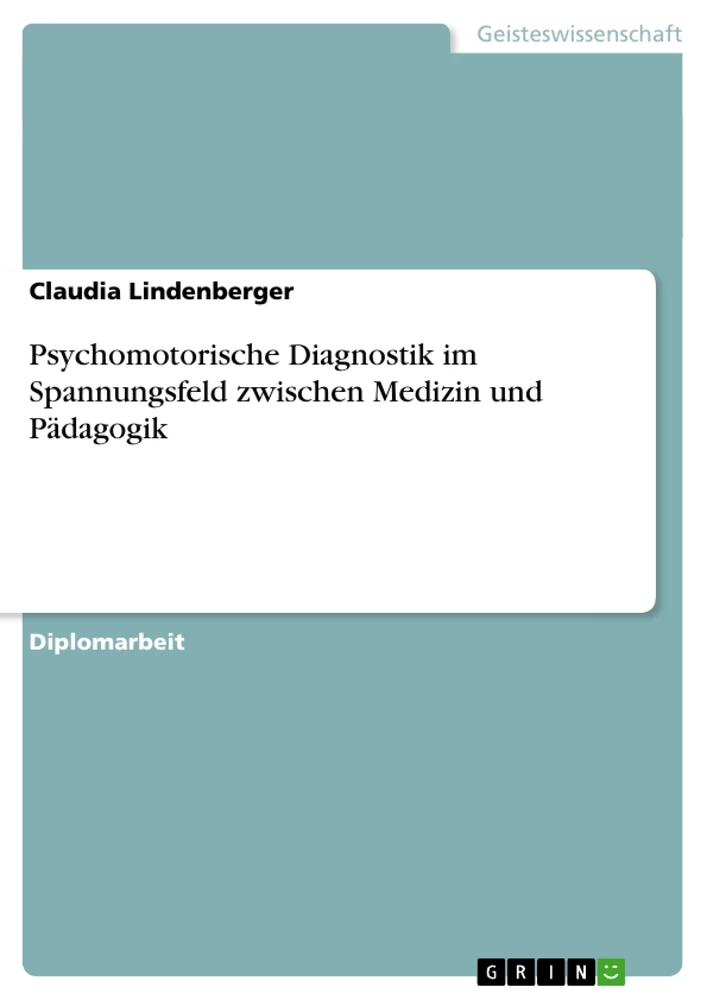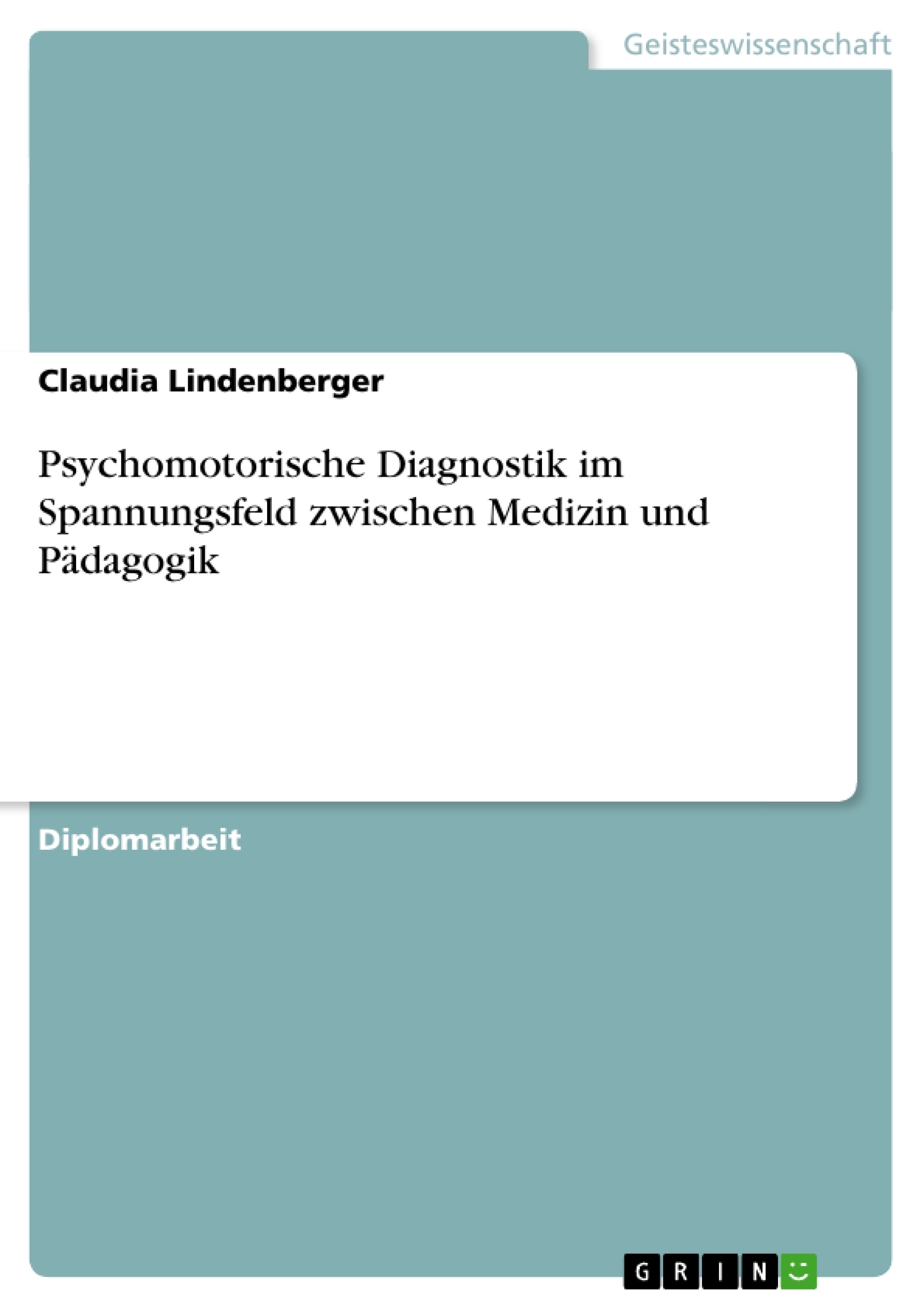Im Dezember 2004 habe ich im Rahmen meiner Psychomotorik-Zusatzausbildung an der FH Darmstadt, FB Sozialpädagogik, ein Fördergutachten über ein Kind aus der von einer Kommilitonin und mir geleiteten Psychomotorik-Gruppe geschrieben. Teil dieses Fördergutachtens war die Durchführung einer Diagnostik. Zusammen mit meiner Kommilitonin habe ich mich der Verfügbarkeit und Einfachheit halber für die von CARDENÁS entwickelte „Diagnostik mit Pfiffigunde“ entschieden. Eine aufwendigere Diagnostik kam aufgrund des relativ geringen Zeitrahmens nicht in Frage.
Schon während der Vorbereitung unseres Diagnostik-Tages fiel uns auf, welchem Druck wir die Kinder, die uns bisher nur als „gutmütigen Spielpartner“ aus den Psychomotorik-Stunden kannten, aussetzen werden. Da wir bisher keinerlei Erfahrung mit Diagnostik in der Praxis hatten, arbeiteten wir uns durch die dazugehörige Literatur. Meine Kommilitonin würde die Kamera führen und ich sollte die Geschichte mit den Kindern „durchspielen“. Zunächst fiel uns auf, dass alleine die Vorbereitungen, Materialbeschaffungen, „Präparieren“ der Psychomotorik-Halle etc. mit einem sehr hohen Aufwand verbunden war. Das Spielen von Pfiffigundes Geschichte mit den Kindern verlief dann aufgrund der guten Vorbereitung relativ reibungslos. Anzumerken ist jedoch, dass von fünf teilnehmenden Kindern nur zwei der Geschichte wirklich folgen konnten und konsequent mitarbeiteten. Darunter war „glücklicherweise“ auch jenes Kind, über welches wir unser Fördergutachten schreiben wollten.
In der Auswertung des Videobandes hielten wir uns streng an die Vorgaben der Autorin.
Das Ergebnis überraschte uns sehr. Das Kind, welches wir diagnostiziert hatten, zeigte in den bisherigen Psychomotorik-Stunden keinerlei Auffälligkeiten und hatte unserer Ansicht nach gute sozial-kommunikative und motorische Kompetenzen. Wir hatten es für das Fördergutachten ausgewählt, weil wir von Beginn unserer Arbeit an ein sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis zu ihm und seiner Mutter hatten und uns für unsere „erste Diagnostik“ keinen „Problemfall“ aussuchen wollten.
Was die Diagnostik scheinbar ans Licht brachte, war unfassbar. Wir hatten es dem Ergebnis zufolge offenbar mit einem Kind zu tun, welches leichte Probleme in der Grobmotorik und schwerwiegende Probleme in der Feinmotorik hatte. Zudem war in vier Kriterien ein hoher Förderbedarf zu erkennen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1. Zur Motivation über dieses Thema meine Diplomarbeit zu schreiben
- 1.2. Aufbau und Gliederung der Arbeit
- 1.3. Einführung in das Thema
- 2. PSYCHOMOTORISCHE DIAGNOSTIK
- 2.1. Definition,,Diagnostik“
- 2.1.1. Begriffsabgrenzungen
- 2.1.2. Klassifizierung der diagnostischen Methoden
- 2.2. Historisch-methodischer Überblick
- 2.2.1. Frühe Phase
- 2.2.2. Die Weiterentwicklung des OSERETZKY-Tests
- 2.2.3. Die motometrische Phase
- 2.2.4. Förderdiagnostik
- 2.2.5. Beobachtung
- 2.2.6. Individuelle Entwicklungspläne
- 2.3. Gütekriterien
- 3. GRUNDLAGEN DER DIAGNOSTIK AUS MEDIZINISCHER SICHT
- 3.1. klassische Medizin
- 3.1.1. Definition,,Diagnostik“
- 3.1.2. Das medizinische Modell der Diagnostik
- 3.2. Diagnostik in der Gesundheitsförderung
- 4. ENTWICKLUNG DER PÄDAGOGISCHEN DIAGNOSTIK
- 4.1. Der Weg der Diagnostik in pädagogische Handlungsfelder
- 4.2. Die pädagogische Diagnose
- 4.2.1. Zum Verhältnis von diagnostizierenden Pädagogen und Klienten
- 4.2.2. Förderdiagnostische Informationsgewinnung in der Pädagogik
- 4.2.3. Gütekriterien des diagnostischen Vorgehens in der Pädagogik
- 5. DAS SPANNUNGSFELD DER DIAGNOSTIK
- 5.1. kritische Fragestellung
- 5.2. Psychomotorische Diagnostik im Zeitwandel der zugrundeliegenden Theorien
- 5.2.1. Motometrische Verfahren
- 5.2.2. Psychomotorische Diagnostik im Zuge des Paradigmenwechsels
- 5.2.2.1. Blick auf die Gütekriterien
- 5.2.3. Förderdiagnostik
- 5.3. Methodenbezogene Kritik
- 5.3.1. Vor- und Nachteile der klassischen Diagnostikmethoden
- 5.3.2. Kritischer Blick auf die Methoden der Förderdiagnostik
- 5.4. Diagnostik und Individuum
- 6. KONSEQUENZEN FÜR DIE PSYCHOMOTORIK UND DIE PSYCHOMOTORISCHE DIAGNOSTIK: EIN RESÜMEE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert die psychomotorische Diagnostik im Kontext des Spannungsfeldes zwischen medizinischen und pädagogischen Ansätzen. Das Ziel der Arbeit ist es, die unterschiedlichen Perspektiven und Methoden der Diagnostik in beiden Disziplinen zu beleuchten und deren Implikationen für die Praxis der psychomotorischen Förderung zu diskutieren.
- Die historische Entwicklung der psychomotorischen Diagnostik
- Die unterschiedlichen Definitionen und Konzepte von Diagnostik in Medizin und Pädagogik
- Die methodischen Ansätze und Gütekriterien der psychomotorischen Diagnostik
- Die Kritik an den etablierten Diagnostik-Methoden und deren Einfluss auf die Förderung
- Die Bedeutung des Individuums und dessen Lebenswelt in der psychomotorischen Diagnostik
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und erläutert die Motivation der Autorin. Es wird ein konkretes Beispiel aus der Praxis vorgestellt, das den Spannungsbereich zwischen medizinischen Erwartungen und pädagogischen Grundsätzen verdeutlicht.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel beleuchtet die psychomotorische Diagnostik aus verschiedenen Perspektiven. Es werden Definitionen, historische Entwicklungen und methodische Ansätze vorgestellt.
- Kapitel 3: Es werden die Grundlagen der Diagnostik aus medizinischer Sicht beleuchtet, darunter die klassische Medizin und die Diagnostik im Kontext der Gesundheitsförderung.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel fokussiert die Entwicklung der pädagogischen Diagnostik. Es wird der Weg der Diagnostik in pädagogische Handlungsfelder sowie die spezifischen Merkmale und Herausforderungen der pädagogischen Diagnose dargestellt.
- Kapitel 5: Dieser Abschnitt beleuchtet das Spannungsfeld zwischen den beiden Disziplinen im Detail. Es werden kritische Fragestellungen und methodische Diskussionen aufgeworfen, die die unterschiedlichen Herangehensweisen und deren Implikationen für die Praxis verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Psychomotorische Diagnostik, Medizin, Pädagogik, Förderdiagnostik, Gütekriterien, Motometrie, Paradigmenwechsel, Individuum, Lebenswelt, Praxisbezug.
- Quote paper
- Claudia Lindenberger (Author), 2005, Psychomotorische Diagnostik im Spannungsfeld zwischen Medizin und Pädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43267