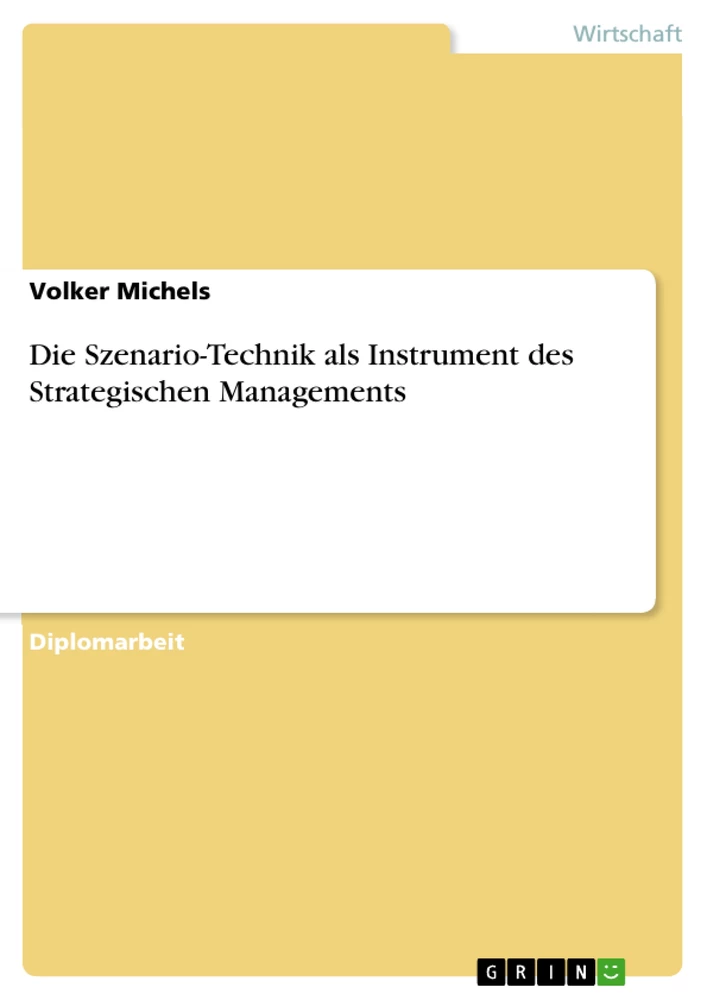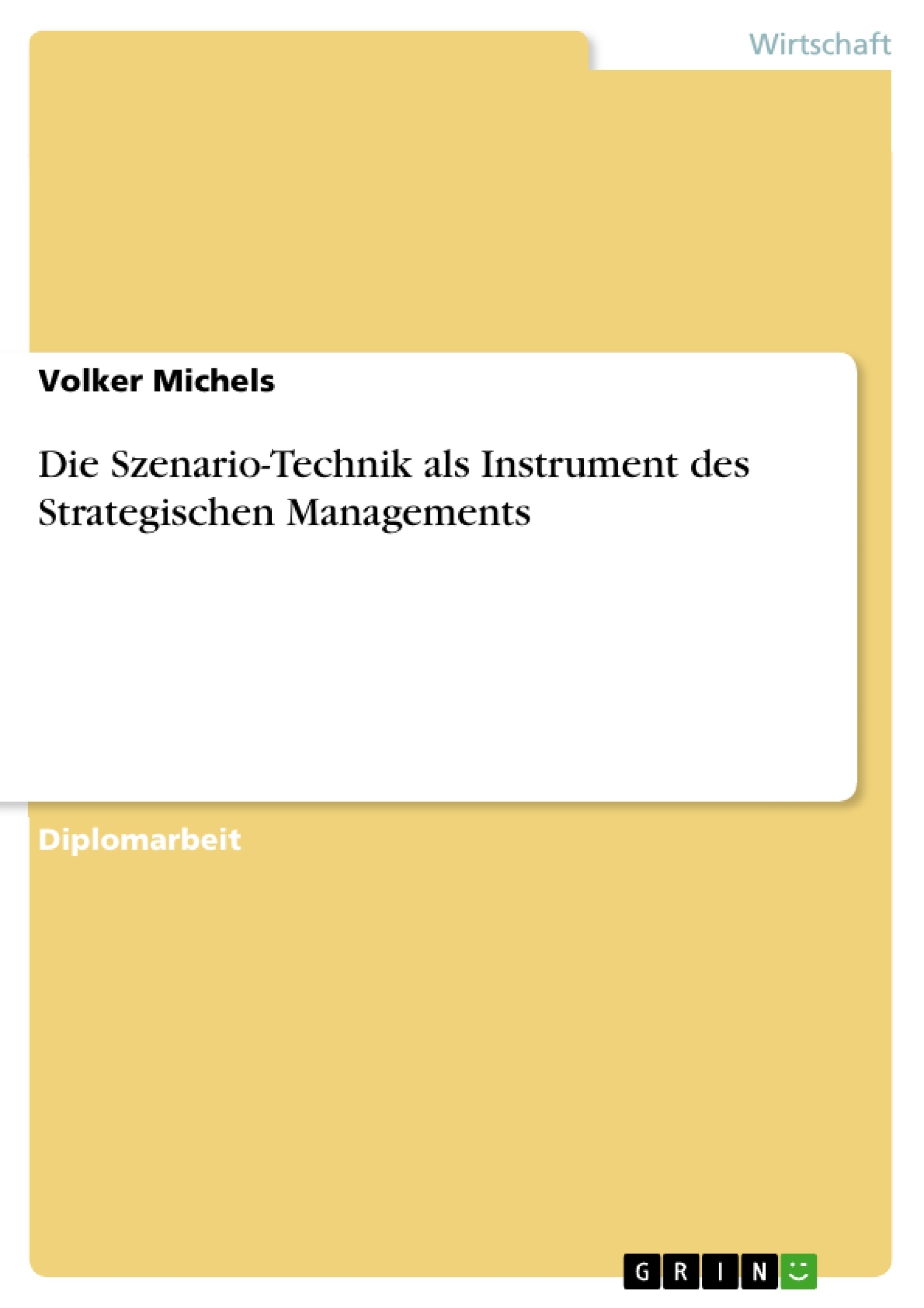Bereits 1979 stellte ANSOFF fest, dass die Unternehmensumwelt in zunehmendem Maße komplexer wird, sich schnell verändert und immer wieder Neues bringt. Gleichzeitig werden auch die Unternehmen immer größer, komplexer, so dass sie in vielen verschiedenen Ländern und Geschäftsbereichen aktiv sind.
ALBACH nennt vier Faktoren für eine turbulenter werdende Unternehmensumwelt :
- Aufgrund der stark gestiegenen Einkommen und der erfüllten Grundbedürfnisse wird die Voraussagbarkeit der Kaufströme erschwert.
- Die verminderten Wachstumsraten führen zu schnellen Veränderungen der Kaufströme.
- Der internationale Wettbewerb wirkt sich negativ auf die inländische Verteilungssituation aus.
- Die Möglichkeiten der Wirtschaftspolitik von Seiten der Regierung sind nur gering und können die Lage nur wenig verbessern.
HINTERHUBER sieht in der heutigen Welt eine einzige konstante Größe: „Die Beschleunigung der Veränderung.“ Er schlägt als Lösung eine langfristige, strategische Planung vor. Dem widerspricht SCHREYÖGG. Er hält es für gefährlich, gerade in turbulenten Zeiten eine langfristige Mittelbindung einzugehen, da das Unternehmen dadurch an Flexibilität verliert.
Welcher Ansatz ist vernünftig? Mehr Bindung oder mehr Planung?
An diesem Punkt setzt die Szenario-Technik an: Sie geht nicht von einer, sondern von mehreren möglichen Zukünften aus, die Szenarien genannt werden. Auf dieser Grundlage kann die Unternehmensführung eine robuste Strategie entwickeln, die in mehreren Zukünften Erfolg versprechend ist. Darüber hinaus können Strategien entworfen werden, auf die bei alternativen Umweltentwicklungen umgeschwenkt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 PROBLEMDARSTELLUNG
- 1.2 VORGEHEN
- 2. DAS KONZEPT DES STRATEGISCHEN MANAGEMENTS
- 2.1 GRUNDLAGEN
- 2.1.1 DEFINITION WICHTIGER BEGRIFFE
- 2.1.1.1 Unternehmensziele
- 2.1.1.2 Der Strategiebegriff
- 2.1.1.3 Der Begriff der Planung
- 2.1.1.4 Der Begriff der Kontrolle
- 2.2 DER WEG ZUR LANGFRISTPLANUNG
- 2.3 DIE STRATEGISCHE PLANUNG
- 2.4 DIE STRATEGISCHE KONTROLLE
- 2.4.1 DIE STRATEGISCHE PRÄMISSENKONTROLLE
- 2.4.2 DIE STRATEGISCHE DURCHFÜHRUNGSKONTROLLE
- 2.4.3 DIE STRATEGISCHE ÜBERWACHUNG
- 2.5 DAS STRATEGISCHE MANAGEMENT
- 2.5.1 ANFÄNGE
- 2.5.2 EIN MODERNER ANSATZ VON KIRSCH
- 2.5.2.1 Drei Generationen des Strategischen Managements
- 2.5.2.2 Die geplante Evolution
- 3. DIE SZENARIO-TECHNIK
- 3.1 BEGRIFF UND DEFINITION
- 3.2 ANFORDERUNGEN AN DIE SZENARIOTECHNIK
- 4. INSTRUMENTE IM RAHMEN DER SZENARIO-TECHNIK
- 4.1 GRUNDLAGEN
- 4.2 DIREKTE UND INDIREKTE ABHÄNGIGKEITEN ZWISCHEN VARIABLEN
- 4.2.1 DIE EINFLUSSANALYSE
- 4.2.2 DIE MIC-MAC-ANALYSE
- 4.2.3 CROSS-IMPACT-ANALYSE
- 4.3 DIE KONSISTENZANALYSE
- 4.4 DIE DELPHI-METHODE
- 4.5 MORPHOLOGISCHER KASTEN
- 4.6 SIMULATIONEN
- 4.7 RELEVANZBAUM- ODER ENTSCHEIDUNGSBAUMMETHODE
- 5. DIE URSPRÜNGE DER SZENARIO-TECHNIK
- 5.1 ÜBERSICHT
- 5.2 DER ANSATZ VON KAhn und WienER
- 5.3 DER ANSATZ DER SHELL-GRUPPE
- 6. WEITERENTWICKLUNGEN DER SZENARIO-TECHNIK
- 6.1 FORMATIVE SZENARIOANALYSE NACH SCHOLZ UND TIETJE
- 6.1.1 GRUNDLAGEN
- 6.1.2 ABLAUF
- 6.1.3 BEWERTUNG DES ANSATZES VON SCHOLZ UND TIETJE
- 6.2 INTUITIVE SZENARIOANALYSE NACH SRI-INTERNATIONAL
- 6.2.1 ABLAUF
- 6.2.2 BEWERTUNG DES ANSATZES DER SRI-INTERNATIONAL
- 6.3 MODELLGESTÜTZTE SZENARIOANALYSE NACH DEM BATTELLE-INSTITUT
- 6.3.1 GRUNDLAGEN
- 6.3.2 ABLAUF NACH VON REIBNITZ
- 6.3.3 BEWERTUNG DES ANSATZES VON VON REIBNITZ
- 6.3.4 ERGÄNZENDE ÜBERLEGUNGEN VON MIẞLER-BEHR
- 6.3.4.1 Ablauf
- 6.3.4.2 Forschungsschwerpunkt
- 6.3.4.3 Bewertung der Überlegungen von MIẞLER-BEHR
- 7. ZWISCHENBETRACHTUNG
- 7.1 EIGENE ÜBERLEGUNGEN
- 7.2 KRITIKPUNKTE AN DER BISHERIGEN HERANGEHENSWEISE DURCH DIE PADERBORNER
- 8. PADERBORNER ANSATZ
- 8.1 GRUNDLAGEN
- 8.2 SZENARIOENTWICKLUNG
- 8.2.1 VORBEREITUNG
- 8.2.2 ANALYSE DES SZENARIOFELDES
- 8.2.3 SZENARIO-PROGNOSTIK
- 8.2.4 SZENARIOBILDUNG
- 8.3 SZENARIOTRANSFER
- 8.3.1 KOMMUNIKATION DER SZENARIEN
- 8.3.2 ENTWICKLUNG EINER ZUKUNFTSROBUSTEN STRATEGIE
- 8.3.2.1 Optionsentwicklung
- 8.3.2.2 Strategiefindung
- 8.3.2.3 Strategieformulierung
- 8.3.3 NUTZUNG DER SZENARIEN IN DER STRATEGISCHEN FRÜHAUFKLÄRUNG
- 8.4 WEITERE EINSATZMÖGLICHKEITEN DER SZENARIEN
- 8.4.1 EINSATZ VON SZENARIEN IM STRATEGISCHEN MARKETING
- 8.4.2 EINSATZ VON SZENARIEN IM PRODUKT- UND TECHNOLOGIEMANAGEMENT
- 8.4.3 EINSATZ VON SZENARIEN BEI DER STRATEGISCHEN AUSRICHTUNG EINER ORGANISATION MIT GESCHÄFTSMODELLEN
- 8.5 BEWERTUNG DES PADERBORNER ANSATZES
- 9. BEURTEILUNG DER SZENARIO-TECHNIK
- 9.1 STÄRKEN DER SZENARIO-TECHNIK
- 9.1.1 GRUNDSÄTZLICHE STÄRKEN DER SZENARIO-TECHNIK
- 9.1.2 WEITERE STÄRKEN DER SZENARIO-TECHNIK
- 9.2 SCHWÄCHEN DER SZENARIO-TECHNIK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Szenario-Technik als Instrument des Strategischen Managements. Die Arbeit untersucht die Entstehung, Entwicklung und Anwendung der Szenario-Technik, um ihre Rolle im Managementprozess aufzuzeigen.
- Die Bedeutung der Szenario-Technik für die strategische Planung
- Die unterschiedlichen Ansätze der Szenario-Technik
- Die Anwendung der Szenario-Technik in verschiedenen Managementbereichen
- Die Stärken und Schwächen der Szenario-Technik
- Die Relevanz der Szenario-Technik für die Zukunft des Strategischen Managements
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit dar und erläutert das Vorgehen.
- Kapitel 2: Das Konzept des Strategischen Managements wird definiert und wichtige Begriffe, wie Unternehmensziele, Strategie, Planung und Kontrolle, werden erläutert. Die Entwicklung des Strategischen Managements wird dargestellt.
- Kapitel 3: Die Szenario-Technik wird als Instrument des Strategischen Managements definiert und ihre Anforderungen werden beschrieben.
- Kapitel 4: Die verschiedenen Instrumente, die im Rahmen der Szenario-Technik eingesetzt werden, werden vorgestellt. Hierzu gehören die Einflussanalyse, die MIC-MAC-Analyse, die Cross-Impact-Analyse, die Konsistenzanalyse, die Delphi-Methode, der Morphologische Kasten, Simulationen und die Relevanzbaum- oder Entscheidungsbaummethode.
- Kapitel 5: Die Ursprünge der Szenario-Technik werden dargestellt, wobei die Ansätze von Kahn und Wiener sowie die der Shell-Gruppe im Fokus stehen.
- Kapitel 6: Verschiedene Weiterentwicklungen der Szenario-Technik werden präsentiert, unter anderem die formative Szenarioanalyse nach Scholz und Tietje, die intuitive Szenarioanalyse nach SRI-International und die modellgestützte Szenarioanalyse nach dem Battelle-Institut.
- Kapitel 7: In einer Zwischenbetrachtung werden eigene Überlegungen zum Thema der Szenario-Technik angestellt und Kritikpunkte an der bisherigen Herangehensweise durch die Paderborner werden aufgezeigt.
- Kapitel 8: Der Paderborner Ansatz zur Szenario-Entwicklung wird vorgestellt, der die Szenario-Technik in verschiedene Managementbereiche integriert.
- Kapitel 9: Eine Beurteilung der Szenario-Technik erfolgt, indem die Stärken und Schwächen des Instruments beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind Szenario-Technik, Strategisches Management, Planung, Kontrolle, Unternehmensziele, Einflussanalyse, MIC-MAC-Analyse, Cross-Impact-Analyse, Konsistenzanalyse, Delphi-Methode, Morphologischer Kasten, Simulationen, Relevanzbaum, Entscheidungsbaum, Formative Szenarioanalyse, Intuitive Szenarioanalyse, Modellgestützte Szenarioanalyse, Paderborner Ansatz.
- Quote paper
- Volker Michels (Author), 2004, Die Szenario-Technik als Instrument des Strategischen Managements, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43221