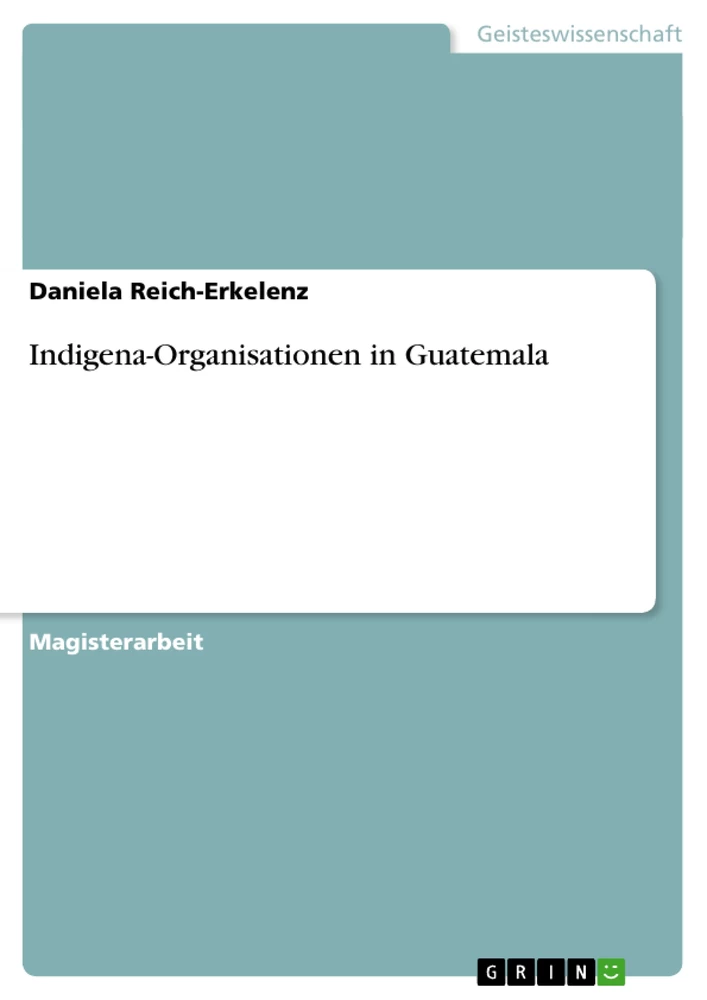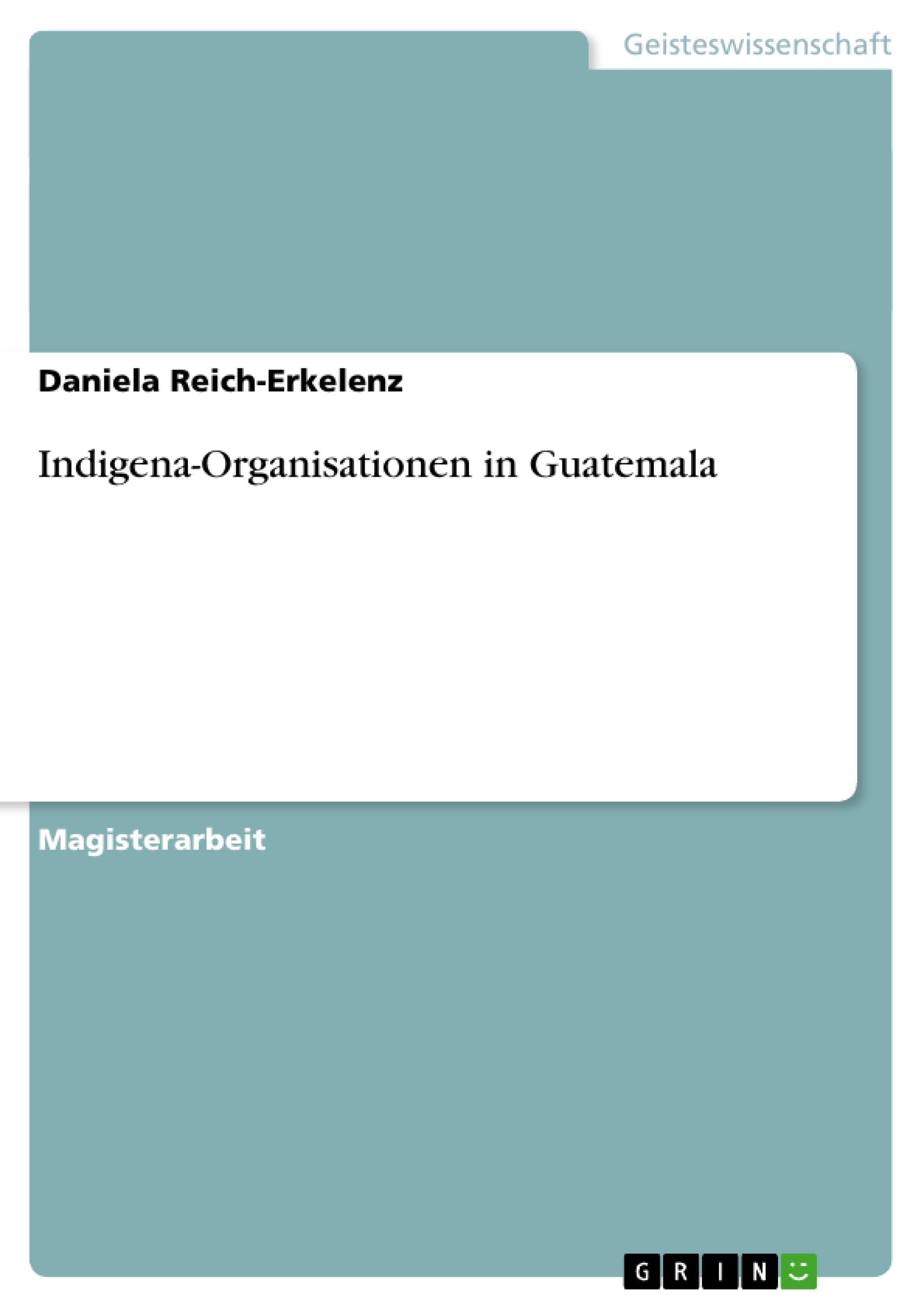Der im Vergleich mit dem weitgehenden Verschwinden der autochthonen Völker in den mesoamerikanischen Nachbarstaaten außerordentlich hohe indigene Bevölkerungsanteil Guatemalas zog schon frühzeitig das Interesse von Anthropologen auf sich, welche sich angesichts der noch zahlreich existierenden indigenen Kulturtraditionen bis in die Gegenwart primär mit den Kriterien zur Definition des Indígena-Seins befaßten – nach heute gängiger Meinung repräsentieren mehr als zwanzig der von den antiken Mayas abstammenden indigenen Sprachgemeinschaften mindestens die Hälfte der ca. acht Millionen Einwohner (Davis 1988: 3) des ansonsten von einer knapp ebenso großen Gruppe von Nicht-Indígenas, den sogenannten Ladinos, und einer kleinen Zahl von Europäern (Criollos) – Nachfahren der ehemaligen Kolonialisten und Immigranten – bevölkerten Landes (Smith 1990a: 3) -: In den 40er und 50er Jahren setzten Sol Tax (1942: 45) und Robert Redfield (193: 84) der bislang unwidersprochenen Erklärung Morris Siegels (1941) von der aus zwei verschiedenen Rassen komponierten guatemaltekischen Gesellschaft entgegen, daß keineswegs phänoty-pische, sondern vielmehr verschiedene Kulturelemente die Determinanten von Ladinos und Indígenas und der Trennung zwischen den beiden ethnischen Gruppen seien (Brintnall 1979: 638ff).
Diese Auffassung hielt sich bis in die 70er Jahre hinein und hatte z.B. die mit den Maya-Gruppen befaßten Autoren des von Manning Nash herausgegebenen „Handbook of Middle American Indians“ (1967) zu systematischer Auflistung der Form und Verbreitung einzelner Kulturelemente bewogen.
In einer Studie zu ethnischen Guppenbeziehungen in Guatemala wies von den Berghe (1968: 322ff) die unveränderte Stabilität der ethnischen Grenze auch für assimilierte Indígenas und damit die Ungültigkeit der kulturessentialistischen These nach.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Integration der Indígenas in den Staat
- 1.1. Die Auswirkungen der integrativen Maßnahmen in den Comunidades Indígenas
- 1.1.1. Die wachsende Unabhängigkeit der Indígenas von den Ladinos
- 1.1.2. Die intraindigene Klassenbildung
- 1.2. Politisierung und Organisierung der Indígenas in den frühen 70er Jahren
- 1.2.1. Die Formierung erster Indígena-Organisationen
- 1.2.2. Der Griff nach den politischen Institutionen
- 1.1. Die Auswirkungen der integrativen Maßnahmen in den Comunidades Indígenas
- 2. Milieuspezifische Indígena-Organisationen in den späten 70er Jahren
- 2.1. Die Entstehung der indigenen Basisorganisation
- 2.1.1. Die Abkehr der Campesinos von der indigenen Bourgeoisie
- 2.1.2. Das Comité de Unidad Campesina (CUC)
- 2.2. Die Organisierung der indigenen Bourgeoisie
- 2.2.1. Die neue Ideologie der indigenen Bourgeoisie
- 2.2.2. Bourgeoise Indígena-Organisationen im indianistischen Kontext
- 2.1. Die Entstehung der indigenen Basisorganisation
- 3. Indígena-Organisationen im Lichte der Aufstandsbekämpfungspolitik
- 3.1. Die Politik der Generäle
- 3.2. Die indigene Bevölkerung im bewaffneten Widerstand
- 3.2.1. Volksorganisation und Guerilla
- 3.2.2. Indianisten während der Kriegsjahre
- 3.2.3. Die Debatte um Klasse und Nation
- 4. Die Zivilregierung und die indigene Bevölkerung
- 4.1. Das indianistische Autonomieprogramm
- 4.1.1. Maya-Organisationen als Grundpfeiler der Maya-Republik
- 4.1.2. Maya-Organisationen und Strategien zur Förderung der ethnischen Identität
- 4.2. Die Entstehung der Volksorganisationen
- 4.2.1. Volksorganisationen im Kampf um soziale und Menschenrechte
- 4.2.2. Volksorganisationen und die Kampagne „500 Años des Resistencia Indígena y Popular“
- 4.2.3. Die ethnische Bewußtseinsbildung in den Volksorganisationen
- 4.3. Das Verhältnis zwischen Volksorganisationen und Maya-Institutionen
- 4.1. Das indianistische Autonomieprogramm
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung indigener Organisationen in Guatemala. Ziel ist es, die politische Mobilisierung und Organisation der indigenen Bevölkerung im Kontext der guatemaltekischen Geschichte zu analysieren. Dabei werden die verschiedenen Phasen der Organisierung und die Interaktion mit staatlichen Institutionen und politischen Akteuren beleuchtet.
- Integration der Indígenas in den Staat und deren Auswirkungen
- Entstehung und Entwicklung indigener Organisationen
- Rolle indigener Organisationen im bewaffneten Konflikt
- Beziehungen zwischen indigenen Organisationen und der Zivilregierung
- Ethnische Identität und politische Mobilisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der indigenen Bevölkerung Guatemalas ein und beleuchtet die historische Debatte um die Definition von „Indígena“-Sein. Sie skizziert die unterschiedlichen Ansätze zur Erklärung des Überlebens der indigenen Kultur und Identität im Kontext der guatemaltekischen Gesellschaft, von rassischen bis hin zu klassenspezifischen Perspektiven. Die Diskussion um die „closed corporate community“ und deren Wandel durch den Indigenismo wird angesprochen.
1. Die Integration der Indígenas in den Staat: Dieses Kapitel analysiert die Versuche der Integration der indigenen Bevölkerung in den guatemaltekischen Staat und deren Auswirkungen auf die Comunidades Indígenas. Es untersucht die zunehmende Unabhängigkeit der Indígenas von den Ladinos und die Herausbildung innerindigener Klassenstrukturen als Folge der Integrationsmaßnahmen. Weiterhin wird die zunehmende Politisierung und Organisierung der Indígenas in den frühen 1970er Jahren beleuchtet.
2. Milieuspezifische Indígena-Organisationen in den späten 70er Jahren: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung milieuspezifischer Indígena-Organisationen in den späten 1970er Jahren. Es analysiert die Entstehung indigener Basisorganisationen, die Abkehr der Campesinos von der indigenen Bourgeoisie und die Rolle des Comité de Unidad Campesina (CUC). Darüber hinaus wird die Organisation der indigenen Bourgeoisie und deren neue Ideologie im indianistischen Kontext untersucht.
3. Indígena-Organisationen im Lichte der Aufstandsbekämpfungspolitik: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss der Aufstandsbekämpfungspolitik auf indigene Organisationen. Es analysiert die Strategien der Militärregierung und die Beteiligung der indigenen Bevölkerung am bewaffneten Widerstand. Die Rolle von Volksorganisationen und Guerilla, die Aktivitäten von Indianisten während des Krieges und die Debatte um Klasse und Nation werden detailliert behandelt.
4. Die Zivilregierung und die indigene Bevölkerung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Verhältnis zwischen der Zivilregierung und der indigenen Bevölkerung nach dem bewaffneten Konflikt. Es analysiert das indianistische Autonomieprogramm, die Rolle von Maya-Organisationen, die Entstehung von Volksorganisationen und deren Kampf um soziale und Menschenrechte. Die Kampagne „500 Años des Resistencia Indígena y Popular“ und die ethnische Bewußtseinsbildung in den Volksorganisationen werden ebenso beleuchtet wie das Verhältnis zwischen Volksorganisationen und Maya-Institutionen.
Schlüsselwörter
Indigene Organisationen, Guatemala, Indígenas, Ladinos, Politisierung, Organisierung, Integration, Aufstandsbekämpfung, bewaffneter Widerstand, Volksorganisationen, Maya-Organisationen, ethnische Identität, Klassenstrukturen, Comité de Unidad Campesina (CUC), Indigenismo.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entwicklung indigener Organisationen in Guatemala
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung indigener Organisationen in Guatemala, ihre politische Mobilisierung und Organisation im Kontext der guatemaltekischen Geschichte. Sie beleuchtet verschiedene Phasen der Organisierung und die Interaktion mit staatlichen Institutionen und politischen Akteuren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Integration der Indígenas in den Staat und deren Auswirkungen, die Entstehung und Entwicklung indigener Organisationen, die Rolle indigener Organisationen im bewaffneten Konflikt, die Beziehungen zwischen indigenen Organisationen und der Zivilregierung sowie die ethnische Identität und politische Mobilisierung.
Welche Phasen der indigenen Organisierung werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Organisierung der Indígenas in den frühen 1970er Jahren, die Entwicklung milieuspezifischer Organisationen in den späten 1970er Jahren, die Rolle indigener Organisationen während der Aufstandsbekämpfungspolitik und die Situation nach dem bewaffneten Konflikt unter der Zivilregierung.
Welche Akteure spielen eine Rolle?
Wichtige Akteure sind die Indígenas selbst, die Ladinos, staatliche Institutionen, die Militärregierung, indigene Basisorganisationen, die indigene Bourgeoisie, das Comité de Unidad Campesina (CUC), Volksorganisationen, Maya-Organisationen und Indianisten.
Welche Konzepte werden diskutiert?
Zentrale Konzepte sind Integration, Politisierung, Organisierung, Aufstandsbekämpfung, bewaffneter Widerstand, ethnische Identität, Klassenstrukturen und Indigenismo. Die Debatte um die „closed corporate community“ und die Definition von „Indígena“-Sein wird ebenfalls angesprochen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, die die Thematik einführt. Die folgenden Kapitel analysieren die verschiedenen Phasen der indigenen Organisierung, wobei jeweils spezifische Aspekte und Entwicklungen beleuchtet werden. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Indigene Organisationen, Guatemala, Indígenas, Ladinos, Politisierung, Organisierung, Integration, Aufstandsbekämpfung, bewaffneter Widerstand, Volksorganisationen, Maya-Organisationen, ethnische Identität, Klassenstrukturen, Comité de Unidad Campesina (CUC), Indigenismo.
Welche konkreten Organisationen werden erwähnt?
Die Arbeit erwähnt unter anderem das Comité de Unidad Campesina (CUC) und verschiedene Maya-Organisationen, die eine Schlüsselrolle in der politischen Mobilisierung und dem Kampf um Autonomie spielten.
Welche Ereignisse werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt detailliert die Versuche der Integration der Indígenas in den Staat, die Entstehung indigener Basisorganisationen, die Rolle indigener Organisationen im bewaffneten Konflikt, die Umsetzung des indianistischen Autonomieprogramms und die Kampagne „500 Años des Resistencia Indígena y Popular“.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit analysiert die komplexe Entwicklung indigener Organisationen in Guatemala und zeigt die Herausforderungen und Erfolge der indigenen Bevölkerung im Kampf um ihre Rechte und ihre kulturelle Identität auf. Die konkreten Schlussfolgerungen ergeben sich aus der detaillierten Analyse der verschiedenen Kapitel.
- Quote paper
- Daniela Reich-Erkelenz (Author), 1994, Indigena-Organisationen in Guatemala, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43196