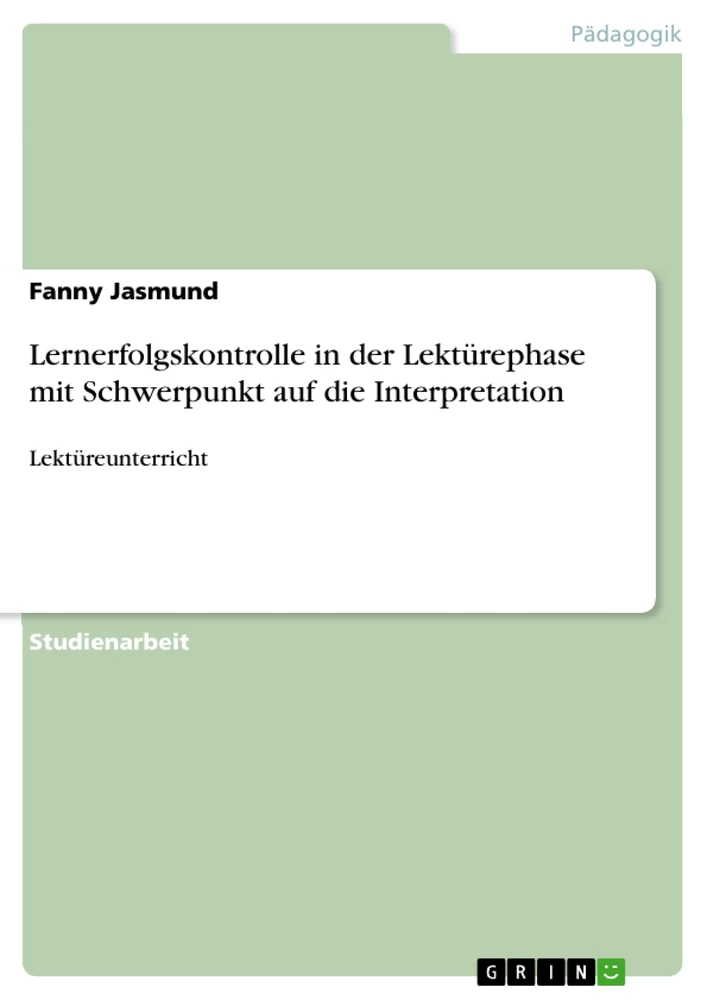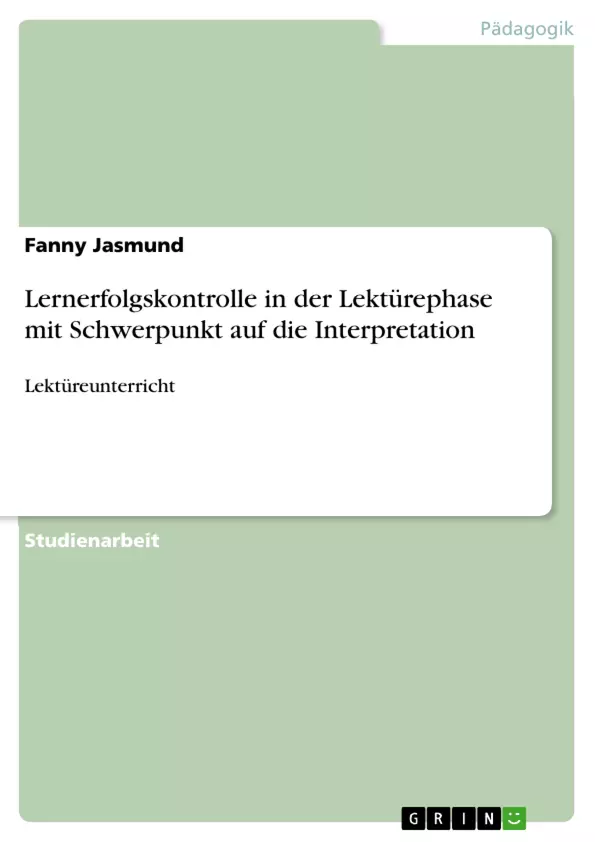Die Schule ist die erste Institution auf unserem Lebensweg in der uns Lernerfolgskontrollen und Leistungsbewertungen begegnen. Heutzutage bestimmen gute Leistungen und Abschlüsse über den Zugang zu bestimmten Studienmöglichkeiten und beruflichen Laufbahnen. Aus Sicht der Schüler haben Leistungsbewertungen oft einen negativen Beigeschmack. Sie sind verbunden mit Prüfungs- und Versagensängsten. Das Gefühl, Fehler und Lernschwierigkeiten nicht eingestehen zu dürfen, weil sie schlecht bewertet werden könnten. Der Begriff der Leistungsbewertung ist subjektiv, sowohl für den Lehrer, als auch für den Schüler. Was für den einen Schüler ein großer Erfolg und Schritt nach vorne ist, bedeutet für einen anderen einen Misserfolg.
In dieser Arbeit soll die Leistungsbewertung im Allgemeinen und anschließend im Schwerpunkt auf die Interpretationsaufgabe, zentraler Gegenstand sein. Ich werde der Frage nachgehen, ob Übersetzung und die anschließende Interpretation eine geschlossene Einheit bilden und damit auch zusammenhängend bewertet werden oder ob das Gegenteil der Fall ist. Wie sollte sich eine Interpretation aufbauen, was sind die Voraussetzungen dafür und wie sind die Bewertungsmaßstäbe? All diese Aspekte werden im Hauptteil dieser Arbeit reflektiert und diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Grundsätze
- Funktionen und Ziele der Lernerfolgskontrolle und der Leistungsmessung
- Die 12 goldenen Regeln der Leistungsbewertung
- Arten der Lernerfolgskontrolle
- Übersetzungsklausur und Interpretationsaufgabe
- Interpretationsebenen im Lektüreunterricht
- Voraussetzungen einer Interpretation
- Die Bewertung einer Interpretationsaufgabe
- Beispiel einer Interpretationsaufgabe
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der Lernerfolgskontrolle im Lateinunterricht, insbesondere im Kontext von Lektürephasen und Interpretationsaufgaben. Sie analysiert die Bedeutung von Leistungsbewertungen im schulischen Kontext und stellt verschiedene Formen der Lernerfolgskontrolle vor. Ein zentraler Fokus liegt auf der Interpretation von Texten und der Frage, wie diese bewertet werden sollten.
- Bedeutung von Lernerfolgskontrolle im Lateinunterricht
- Funktionen und Ziele der Leistungsbewertung
- Verschiedene Formen der Lernerfolgskontrolle
- Bewertung von Interpretationsaufgaben
- Zusammenhang zwischen Übersetzung und Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Bedeutung von Lernerfolgskontrollen im schulischen Kontext und stellt die Problematik der Leistungsbewertung aus Sicht der Schüler und Lehrer dar. Im Kapitel "Allgemeine Grundsätze" werden verschiedene Aspekte der Leistungsbewertung im Unterricht beleuchtet, die Funktionen und Ziele der Lernerfolgskontrolle sowie die 12 goldenen Regeln der Leistungsbewertung nach Friedrich Maier erläutert. Im Kapitel "Arten der Lernerfolgskontrolle" werden die gängigen Formen der Leistungsbewertung, wie schriftliche und mündliche Prüfungen, vorgestellt. Das Kapitel "Übersetzungsklausur und Interpretationsaufgabe" analysiert die verschiedenen Interpretationsebenen im Lektüreunterricht, die Voraussetzungen einer Interpretation und die Bewertungskriterien für Interpretationsaufgaben.
Schlüsselwörter
Lernerfolgskontrolle, Leistungsmessung, Lektüreunterricht, Interpretation, Übersetzung, Bewertungskriterien, Fachdidaktik Latein.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden Interpretationsaufgaben im Lateinunterricht bewertet?
Die Bewertung erfolgt nach spezifischen Maßstäben, die sowohl die inhaltliche Tiefe als auch die methodische Korrektheit der Textanalyse berücksichtigen.
Bilden Übersetzung und Interpretation eine Einheit?
Die Arbeit geht der Frage nach, ob diese beiden Bereiche als geschlossene Einheit bewertet werden sollten oder ob eine getrennte Leistungsmessung sinnvoller ist.
Was sind die Voraussetzungen für eine gute Interpretation?
Dazu gehören ein tiefes Verständnis des lateinischen Textes, Kenntnisse über den historischen Kontext sowie die Beherrschung verschiedener Interpretationsebenen.
Welche Funktionen hat die Lernerfolgskontrolle?
Sie dient der Rückmeldung für Lehrer und Schüler, der Motivation sowie der Zuweisung von Berechtigungen für weitere Bildungswege.
Was sind die "12 goldenen Regeln" der Leistungsbewertung?
Dies sind didaktische Grundsätze (oft nach Friedrich Maier), die eine objektive, transparente und faire Bewertung im Unterricht sicherstellen sollen.
- Arbeit zitieren
- Fanny Jasmund (Autor:in), 2010, Lernerfolgskontrolle in der Lektürephase mit Schwerpunkt auf die Interpretation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/431654