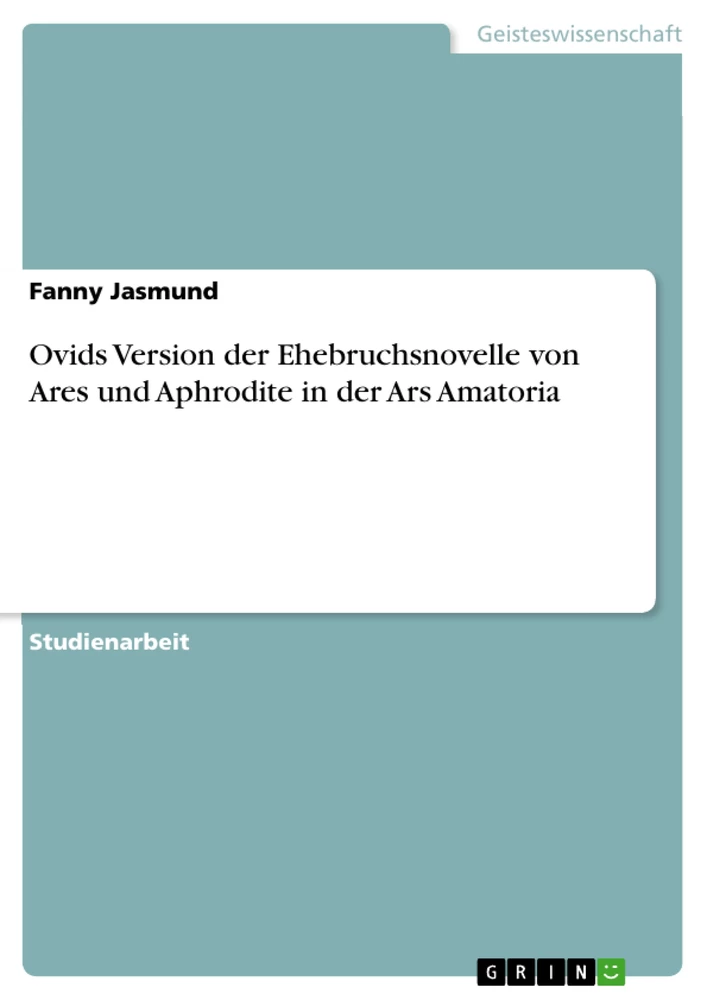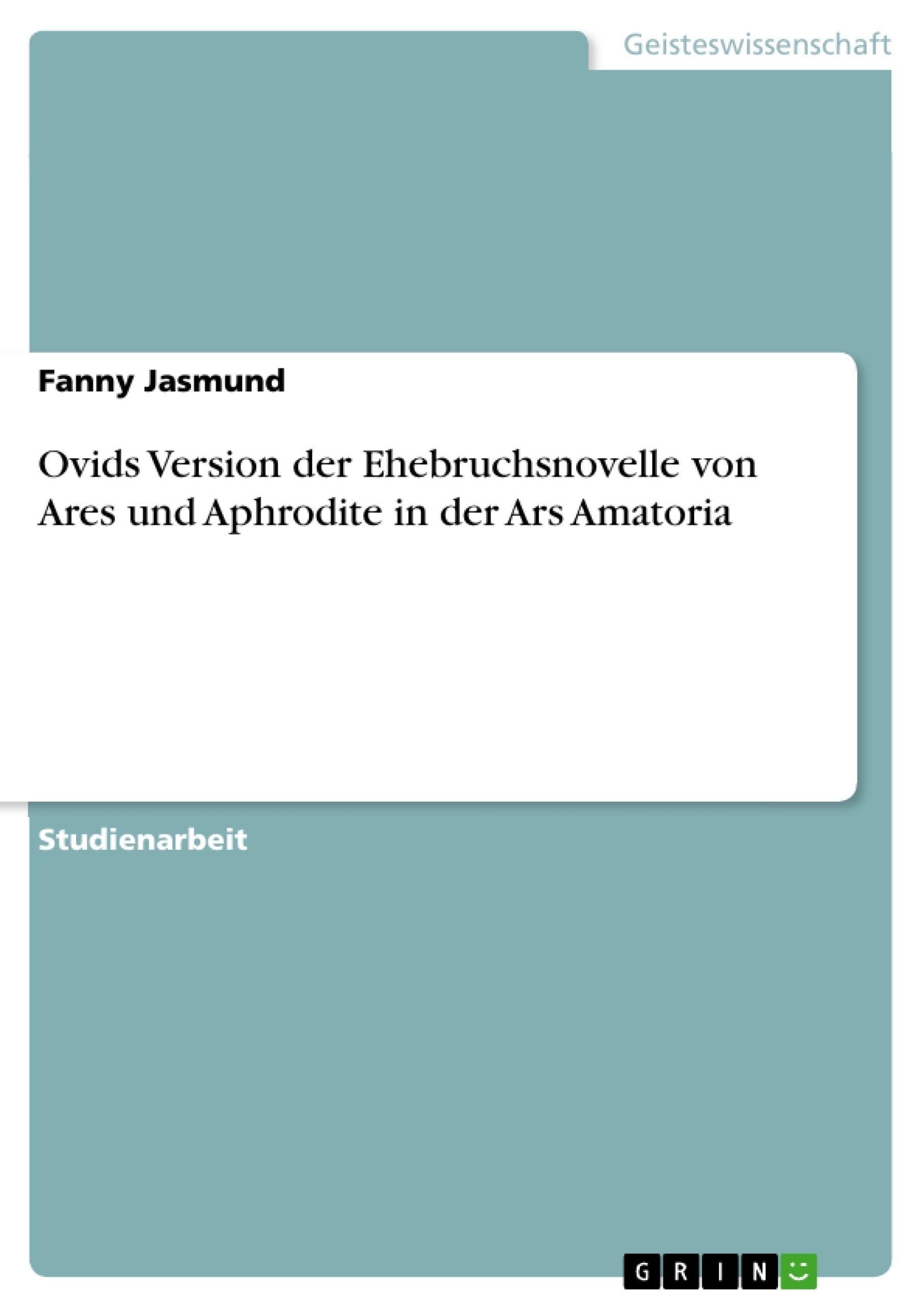Publius Ovidius Naso avancierte neben Horaz und Vergil zu den bedeutendsten Dichtern der klassischen Epoche. Bis in die Gegenwart inspiriert Ovids Dichtung die Fantasie der Menschen, ja sogar ein „Großteil des Wissens über antike Mythologie läuft über Ovid.“ Der Berliner Lateinprofessor Ulrich Schmitzer erklärt, dass viele Sagen zwar zuvor Kernbestand der griechisch-römischen Antike waren, doch einige von ihnen seien allein durch Ovid überliefert. In seinem Großwerk, den Metamorphosen, erzählt Ovid systematisch Mythen um Theben, Troja oder Athen und bezaubert seine Leserschaft schon mehr als zwei Jahrtausende. Das Lied von der Überlistung der Ehebrecher Ares und Aphrodite durch Aphrodites Ehemann Hephaistos, das der phäakische Sänger Demodokos im achten Buch der Odyssee vorträgt, gilt als die älteste erotische Novelle der europäischen Literatur und erhielt durch Ovid in den Metamorphosen sowie in seinem Lehrgedicht Ars Amatoria zwei weitere Versionen.
Die Vorstellung eines lascivus amor , das dem Mann und der Frau gestattet, frei nach Lust zu streben, wie es ihre Natur ist, lesen wir in der Ars Amatoria. Viele antike Leser dürfte diese Version, die statt der Treue die Scham zum ethischen Ideal erklärt, befremdet haben. Daher illustriert Ovid sein Konzept mit einem Mythos, der schon aufgrund seines archaischen Ursprungs bestens geeignet ist, seine neuartigen Thesen zu belegen. Ovid übernimmt die Episode aus der Odyssee und gibt ihr einen eigenen, spezifischen Charakter. Wie spezifisch Ovids Version der Ehebruchsnovelle von Ares und Aphrodite ist, soll Gegenstand meiner folgenden Ausführungen sein.
Den Schwerpunkt bildet der Vergleich des Demodokos-Liedes mit der ovidischen Fassung aus der Ars Amatoria. In der Einzelanalyse der Ars-Version sollen Aufbau, Inhalt und Einordnung in das zweite Buch herausgearbeitet werden. Es wird zu zeigen sein, dass beide Versionen zwar analog sind, doch in ihrer Einzelheit erhebliche Unterschiede aufweisen. Schließlich sind in diesem Zusammenhang noch Überlegungen zu einen allgemeinen Rahmen anzustellen, innerhalb dessen der Autor und seine Zeit sowie die Komposition der Ars Amatoria vorgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ovid und seine Zeit
- 2.1 Leben und Werk
- 2.2 Historischer und gesellschaftlicher Kontext
- 3. Die Ars Amatoria
- 3.1 Allgemeines
- 3.2 Komposition
- 4. Die Ehebruchsnovelle von Ares und Aphrodite
- 4.1 Das Demodokos-Lied
- 4.2 Die Version des Demodokos-Liedes bei Ovid
- 4.2.1 Einordnung in das zweite Buch
- 4.2.2 Aufbau und Inhalt
- 4.2.3 Vergleich mit der Odyssee Fassung
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Ovids Version der Ehebruchsnovelle von Ares und Aphrodite in der Ars Amatoria. Die Zielsetzung besteht darin, Ovids Bearbeitung des bekannten Mythos im Kontext seines Gesamtwerks und seiner Zeit zu analysieren und die spezifischen Unterschiede zu der ursprünglichen Version in der Odyssee herauszuarbeiten. Der Fokus liegt auf einem detaillierten Vergleich beider Versionen, wobei Aufbau, Inhalt und die Einordnung in das zweite Buch der Ars Amatoria im Mittelpunkt stehen.
- Ovids Leben und Werk im Kontext des augusteischen Roms
- Analyse der Ars Amatoria als Lehrgedicht und dessen Zielgruppe
- Vergleich der Darstellung der Ares-Aphrodite-Novelle in der Odyssee und der Ars Amatoria
- Untersuchung der Unterschiede in Aufbau, Inhalt und Intention beider Versionen
- Ovids spezifische Interpretation des Mythos und seine Funktion innerhalb der Ars Amatoria
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt Ovid als einen der bedeutendsten Dichter der klassischen Epoche vor. Sie hebt die Bedeutung seiner Werke für das Verständnis der antiken Mythologie hervor und fokussiert auf Ovids Bearbeitung des Mythos um Ares und Aphrodite, der in verschiedenen Versionen, inklusive der Odyssee und der Ars Amatoria, vorkommt. Die Arbeit kündigt den Vergleich der ovidischen Version mit der homerischen Vorlage an und benennt die zentralen Fragestellungen der Analyse.
2. Ovid und seine Zeit: Dieses Kapitel beleuchtet Ovids Leben und Werk im Kontext seiner Zeit. Es beschreibt sein Leben, seine Karriere als Dichter, seine Beziehungen zu wichtigen Persönlichkeiten der römischen Gesellschaft und die Umstände seiner Verbannung nach Tomis. Die biographischen Details werden mit Informationen über den historischen und gesellschaftlichen Kontext des augusteischen Roms verknüpft, um die literarischen und politischen Einflüsse auf Ovids Schaffen zu verstehen. Das Kapitel betont die Bedeutung von Augustus' Herrschaft und seinen Bestrebungen zur Erneuerung der römischen Gesellschaft und Kultur, sowie den Einfluss auf Ovids künstlerisches Werk.
3. Die Ars Amatoria: Das Kapitel beschreibt die Ars Amatoria als Lehrgedicht zur Liebeskunst und behandelt wichtige Aspekte wie Komposition, Stil und die Zielgruppe dieses umstrittenen Werkes. Es untersucht die didaktische Struktur des Gedichts und seine provokanten Aussagen über Liebe und Sexualität, welche im Widerspruch zu den von Augustus geförderten traditionellen Werten standen. Der Fokus liegt auf der Präsentation von Ovids Konzept von "lascivus amor" und der Frage, wie er seine neuartigen Thesen darstellt. Es wird thematisiert, welche Rezeption der Text in der damaligen Zeit erfahren haben könnte.
4. Die Ehebruchsnovelle von Ares und Aphrodite: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Vergleich der Darstellung des Mythos in der Odyssee und der Ars Amatoria. Es analysiert die ovidische Fassung hinsichtlich Aufbau, Inhalt und Einordnung in das zweite Buch der Ars Amatoria. Der Vergleich soll die spezifischen Unterschiede und Ovids eigene Interpretation des Mythos aufzeigen. Dabei werden die jeweiligen Erzähltechniken, die Charakterisierung der Figuren und die Funktion der Episode innerhalb der jeweiligen Werke genauer untersucht. Es geht um die Frage, wie Ovid den Mythos adaptiert und für seine Zwecke umformt, um seine eigenen Thesen in der Ars Amatoria zu unterstützen.
Schlüsselwörter
Ovid, Ars Amatoria, Ehebruch, Ares, Aphrodite, Demodokos-Lied, Odyssee, Mythos, Vergleich, augusteisches Rom, Liebesdichtung, antike Literatur, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Ovids Version der Ehebruchsnovelle von Ares und Aphrodite in der Ars Amatoria"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert Ovids Version der Ehebruchsnovelle von Ares und Aphrodite, wie sie im zweiten Buch der Ars Amatoria erscheint. Der Fokus liegt auf einem detaillierten Vergleich mit der ursprünglichen Version in Homers Odyssee, wobei Aufbau, Inhalt und die Funktion der Novelle innerhalb des Gesamtkontextes der Ars Amatoria untersucht werden.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Ovids Bearbeitung des bekannten Mythos im Kontext seines Gesamtwerks und seiner Zeit zu analysieren. Es soll herausgearbeitet werden, wie Ovid den Mythos adaptiert und für seine Zwecke in der Ars Amatoria umformt. Ein zentraler Aspekt ist der Vergleich der beiden Versionen hinsichtlich Aufbau, Inhalt und Intention.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Ovids Leben und Werk im Kontext des augusteischen Roms; die Ars Amatoria als Lehrgedicht und ihre Zielgruppe; ein detaillierter Vergleich der Ares-Aphrodite-Novelle in der Odyssee und der Ars Amatoria; die Untersuchung der Unterschiede in Aufbau, Inhalt und Intention beider Versionen; und schließlich Ovids spezifische Interpretation des Mythos und seine Funktion innerhalb der Ars Amatoria.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zu Ovid und seiner Zeit, ein Kapitel zur Ars Amatoria, ein Kapitel zum Vergleich der Ehebruchsnovelle in beiden Werken und eine Zusammenfassung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas und trägt zum Gesamtverständnis bei.
Was wird im Kapitel zu Ovid und seiner Zeit behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet Ovids Leben, seine Karriere als Dichter, seine Beziehungen zu wichtigen Persönlichkeiten und die Umstände seiner Verbannung. Es verknüpft biographische Details mit Informationen über den historischen und gesellschaftlichen Kontext des augusteischen Roms, um die literarischen und politischen Einflüsse auf sein Werk zu verstehen.
Was wird im Kapitel zur Ars Amatoria behandelt?
Das Kapitel beschreibt die Ars Amatoria als Lehrgedicht zur Liebeskunst. Es behandelt Aspekte wie Komposition, Stil und Zielgruppe, untersucht die didaktische Struktur und die provokanten Aussagen über Liebe und Sexualität im Kontext der augusteischen Moralvorstellungen. Der Fokus liegt auf Ovids Konzept von "lascivus amor" und seiner Darstellung.
Was ist der Schwerpunkt des Kapitels zur Ehebruchsnovelle?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Vergleich der Darstellung des Mythos in der Odyssee und der Ars Amatoria. Es analysiert die ovidische Fassung hinsichtlich Aufbau, Inhalt und Einordnung in das zweite Buch der Ars Amatoria und untersucht die Unterschiede in Erzähltechnik, Figurencharakterisierung und Funktion der Episode innerhalb der jeweiligen Werke.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ovid, Ars Amatoria, Ehebruch, Ares, Aphrodite, Demodokos-Lied, Odyssee, Mythos, Vergleich, augusteisches Rom, Liebesdichtung, antike Literatur, Interpretation.
- Quote paper
- Fanny Jasmund (Author), 2018, Ovids Version der Ehebruchsnovelle von Ares und Aphrodite in der Ars Amatoria, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/431652