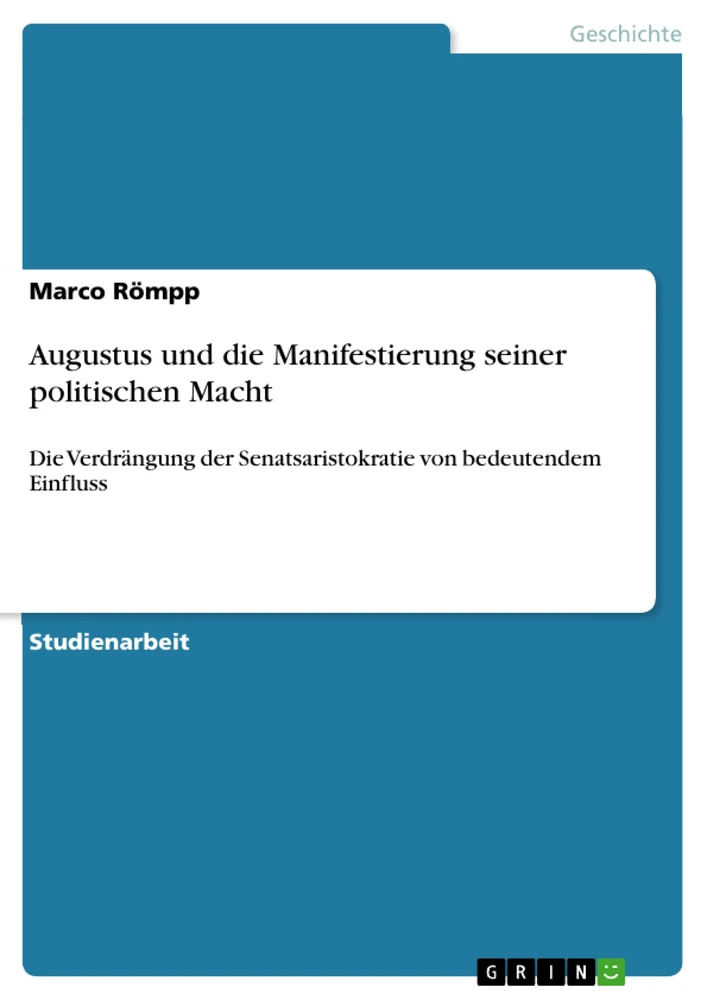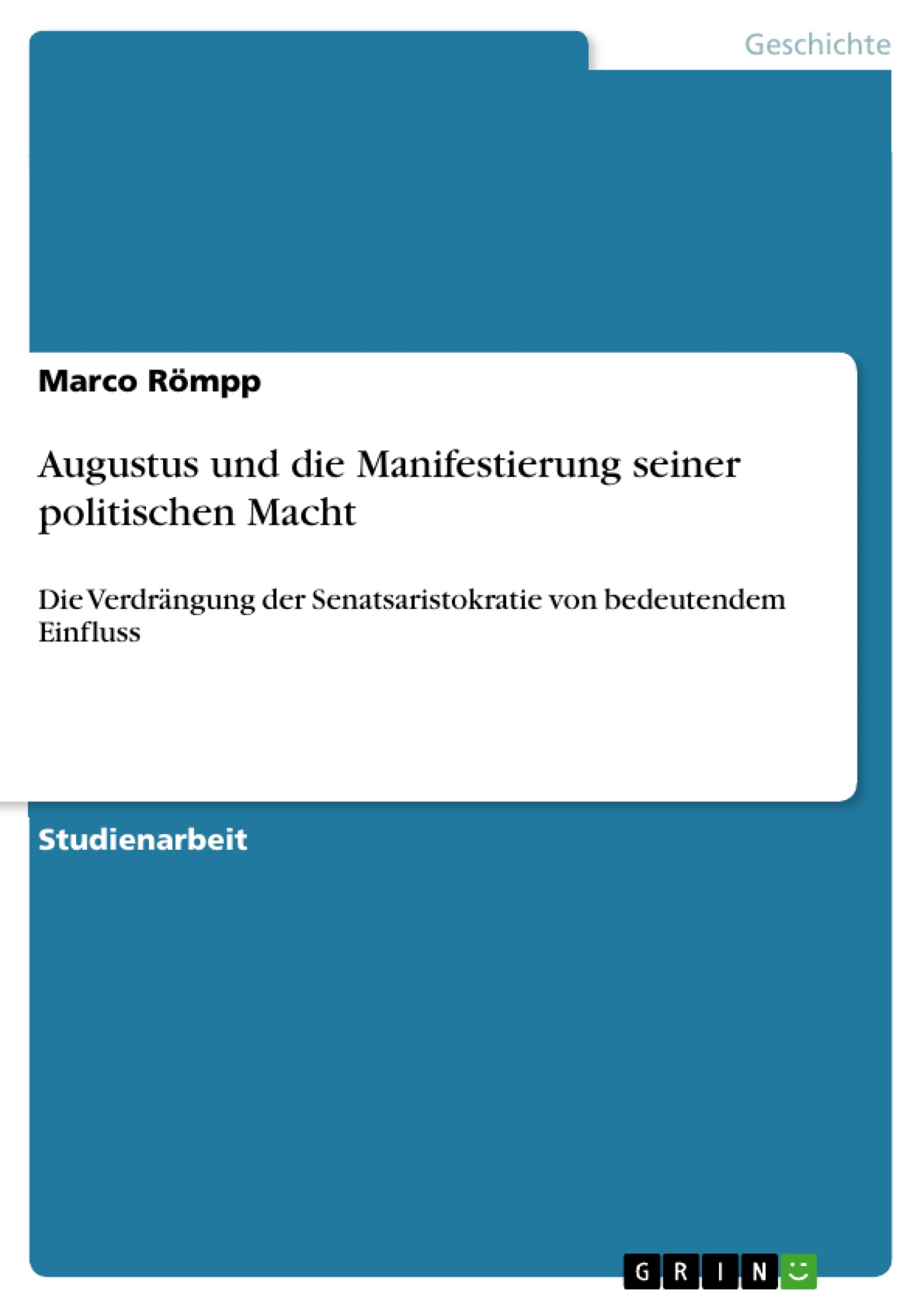In dieser Seminararbeit liegt der Fokus vorwiegend auf der Beziehung zwischen Augustus und dem Senat, die zwischen den Jahren 33 und 18 v.Chr., mehrfache Veränderungen mit sich brachte.
Innerhalb der Epoche von Augustus‘ Herrschaft nimmt die analysierte Thematik eine wesentliche Rolle ein, da hier durch ersichtlich wird, auf welcher Grundlage der Princeps seine verfassungsmäßigen Rechte erweitern und gleichzeitig die wiederhergestellte Macht der Senatsaristokratie stetig verkleinern konnte. Es soll bei dieser Untersuchung zudem ein hauptsächliches Augenmerk auf die Frage gelegt werden, inwiefern Augustus die Ausdehnung seiner politischen Befugnisse innerhalb der republikanischen Verfassung vollzog.
Die für diese Arbeit verwendeten Quellen machen hauptsächlich Schriften von antiken Autoren aus, jedoch wurde auch der von Augustus selbst verfasste Tatenbericht verwendet. Der meist zitierte Autor ist Cassius Dio, welcher insgesamt 80 Bücher über die Geschichte Roms schrieb und dessen Beschreibung über das Verhältnis zwischen Princeps und Senat die wohl ausführlichste ist. Dio schreibt vom Standpunkt eines Senators aus und sein verfasstes Material gilt als weitestgehend zuverlässig. Aus seinen Schilderungen lässt sich zudem ableiten, dass er Zugriff auf Senatsakten hatte. In der Forschung wird Dio zugleich als kritischer Senator als auch Monarchist bewertet, die meist rezipierte Auffassung stammt jedoch von Jochen Bleicken, der Dio als einen Anhänger des augusteischen Staatsprinzips beschriebt, welches Augustus den Umständen seiner Zeit gemäß modifiziert habe.
„In consulatu sexto et septimo, postquam bella civilia exstinxeram, per consensum unsversorum potitus rerum omnium, rem publicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli.“ Mit diesen Worten beschreibt Augustus die Rückgabe der res publica im Jahre 27 v.Chr., die ihn entgegen möglicher Vermutungen nicht in seiner politischen Macht zurückwarf, sondern durch die er der römischen Aristokratie ihre langjährigen Herrschaftsansprüche abnehmen konnte. Aufgrund der Wirren der Bürgerkriege waren der Senat und das Volk nicht in der Lage, die politische Verantwortung für das römische Reich selbstständig zu übernehmen. Durch seine militärischen Verdienste gegen die als „aus dem Osten“ proklamierte Gefahr empfahl sich Augustus dafür, tragende Aufgaben als damaliger Consul für das Gemeinwesen zu übernehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der politische Sieg gegen Antonius (33 - 31 v.Chr.)
- Der Kampf um die Gunst des Senats
- Octavians rechtliche Stellung nach Ende des zweiten Triumvirats
- Der Ausbau der Machtbefugnisse gegenüber dem Senat (30 - 23 v.Chr.)
- Das anfängliche Verhältnis zur Senatsaristokratie
- Veränderungen durch den Beginn des Principats
- Die Etablierung der Alleinherrschaft (23 – 18 v.Chr.)
- Die Aufgabe des Consulats
- Die faktische Entmachtung der römischen Führungsschicht
- Ritterstand als Konkurrenz zum Senatsadel?
- Zur rechtlichen Bewertung des Principats
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit der Beziehung zwischen Augustus und dem Senat im römischen Reich zwischen den Jahren 33 und 18 v.Chr. Ziel der Arbeit ist es, die stetige Veränderung dieses Verhältnisses zu analysieren und aufzuzeigen, wie Augustus seine politische Machtbefugnisse ausbauen und gleichzeitig die Macht der Senatsaristokratie einschränken konnte. Im Fokus steht dabei die Frage, wie Augustus die Ausdehnung seiner Macht innerhalb der republikanischen Verfassung vollzog.
- Die politische Auseinandersetzung zwischen Augustus und Antonius und deren Einfluss auf den Senat
- Die rechtliche Stellung Augustus' vor Beginn des Principats und nach dem Sieg gegen Antonius
- Die Veränderungen im Verhältnis zwischen Augustus und dem Senat während der Etablierung des Principats
- Die Rolle des Ritterstandes im Kontext der Machtverschiebung
- Die rechtliche Charakterisierung des Principats und seine Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Augustus und dem Senat
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel analysiert die politische Auseinandersetzung zwischen Augustus und Antonius im Kontext des zweiten Triumvirats. Es wird insbesondere auf die Rolle des Senats bei der Förderung der Interessen beider Kontrahenten eingegangen. Das zweite Kapitel beleuchtet Octavians rechtliche Stellung nach dem Sieg gegen Antonius und setzt sich mit der Frage auseinander, inwieweit Augustus den Senat für seine machtpolitischen Ambitionen nutzte. Im dritten Kapitel wird die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Augustus und dem Senat während des Aufbaus des Principats untersucht. Dabei werden die anfänglichen Kompromisse und die schrittweise Entmachtung der Senatsaristokratie durch Augustus beschrieben. Im vierten Kapitel geht es um die Etablierung der Alleinherrschaft Augustus' und die damit einhergehende faktische Entmachtung der römischen Führungsschicht. Das fünfte Kapitel widmet sich der Frage, ob der Ritterstand eine Alternative zur Senatsaristokratie für Augustus darstellte. Das sechste Kapitel behandelt die rechtliche Bewertung des Principats und die Folgen für das Verhältnis zwischen Augustus und dem Senat.
Schlüsselwörter
Augustus, Senat, römisches Reich, Principat, Senatsaristokratie, Ritterstand, politische Macht, rechtliche Stellung, Republikanische Verfassung, Triumvirat, Actium, Antonius, Cassius Dio, Tacitus, Sueton, Res Gestae.
- Quote paper
- Marco Römpp (Author), 2017, Augustus und die Manifestierung seiner politischen Macht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429633