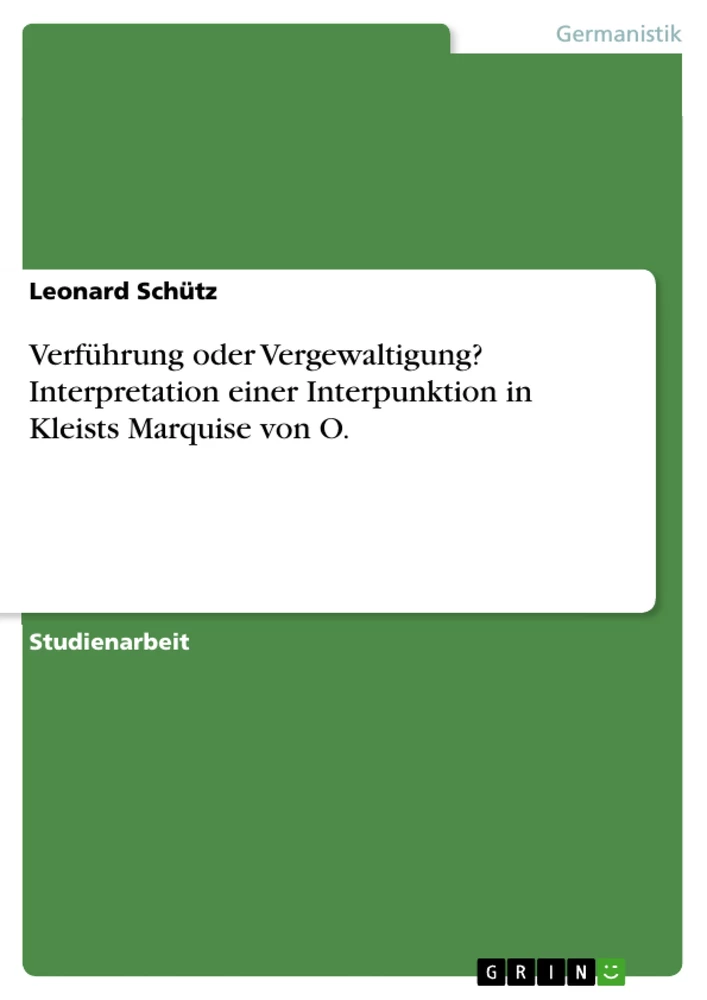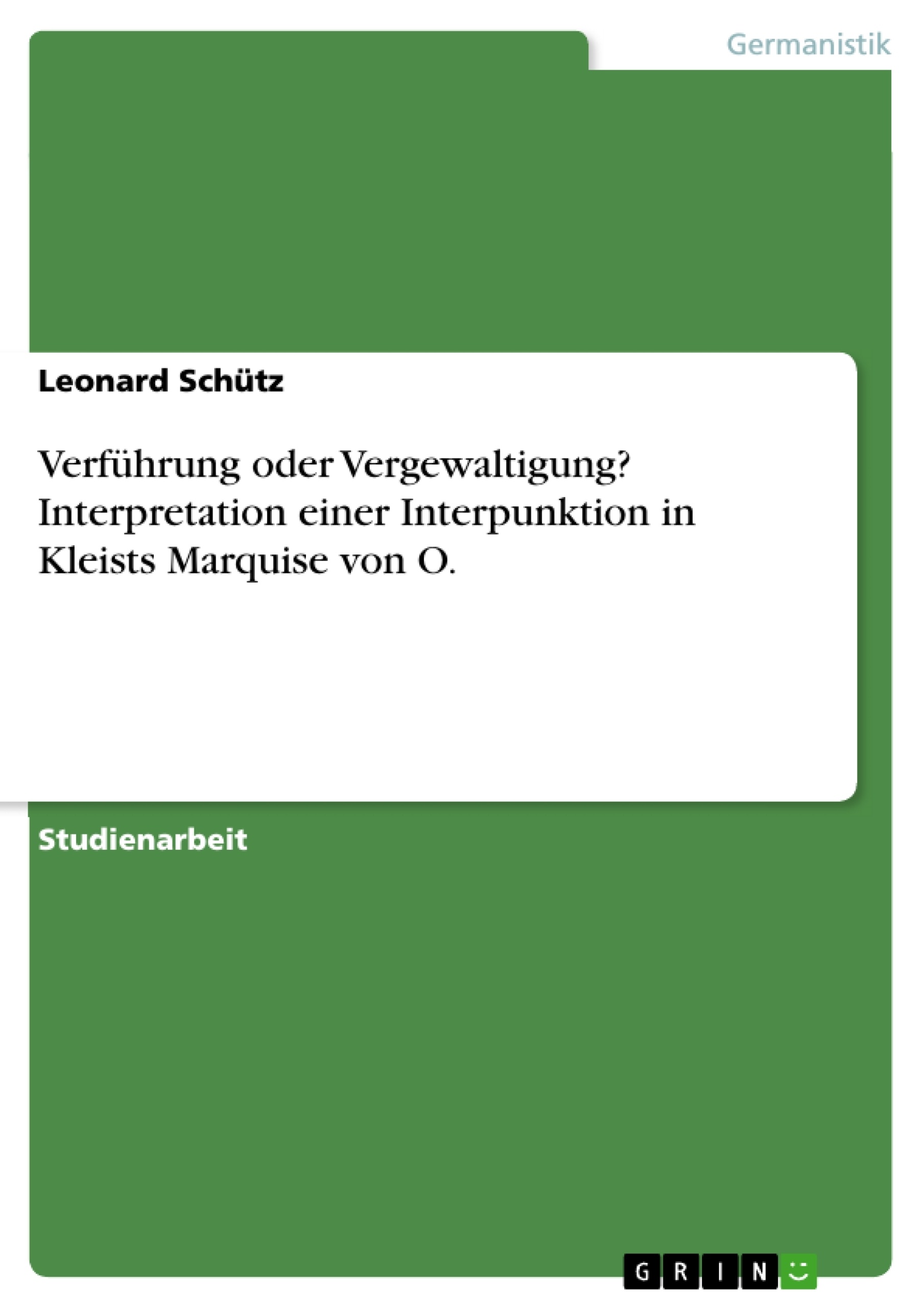Die Marquise von O. stellt, nachdem sie nach innerem Unwohlsein einen Arzt um Hilfe bat, fest, dass sie schwanger ist. Wie sich im späteren Verlauf der Novelle herausstellt, geschah ihre Empfängnis mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in einer Szene relativ zu Anfang, da bis zur Erkenntnis ihrer Schwangerschaft von keiner Situation berichtet wurde, in der sie in andere Umstände hätte kommen können. Daraus lässt sich schließen, dass der sich dort findende Halbgeviertstrich den Zeitpunkt der Empfängnis darstellt bzw. darstellen könnte, selbst wenn er bloß einer – wenn auch der erste – von 77 Gedankenstrichen in der Novelle sein mag. Was dem Leser jedoch in jedem Fall unklar bleibt, ist die Frage nach den näheren Umständen dieses Aktes. Explizit formuliert bleibt die Fragestellung, ob sich die Marquise verführen ließ, oder ob es sich um eine Vergewaltigung gehalten hat – also die grundlegende Thematik, ob die Marquise aus eigenem Interesse handelte oder nicht. Sicher ist lediglich, dass sie nicht bei vollem Bewusstsein war.
In der Arbeit soll genauer untersucht und insbesondere anhand von direkten Textverweisen deutlich gemacht werden, was es mit dem Gedankenstrich auf sich hat, der einer der populärsten, wenn nicht sogar, auch aus Mangel an Konkurrenz, der populärste Gedankenstrich der deutschen Literatur ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Gedankenstrich - Charakteristika und Rechtfertigungen
- „Gegen ihren Willen oder ohne ihr Wissen?"
- Motiv der Vergewaltigung
- Gesellschaftliche Werte
- Vergewaltigungsmotiv in der Literatur
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Gedankenstrich in Kleists Novelle „Die Marquise von O.“ und beleuchtet die Bedeutung dieses Interpunktionszeichens in Bezug auf die Frage, ob es sich um eine Verführung oder eine Vergewaltigung handelt.
- Analyse des Gedankenstrichs als rhetorisches Mittel in der Novelle
- Untersuchung der Umstände der Empfängnis der Marquise
- Beurteilung der möglichen Schuld des Grafen F.
- Diskussion der gesellschaftlichen Normen und moralischen Grenzen in der Zeit Kleists
- Interpretation der Bedeutung der Vergewaltigung im Kontext der Novelle
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Handelt es sich bei der Empfängnis der Marquise um eine Verführung oder eine Vergewaltigung? Der Gedankenstrich, der in der Novelle die entsprechende Szene markiert, wird als Ausgangspunkt der Analyse herangezogen.
Der Gedankenstrich - Charakteristika und Rechtfertigungen
Dieses Kapitel analysiert die Verwendung des Gedankenstrichs in Kleists Novelle. Es wird die Funktion des Interpunktionszeichens als rhetorisches Mittel untersucht und die möglichen Interpretationsmöglichkeiten des Gedankenstrichs in der entscheidenden Szene der Empfängnis erläutert.
„Gegen ihren Willen oder ohne ihr Wissen?"
Das Kapitel befasst sich mit der Frage, ob der Graf F. die Schuld an der Empfängnis der Marquise trägt. Die Analyse konzentriert sich auf die Interpretation der Novelle im Hinblick auf die Handlungsfreiheit der Marquise und die möglichen Konsequenzen für die Beurteilung der Situation.
Motiv der Vergewaltigung
Dieses Kapitel beleuchtet das Motiv der Vergewaltigung in der Novelle. Es werden die gesellschaftlichen Werte und die literarische Tradition des Themas Vergewaltigung in Kleists Zeit erörtert. Die Analyse zielt darauf ab, die Bedeutung der Vergewaltigung im Kontext der Novelle zu verstehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert zentrale Aspekte der Novelle „Die Marquise von O.“. Wichtige Themenschwerpunkte sind der Gedankenstrich als Interpunktionszeichen und rhetorisches Mittel, die Frage nach der Schuld und Verantwortung, die Analyse von Machtverhältnissen, die Rekonstruktion der historischen und gesellschaftlichen Kontexte, die Interpretation von Gewalt und die Auseinandersetzung mit moralischen und ethischen Fragen.
- Quote paper
- Leonard Schütz (Author), 2015, Verführung oder Vergewaltigung? Interpretation einer Interpunktion in Kleists Marquise von O., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429475