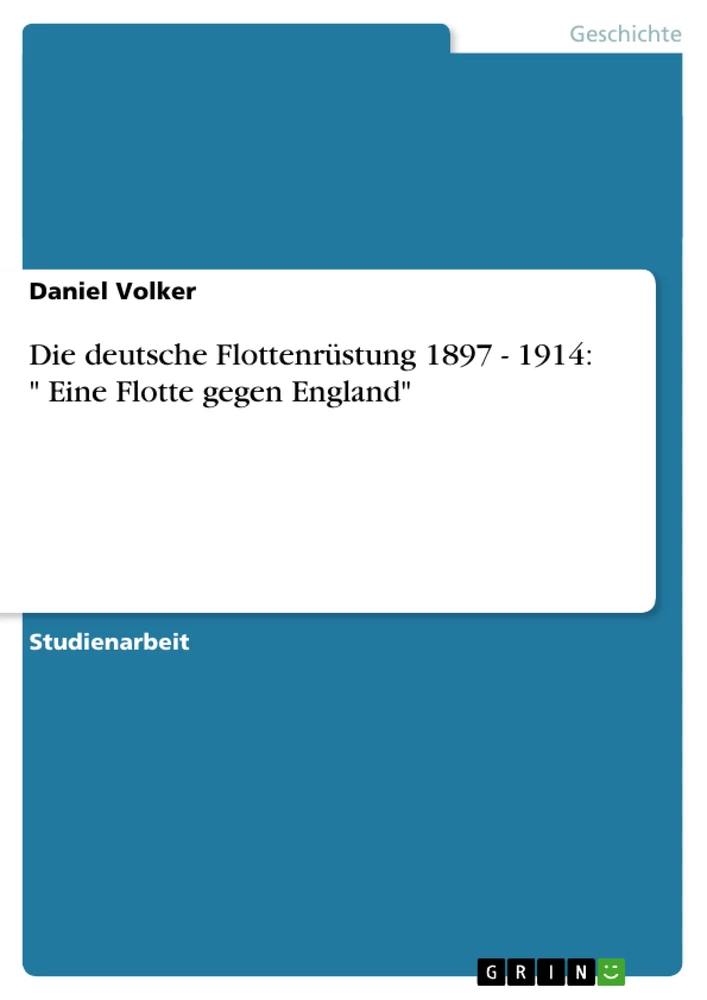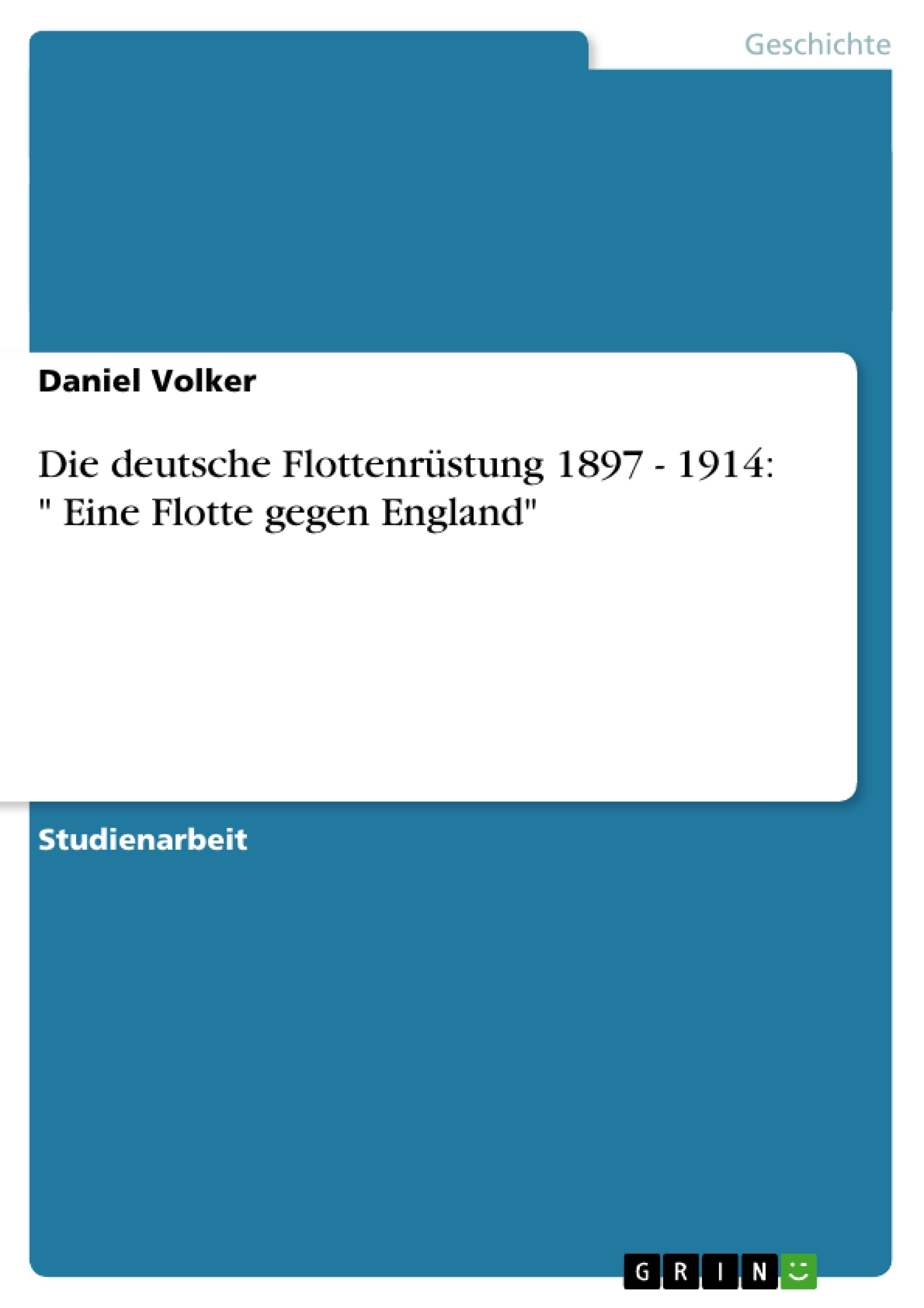„Die Seeinteressen Deutschlands sind seit der Errichtung des Reiches in ganz ungeahnter Weise gestiegen. Ihre Erhaltung ist zu einer Lebensfrage Deutschlands geworden.“1
Diese im Jahr 1898 von Großadmiral Alfred von Tirpitz getätigte Aussage zeigt deutlich auf welche Ziele die deutsche Marinepolitik seit dessen Amtsbeginn verfolgte. Es wurde als eine Notwendigkeit angesehen eine starke Flotte zu bauen, die imstande war, den deutschen Handel und die deutsche Industrie zu schützen. Hierbei wurde besonderes Augenmerk auf die englische Flotte gelegt, die zu der Zeit die führende Seemacht weltweit war. Zudem sollte eine starke deutsche Flotte dazu dienen die halbhegemoniale Stellung Deutschlands auf dem Kontinent in eine hegemoniale zu wandeln. In dieser Arbeit soll die deutsche Flottenbaupolitik und die damit verbundenen Schwierigkeiten einer Verständigung mit England, unter der Fragestellung ob es sich bei der deutschen Flotte um eine Flotte gegen England gehandelt hat und ob der deutsch-englische Antagonismus nicht auch auf diplomatischer Basis hätte beigelegt werden können, analysiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beginn des Flottenbaus 1897-1906
- Der Tirpitz-Plan
- Das Flottengesetz von 1898 und die Novelle von 1900
- Der Dreadnought- Sprung und seine Folgen
- Der Dreadnought- Sprung - Startschuss zum offenen Wettrüsten
- Verfall des Tirpitz- Planes
- Ziel des deutschen Flottenbaus und seine Auswirkung auf die deutsch englischen Beziehungen
- Eine Flotte gegen England
- Verständigung oder Konfrontation mit England unter Bülow
- Die Haldane Mission und ihre Folgen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die deutsche Flottenbaupolitik in der Zeit von 1897 bis 1914 und die damit verbundenen Schwierigkeiten einer Verständigung mit England. Die Arbeit beleuchtet die Frage, ob die deutsche Flotte tatsächlich als „Flotte gegen England“ betrachtet werden kann und ob ein Antagonismus zwischen Deutschland und England auf diplomatischer Ebene hätte beigelegt werden können.
- Der Tirpitz-Plan und seine Ziele
- Der Dreadnought- Sprung und seine Folgen für den Flottenbau
- Die deutsch-englischen Beziehungen und die Bemühungen um Verständigung
- Die Rolle der deutschen Flotte im internationalen Kontext
- Die innenpolitischen Aspekte des Flottenbaus
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet den Beginn des deutschen Flottenbaus von 1897 bis 1906. Es werden der Tirpitz-Plan und seine Ziele sowie die ersten Schritte zur Umsetzung des Planes beschrieben, darunter das Flottengesetz von 1898 und die Flottennovelle von 1900.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Dreadnought- Sprung und seinen weitreichenden Folgen für den Tirpitz-Plan. Es wird analysiert, wie der Dreadnought- Sprung das deutsch-englische Wettrüsten weiter verschärfte und den Tirpitz-Plan in Frage stellte.
Das dritte Kapitel untersucht das deutsch-englische Verhältnis und die Versuche einer Verständigung, insbesondere die Haldane Mission. Es wird beleuchtet, ob und wie die Ziele des Tirpitz-Plans, eine Flotte gegen England zu bauen, die deutsch-englischen Beziehungen beeinflussten.
Schlüsselwörter
Deutsche Flottenrüstung, Tirpitz-Plan, Dreadnought- Sprung, deutsch-englische Beziehungen, Wettrüsten, Verständigung, Seemacht, Hegemonie, Imperialismus, Handelsschutz, Kriegsführung.
- Quote paper
- Daniel Volker (Author), 2004, Die deutsche Flottenrüstung 1897 - 1914: " Eine Flotte gegen England", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42935