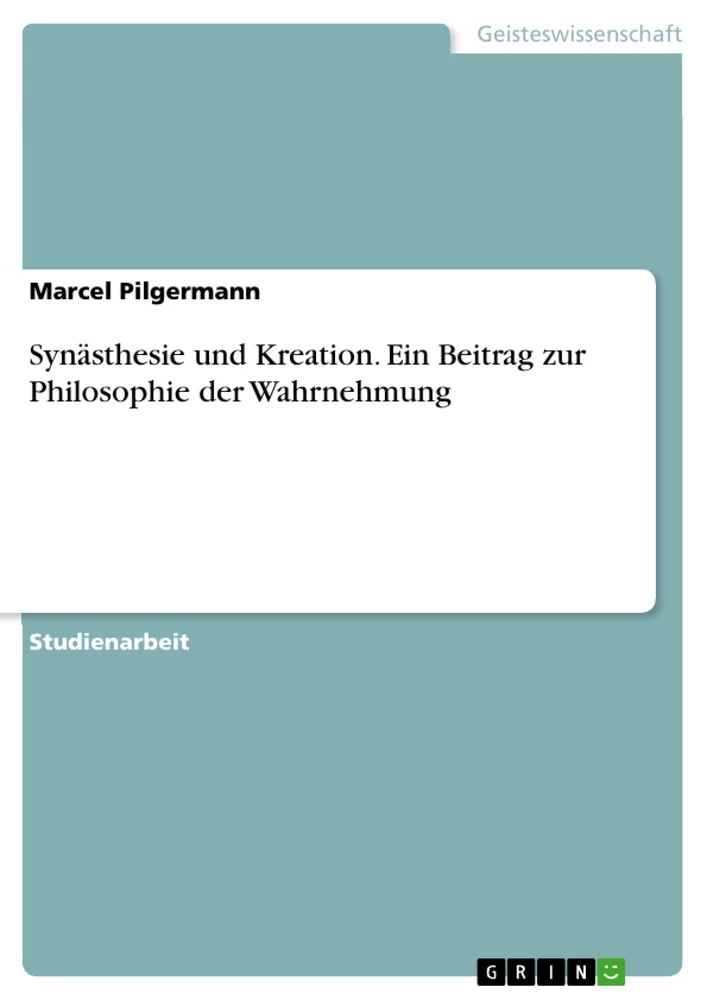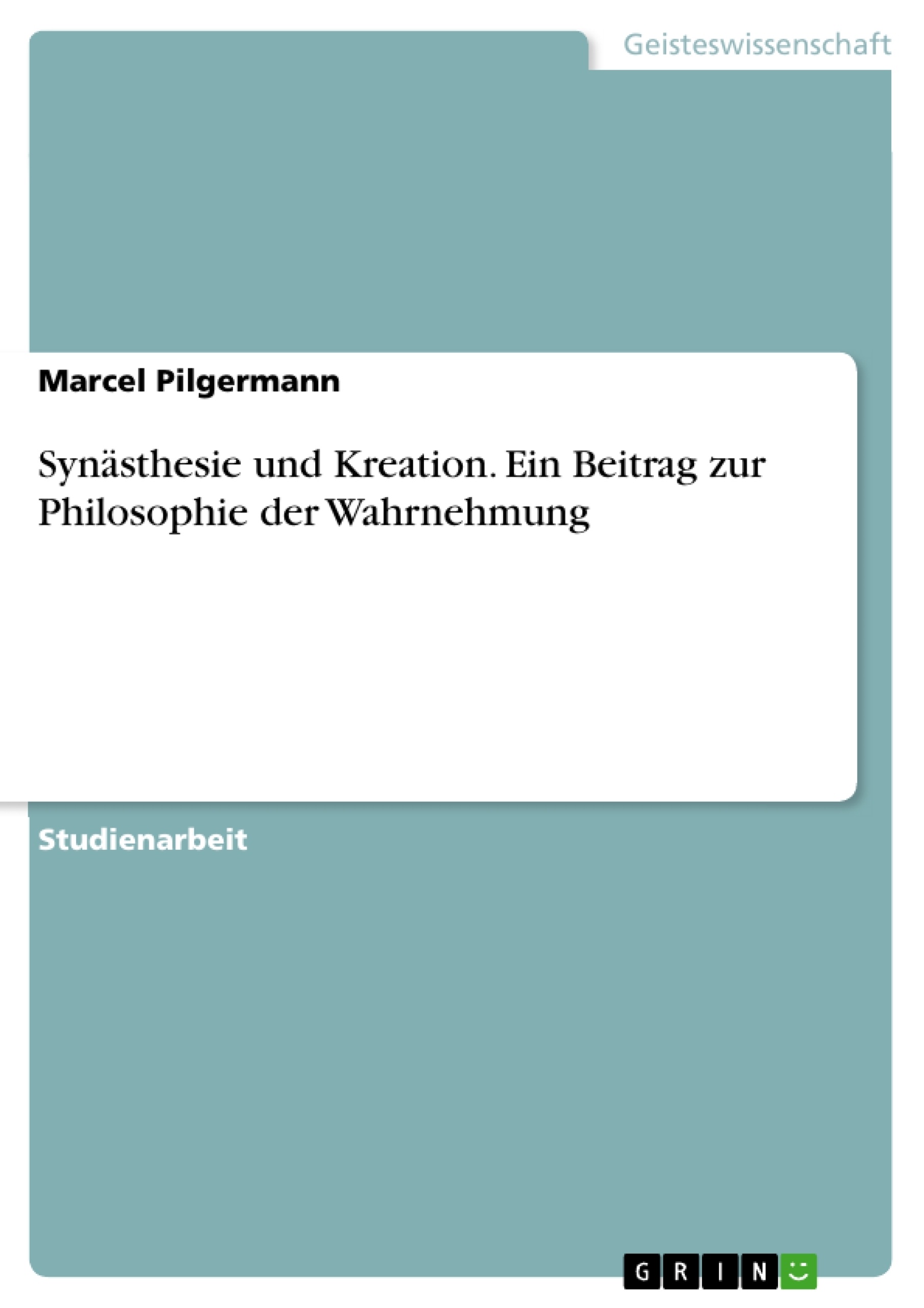Diese Arbeit versucht die Frage, wie sich synästhetische Erfahrungen auf das künstlerische Schaffen auswirken, philosophisch zu beantworten. Besagter Prozess lässt sich dabei etwa mithilfe des Werkes Heideggerscher Provenienz beschreiben. Die Arbeit versucht darüber hinaus zu zeigen, dass dies außerdem in Anlehnung an eine ganz andere Gedankenwelt möglich ist, nämlich an die, die sich im frühen radikalen Surrealismus literarisch in Bretons erstem surrealistischem Manifest ausdrückt.
Die Arbeit stellt somit zwei sehr unterschiedliche Konzeptionen nebeneinander, womit auch dem Umstand Rechnung getragen wird, dass der künstlerische Prozess kaum als notwendiges Geschehen gefasst werden kann, sondern Entscheidungen des Künstlers impliziert. In diesem Sinne ist Heideggers Kunsttheorie eher an der Auseinandersetzung mit dem Material orientiert, während Bretons Surrealismus auf das Bewusstsein, bzw. die noch unbewussten angrenzenden Bezirke der Psyche, fokussiert (s. Kap. 3).
Die Arbeit interpretiert die beiden Autoren, Heidegger und Breton, offensichtlich auch, eben anhand ihrer eigenständigen Fragestellung. Breton kommt hier ihrem Urteil zufolge dem Impetus der Empirie sehr viel näher als Heidegger (s. Kap. 2.2), was wiederum die Diskussion mit der neurophysiologischen Forschung ermöglichen könnte.
In beiden Interpretationen lässt sich die neurophysiologische Synästhesie als ein Übergang zu etwas Allgemeinem verstehen, zu einer allgemein menschlichen Möglichkeit. Diese Vorstellung ist keineswegs weit hergeholt. Wir sehen ja, dass etwa Drogen das Phänomen hervorrufen können. Wir könnten auch Meditationstechniken auf diesen Effekt hin analysieren und untersuchen. Synästhesie ist - gewissermaßen im Grenzfall - schließlich noch als Foucaultsche Selbsttechnologie begreifbar, mit oder ohne Drogen; etwas jedenfalls, das sozial gelernt werden könnte: Synästhesie als Wahrnehmungstechnologie.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Imitatio
- Entbergung des Seins
- Automatismus der Psyche
- Zur Rolle des Bewusstseins
- Romantik
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, den Einfluss synästhetischer Erfahrungen auf das künstlerische Schaffen philosophisch zu beleuchten. Sie untersucht, wie die Verbindung verschiedener Sinneswahrnehmungen, ein Phänomen, das bei Synästhesisten beobachtet wird, die Kreativität beeinflusst und sich in der Kunst niederschlägt.
- Synästhesie als Normvariante und ihre neurophysiologischen Grundlagen
- Die Rolle des Bewusstseins in der künstlerischen Kreation
- Heideggers Kunsttheorie und ihre Relevanz für die Analyse des künstlerischen Prozesses
- Der Surrealismus als Kontrastmodell zur Kunsttheorie Heideggers
- Synästhesie als Übergang zu einer allgemein menschlichen Möglichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt Synästhesie als ein neurophysiologisches Phänomen vor und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext von Kunst und Kreativität. Die Arbeit betrachtet den künstlerischen Prozess als ein komplexes Zusammenspiel von Wahrnehmung, Bewusstsein und Kreativität.
- Das Kapitel "Imitatio" befasst sich mit dem Übergang von Wahrnehmung zu Kreation im Allgemeinen. Im Rahmen von Heideggers Kunsttheorie wird die "Entbergung des Seins" als ein wesentlicher Aspekt der Kunst betrachtet, die durch die "Imitatio" der Natur die Wahrheit des Seienden eröffnet.
- Das Kapitel "Automatismus der Psyche" analysiert Bretons Surrealismus als ein Gegenmodell zu Heideggers Kunsttheorie. Der Surrealismus fokussiert auf das Bewusstsein und die unbewussten Bereiche der Psyche, während Heidegger den Schwerpunkt auf das "Dasein" als Ursprung des Kunstwerkes legt.
Schlüsselwörter
Synästhesie, Kreation, Kunsttheorie, Heidegger, Surrealismus, Wahrnehmung, Bewusstsein, "Entbergung des Seins", Automatismus der Psyche, Imitatio, Selbsttechnologie.
- Citar trabajo
- Marcel Pilgermann (Autor), 2015, Synästhesie und Kreation. Ein Beitrag zur Philosophie der Wahrnehmung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/429044