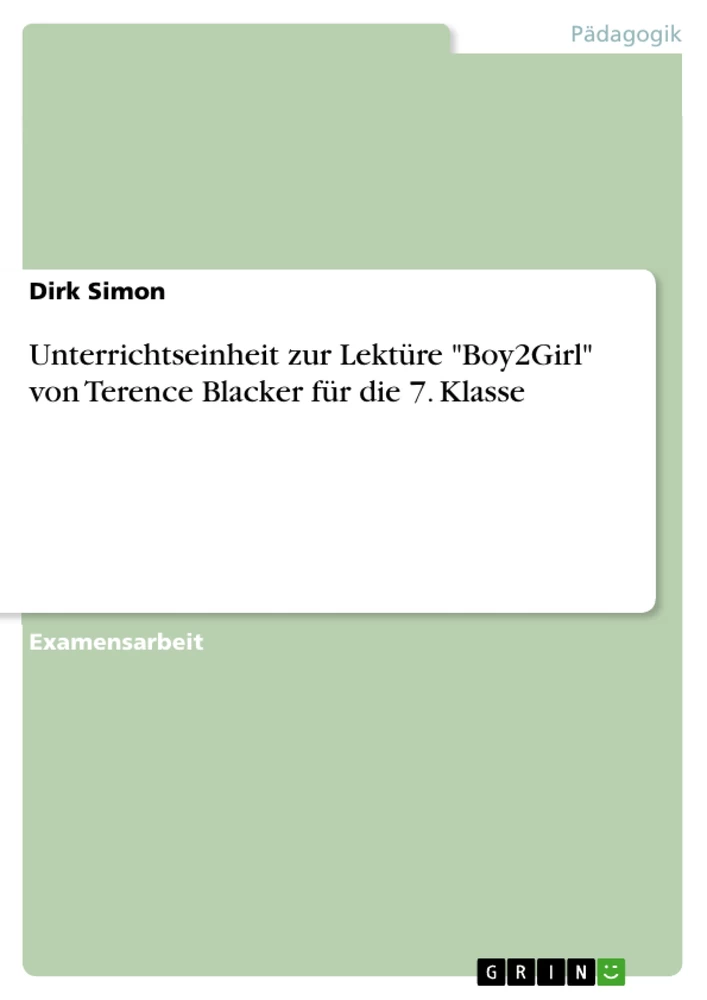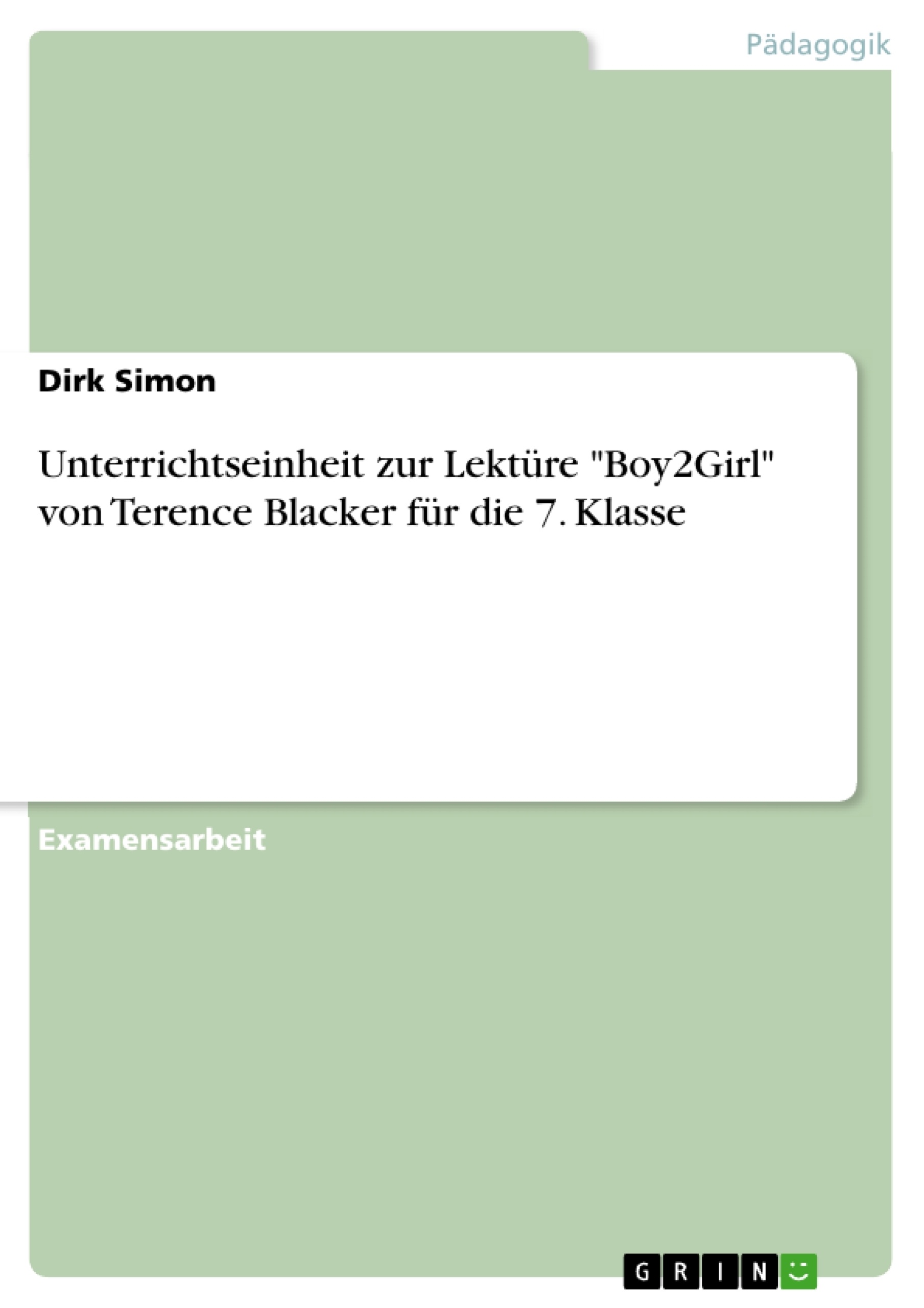Das Lesen von Büchern in der heutigen Mediengesellschaft ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Das Buch steht dabei in ständiger Konkurrenz mit anderen Medien. Jugendliche sehen sich zunehmend einem vielfältigen Medienangebot ausgesetzt, das in ihrem Freizeitverhalten eine immer größere Rolle spielt. Sei es das Fernsehprogramm, das Spielen eines Computerspiels, das Surfen im Internet, das Verweilen in Sozialen Netzwerken: Die Jugendlichen von heute wachsen mit den Neuen Medien in einer veränderten Kindheit auf. Die Medien spielen in der Welt der Aufwachsenden eine viel stärkere Rolle als in den Generationen davor. Diese Entwicklung geht einher mit neuen Familienmodellen, einer Technisierung des Alltags und veränderter Umgang mit der Zeit. Die Medienerfahrung von Kindern setzt in immer früheren Jahren ein. Dies kennzeichnet den Begriff der veränderten Kindheit.
Der Umgang mit diesen Medien ist ein wichtiges Kapitel in der heutigen Informations- und Mediengesellschaft, verlangt aber eine andere Wahrnehmung als das Lesen eines Buches. Das oberflächliche, zerstreuende Surfen oder auch die hochkonzentrierte Online-Recherche mit den hypertextuellen Verweisen im Internet verlangt eine andere Lese- und Denkgewohnheit des Rezipienten. Ein vernetzter Computer schirmt nicht von äußeren Einflüssen ab, sondern verweist auf weiterführende Seiten und steht im Austausch mit weiteren Medien (z.B. Webcam, Videos). Diese Art der Wahrnehmung ist eine passive und wirkt durch ihre verschiedenen akustischen wie visuellen Möglichkeiten attraktiver als ein Buch.
Das Lesen rückt dadurch immer mehr in den Hintergrund. Ein Buch verweigert externe Einflüsse und verlangt vom Leser einen langen Atem: Gedankliche Tiefe sowie die Perspektivenübernahme und Reflexion über das Gelesene werden hierbei gefordert. Die Auseinandersetzung mit moralischen Problemen, die Sensibilisierung der Wahrnehmungsfähigkeit, die Identitätsbildung, das Fremdverstehen, kurz, die Literatur als Erfahrungsfeld.
Mit der Unterrichtseinheit zur Lektüre „Boy2Girl“ von Terence Blacker, die in der 7. Klasse der Unterstufe gehalten wurde, will ich zeigen, dass ein gut gewählter Roman viele interessante Möglichkeiten bietet, die Schüler zu fesseln und zu begeistern.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Sachanalyse der Lektüre „Boy2Girl“ (T. Blacker)
- III. Didaktische Analyse
- 1. Die didaktische Begründung des Romans
- 1.1. Klafkis Leitlinien
- 1.2 Der lernpsychologische Hintergrund
- 2. Zielsetzung der Lektüreeinheit
- 2.1. Einordnung der Sequenz in den Lehrplan
- 2.2. Fächerübergreifende Lernziele
- 2.3. Fachspezifische Lernziele
- 2.4. Die Lernziele
- 1. Die didaktische Begründung des Romans
- IV. Die Lerngruppe
- V. Der handlungs- und produktionsorientierte Literaturunterricht
- VI. Methodische Analyse
- VII. Die Unterrichtseinheit (Umfang: 12 Stunden)
- VIII. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert eine Unterrichtseinheit für die 7. Klasse, die sich mit dem Jugendbuch „Boy2Girl“ von Terence Blacker auseinandersetzt. Ziel ist es, die didaktischen und methodischen Aspekte der Lektüre zu beleuchten und die Einsatzmöglichkeiten im Deutschunterricht aufzuzeigen. Dabei werden die spezifischen Lernziele der Einheit sowie der handlungs- und produktionsorientierte Ansatz im Literaturunterricht berücksichtigt.
- Die Bedeutung von Literatur im Kontext der Mediengesellschaft
- Identitätsbildung und Selbstfindung im Jugendroman
- Die Bedeutung von Familie und Freundschaft im Jugendroman
- Der Einfluss von Vater-Kind-Beziehungen auf die Persönlichkeitsentwicklung
- Multiperspektivische Erzähltechniken und ihre Wirkung auf den Leser
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Unterrichtseinheit dar und beleuchtet die Bedeutung des Lesens in der heutigen Mediengesellschaft. Sie zeigt auf, welche Herausforderungen der Deutschunterricht im Umgang mit den Medien bewältigen muss.
Die Sachanalyse der Lektüre „Boy2Girl“ beschreibt die wichtigsten Figuren und Handlungsstränge des Romans. Sie beleuchtet die Entwicklung des Protagonisten Sam, der sich als Mädchen ausgibt, um in eine neue Rolle zu finden und mit seiner Vergangenheit Frieden zu schließen.
Die didaktische Analyse befasst sich mit der Begründung des Romans als Unterrichtslektüre. Dabei werden Klafkis Leitlinien sowie der lernpsychologische Hintergrund berücksichtigt.
Die Lerngruppe wird vorgestellt und auf deren spezifische Bedürfnisse im Hinblick auf die Lektüre eingegangen.
Der handlungs- und produktionsorientierte Literaturunterricht wird als pädagogischer Ansatz erläutert und seine Relevanz für die Arbeit mit dem Roman „Boy2Girl“ dargelegt.
Die methodische Analyse befasst sich mit den konkreten Methoden und Materialien, die in der Unterrichtseinheit eingesetzt werden.
Die Unterrichtseinheit selbst wird detailliert beschrieben und in ihrer Durchführung erläutert.
Schlüsselwörter
Jugendbuch, „Boy2Girl“, Terence Blacker, Identitätsbildung, Selbstfindung, Familie, Freundschaft, Vater-Kind-Beziehung, multiperspektivische Erzähltechnik, handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht.
- Quote paper
- Dirk Simon (Author), 2010, Unterrichtseinheit zur Lektüre "Boy2Girl" von Terence Blacker für die 7. Klasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428886