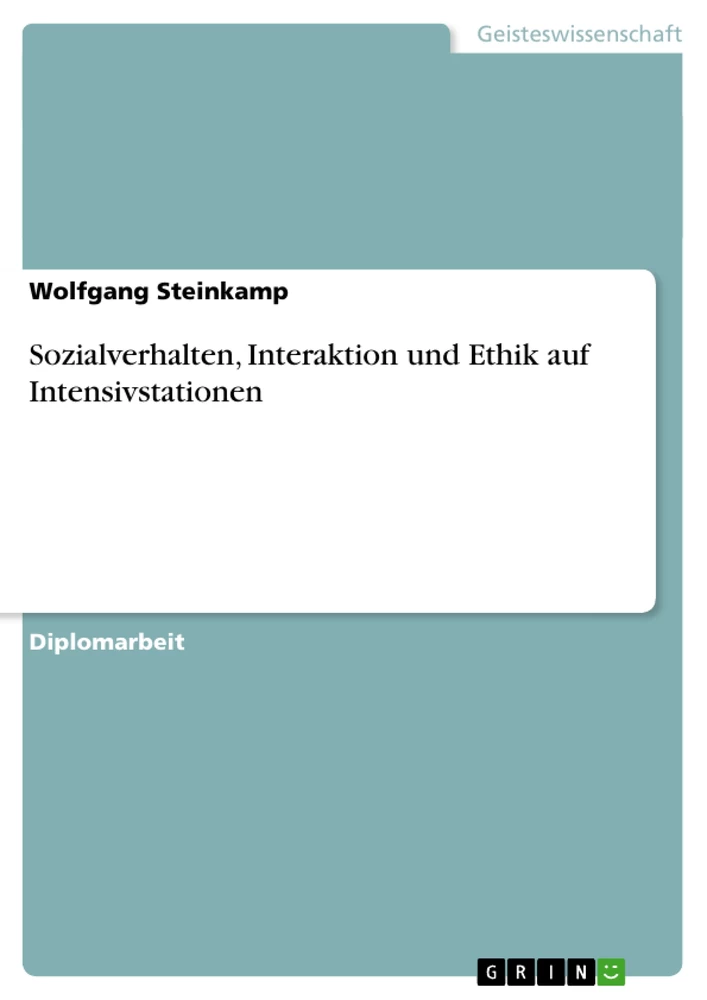Wie fühlt sich ein Patient auf einer Intensivstation?Wie fühlen sich Krankenpfleger und Arzt dort, sofern sie sich überhaupt noch mit ihren Gefühlslagen beschäftigen? Wie wirkt sich ein so extremes Arbeitsumfeld wie das einer Intensivstation auf seine Akteure aus? Das Buch beschäftigt sich praxisnah mit der gewöhnlichen Dramatik in der Todeskampfarena des intensivmedizinischen Alltags. Die Folge ist fast zwangsläufig: Eine erweiterte Auseinandersetzung mit der Frage nach der Ethik, der Würde und dem Stellenwert von übergeordeten und persönlichen humanitären Positionen im Alltag der Medizin.Was hat dort noch Bestand?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methodik
- Vorüberlegungen zur Ethik in der Medizin
- Zur aktuellen politischen Diskussion
- Ethik im Alltag der Medizin
- Rahmenbedingungen in der Intensivpflege
- Arbeitsorganisation
- Krankheitsbilder und Belastungsfaktoren
- Sozialverhalten und Interaktion zwischen Mitarbeitern und Patienten
- Das Verhältnis Arzt - Pflegepersonal
- Eine Zwischenbemerkung zur Forschungslage
- Gestörte Beziehungen
- Interaktion Personal - Patient
- Die Patientenrolle
- Zur Sicht des Patienten
- Zur psychischen Situation des Intensivpatienten
- Zur psychischen Situation der Pflegenden
- Der Todesfolgenberuf
- Zusammenfassung
- Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das psychosoziale Gefüge einer Intensivstation, indem sie die Arbeitsabläufe, die Arbeitsatmosphäre, die Konfliktfähigkeit und Belastbarkeit der Mitarbeiter und Patienten sowie die Schwierigkeiten beleuchtet, die sich aus dem intensiven medizinischen Alltag ergeben. Dabei wird der Fokus auf die Interaktionen zwischen medizinischem Personal und Patienten gelegt, um ein tieferes Verständnis für die besonderen Herausforderungen und Belastungen in diesem Arbeitsfeld zu entwickeln.
- Ethik in der Medizin und die Herausforderungen der Hirntoddiagnostik
- Arbeitsbedingungen und Belastungsfaktoren in der Intensivpflege
- Sozialverhalten und Interaktionen zwischen Mitarbeitern und Patienten
- Die psychische Situation von Intensivpatienten und deren Einfluss auf die Interaktionen
- Die psychische Belastung von Pflegepersonal im Kontext der Intensivmedizin
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Motivation des Autors für die Arbeit und beschreibt den Entstehungsprozess der Forschungsfrage. Die Methodik erläutert die methodische Vorgehensweise der Untersuchung.
Kapitel 2 beleuchtet die ethische Dimension der Medizin und fokussiert insbesondere auf die aktuellen Debatten rund um Sterbehilfe und die Definition des Todes. Es werden die Herausforderungen für Ärzte im Kontext der Organtransplantation und die Bedeutung der Hirntoddiagnostik beleuchtet.
Kapitel 3 beschreibt die besonderen Rahmenbedingungen der Intensivpflege, inklusive der Arbeitsorganisation und der typischen Krankheitsbilder und Belastungsfaktoren, denen die Mitarbeiter und Patienten auf dieser Station ausgesetzt sind.
Kapitel 4 befasst sich mit dem komplexen Thema des Sozialverhaltens und der Interaktionen zwischen medizinischem Personal und Patienten. Es wird das Verhältnis zwischen Ärzten und Pflegepersonal, die Herausforderungen bei der Kommunikation mit Patienten und die psychische Situation des Intensivpatienten betrachtet.
Kapitel 5 untersucht die psychische Situation der Pflegenden und analysiert die besonderen Herausforderungen und Belastungen, die diese Arbeit mit sich bringt. Es werden Faktoren beleuchtet, die zu bestimmten Verhaltensmustern führen können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Intensivmedizin, Sozialverhalten, Interaktion, Ethik, Hirntoddiagnostik, Sterbehilfe, Organtransplantation, Arbeitsbedingungen, Belastungsfaktoren, Patientenrolle, psychische Belastung, Mitarbeiterverhalten, Todesfolgenberuf.
Häufig gestellte Fragen
Welche ethischen Herausforderungen gibt es in der Intensivmedizin?
Zentrale Themen sind die Hirntoddiagnostik, die Organtransplantation, Sterbehilfe und die Wahrung der Patientenwürde in einer technisierten Umgebung.
Wie wirkt sich das Arbeitsumfeld Intensivstation auf das Personal aus?
Der ständige Kontakt mit dem Tod ("Todesfolgenberuf") führt zu hohen psychischen Belastungen, die das Sozialverhalten und die Interaktion mit Patienten und Kollegen beeinflussen können.
Wie nehmen Patienten die Rolle auf der Intensivstation wahr?
Patienten befinden sich oft in einer psychischen Ausnahmesituation, geprägt von Hilflosigkeit, Angst und dem Verlust der Autonomie, was ihre Interaktion mit dem Personal erschwert.
Welche Konflikte gibt es zwischen Ärzten und Pflegepersonal?
Die Arbeit analysiert gestörte Beziehungen, die aus unterschiedlichen Hierarchien, Belastungsfaktoren und Sichtweisen auf die Patientenversorgung resultieren können.
Was bedeutet "gewöhnliche Dramatik" im Klinikalltag?
Es beschreibt den täglichen Überlebenskampf und die emotionalen Extremsituationen, die auf einer Intensivstation zur Routine gehören, aber dennoch hohe Anforderungen an die Menschlichkeit stellen.
- Quote paper
- Wolfgang Steinkamp (Author), 1997, Sozialverhalten, Interaktion und Ethik auf Intensivstationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42814