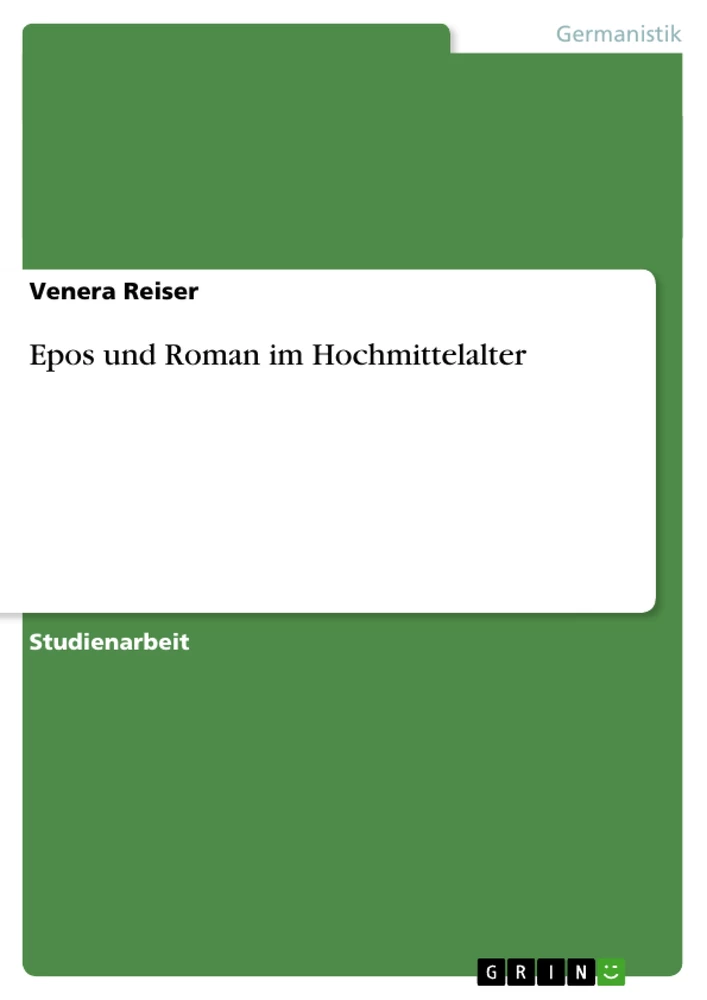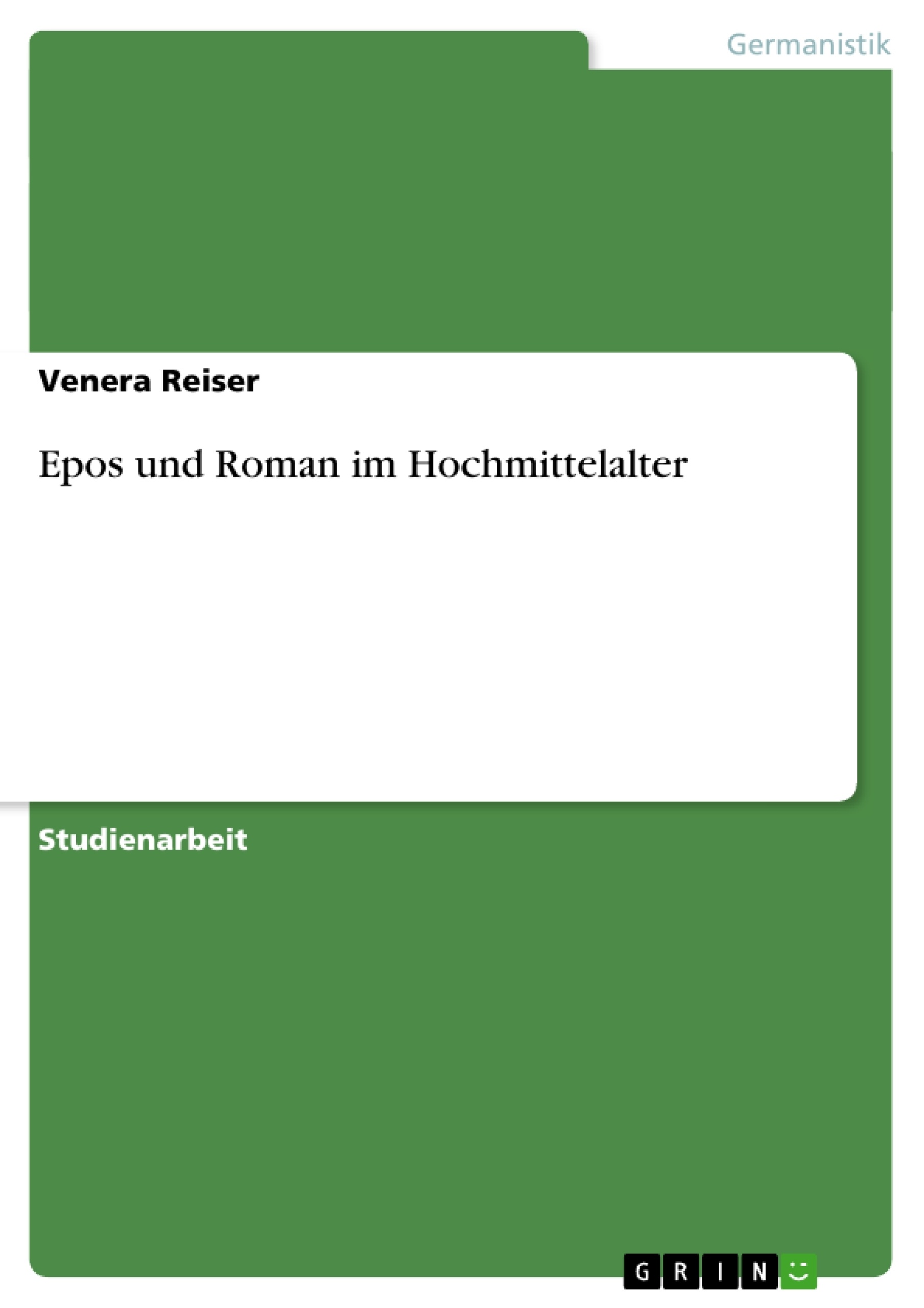Das hohe Mittelalter wird als eine Periode der Literaturgeschichte
verstanden, die etwa 1170 bis zum Ende des 13. Jahrhunderts reicht. Das
hohe Mittelalter wird als die Zeit definiert, in der die Fürstenhöfe das Bild
der Literatur bestimmt haben; und es wird abgegrenzt gegenüber dem
früheren Mittelalter, wo Literatur nur in Klöstern und Kirchen produziert
wurde.
„Mit Friedrich Barbarossa und der Machtentfaltung des staufischen
Kaisertums geht die Vorherrschaft der Geistlichen in der Literatur zu
Ende. Es entsteht die Kultur des Rittertums, das auch in der Dichtung
nach Selbstdarstellung in eigenen Formen drängt. Pflegestätten des
dichterischen Schaffens sind die Fürstenhöfe. Fürstliche Herren sind
häufig Gönner oder Auftraggeber der dichtenden Ritter.“
Mit der Entwicklung der Fürstenhöfe zu literarischen Zentren hat die
Literatur in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts binnen einer
Generation ein neues Gesicht bekommen. Die von den Höfen gesteuerte
Rezeption französischer Literaturformen begann um 1170 und hat
bewirkt, daß in kurzer Zeit eine spezifisch höfische Literatur entstand.
Allerdings sind auch die Klöster und Kirchen in der zweit en Hälfte des
12. Jahrhunderts literarisch produktiv geblieben.
„Die Kreuzzüge haben dem Rittertum sein Sendungsbewußtsein verliehen
und den Blick für das Fremde geöffnet. Es entsteht ein gemeineuropäisch
– christliches Kulturgefühl mit einer festgefügten Wertordnung und einer
frommen, aber diesseits gerichteten Haltung. Im höfischen Epos
erscheinen diese ritterliche Welt und ihr Menschenbild dichterisch
verklärt. Die Epoche der staufischen Klassik wird zur ersten Blütezeit der
deutschen Literatur.“ [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Anfänge der höfischen Literatur. Die Orientierung nach Frankreich
- Der Begriff des Höfischen
- Mündlichkeit und Schriftlichkeit
- Epen nach französischen Quellen
- Lamprecht: "Alexander"
- "Straßburger Alexander"
- Konrad: "Rolandslied"
- Heinrich von Veldeke
- Die Höhepunkte: Hartmann von Aue (etwa 1165-1220), Wolfram von Eschenbach (etwa 1170-1220) und Gottfried von Straßburg
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der höfischen Literatur im Hochmittelalter, insbesondere den Einfluss französischer Literatur und die Entstehung einer spezifisch deutschen höfischen Dichtung. Der Fokus liegt auf der Entstehung und Ausprägung dieser Literaturform im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen der Zeit.
- Der Einfluss französischer Literatur auf die deutsche höfische Literatur
- Die Rolle der Fürstenhöfe als Zentren literarischen Schaffens
- Die Entwicklung des höfischen Epos
- Die Beziehung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der höfischen Literatur
- Die wichtigsten Autoren und Werke der höfischen Literatur im Hochmittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einführung definiert das Hochmittelalter (ca. 1170 bis Ende des 13. Jahrhunderts) als die Epoche, in der Fürstenhöfe die Literatur prägten, im Gegensatz zum früheren Mittelalter mit klösterlicher und kirchlicher Literaturproduktion. Die Machtentfaltung des staufischen Kaisertums unter Friedrich Barbarossa beendete die Vorherrschaft der Geistlichen, und das Rittertum drängte mit eigenen Ausdrucksformen in die Dichtung. Fürstenhöfe wurden zu Zentren des dichterischen Schaffens. Die Rezeption französischer Literaturformen um 1170 führte innerhalb einer Generation zur Entstehung einer spezifisch höfischen Literatur, wobei Klöster und Kirchen weiterhin literarisch aktiv blieben. Die Kreuzzüge beeinflussten das Selbstverständnis des Rittertums und führten zu einem gemeineuropäisch-christlichen Kulturgefühl. Das höfische Epos verklärte die ritterliche Welt und ihr Menschenbild, markierend die erste Blütezeit der deutschen Literatur.
2. Die Anfänge der höfischen Literatur. Die Orientierung nach Frankreich: Dieses Kapitel behandelt die enge Verknüpfung der Ausbildung der höfischen Literatur mit der Rezeption französischer Dichtungsformen. Der deutsche Adel übernahm nicht nur militärische Ausrüstung und Zeremoniell aus Frankreich, sondern auch modische Aspekte der Kleidung und des Hofprotokolls. Das literarische Interesse konzentrierte sich vor allem auf die Liebeslyrik der Trobadors und Trouvéres und die höfischen Romane. Andere Genres der französischen Literatur fanden weniger Beachtung. Der Einfluss verbreitete sich von Westen nach Osten, wobei der Rhein eine wichtige Rolle spielte. Viele Begriffe der ritterlichen Welt wurden dem Französischen entlehnt. Der konkrete Prozess der literarischen Vermittlung bleibt zwar unklar, doch deutet vieles auf eine gute Informiertheit der deutschen Höfe über die aktuellen literarischen Entwicklungen in Frankreich hin.
Schlüsselwörter
Höfische Literatur, Hochmittelalter, Frankreich, Epos, Roman, Rittertum, Fürstenhöfe, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Rezeption, staufische Klassik, Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Straßburg.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur höfischen Literatur des Hochmittelalters
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der höfischen Literatur im Hochmittelalter (ca. 1170 bis Ende des 13. Jahrhunderts), insbesondere den Einfluss französischer Literatur und die Entstehung einer spezifisch deutschen höfischen Dichtung. Der Fokus liegt auf der Entstehung und Ausprägung dieser Literaturform im Kontext der gesellschaftlichen und politischen Veränderungen der Zeit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem den Einfluss französischer Literatur, die Rolle der Fürstenhöfe als Zentren literarischen Schaffens, die Entwicklung des höfischen Epos, die Beziehung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, sowie die wichtigsten Autoren und Werke der höfischen Literatur im Hochmittelalter. Konkret werden die Anfänge der höfischen Literatur, die Orientierung nach Frankreich, der Begriff des Höfischen, die Rolle von Mündlichkeit und Schriftlichkeit und die Höhepunkte mit Autoren wie Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach und Gottfried von Straßburg untersucht.
Welche Autoren und Werke werden im Detail besprochen?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Epen nach französischen Quellen, darunter Lamprechts "Alexander", den "Straßburger Alexander", Konrads "Rolandslied" und Werke von Heinrich von Veldeke. Besondere Aufmerksamkeit wird den Hauptvertretern der höfischen Literatur, Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach und Gottfried von Straßburg, gewidmet.
Wie wird der Einfluss Frankreichs dargestellt?
Die Arbeit betont die enge Verknüpfung der deutschen höfischen Literatur mit der Rezeption französischer Dichtungsformen. Der deutsche Adel übernahm nicht nur militärische Aspekte, sondern auch modische und literarische Einflüsse, insbesondere Liebeslyrik der Trobadors und Trouvéres und höfische Romane. Der Einfluss verbreitete sich von Westen nach Osten, wobei der Rhein eine wichtige Rolle spielte. Der genaue Prozess der literarischen Vermittlung bleibt zwar unklar, doch deutet vieles auf eine gute Informiertheit der deutschen Höfe über die aktuellen literarischen Entwicklungen in Frankreich hin.
Welche Rolle spielen Fürstenhöfe und die gesellschaftlichen Veränderungen?
Die Arbeit unterstreicht die Bedeutung der Fürstenhöfe als Zentren des dichterischen Schaffens im Hochmittelalter. Die Machtentfaltung des staufischen Kaisertums und der Aufstieg des Rittertums führten zu einer Verschiebung der literarischen Produktion von klösterlicher und kirchlicher hin zu höfischer Literatur. Die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen der Zeit spiegeln sich in der Entwicklung der höfischen Literatur wider.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Höfische Literatur, Hochmittelalter, Frankreich, Epos, Roman, Rittertum, Fürstenhöfe, Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Rezeption, staufische Klassik, Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Straßburg.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einführung, die das Hochmittelalter und den Kontext der Entstehung höfischer Literatur definiert. Es folgen Kapitel zu den Anfängen der höfischen Literatur und dem Einfluss Frankreichs, sowie zur Analyse spezifischer Autoren und Werke. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung.
- Citar trabajo
- Venera Reiser (Autor), 2004, Epos und Roman im Hochmittelalter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42756