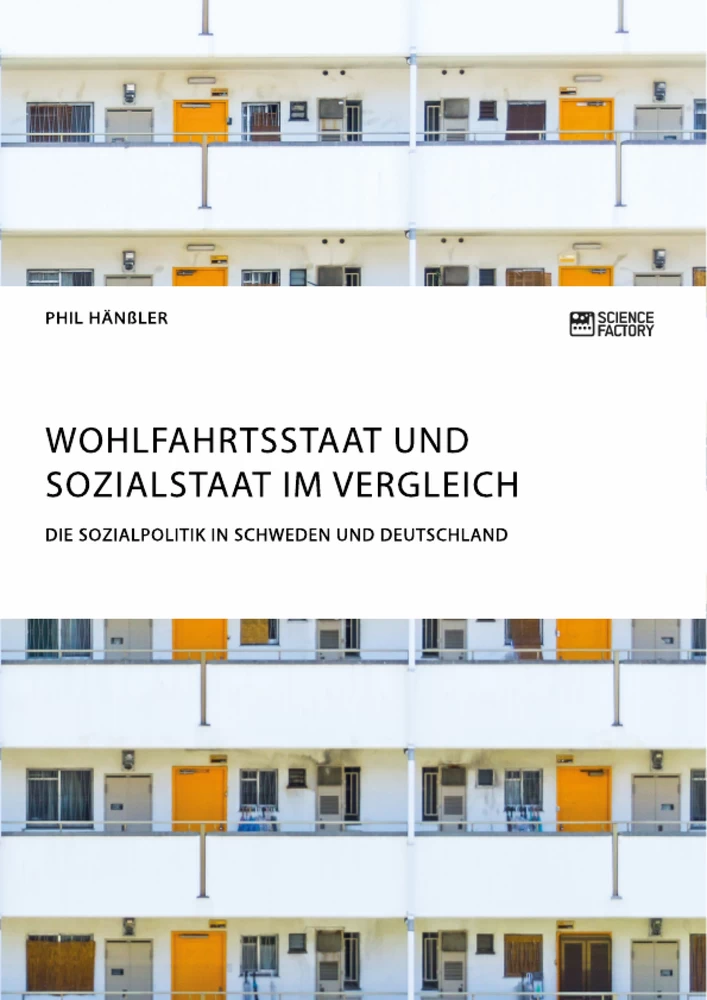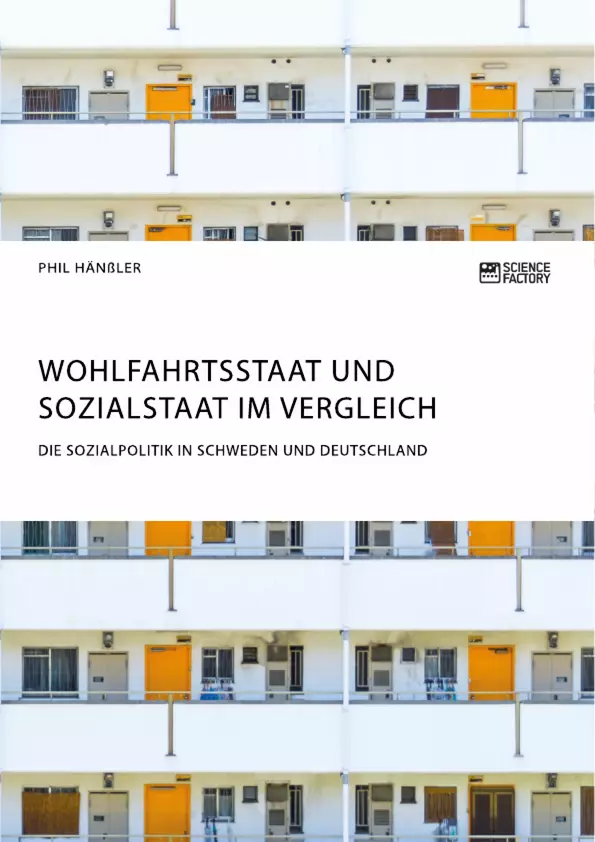Ziel der Sozialpolitik ist es, die wirtschaftliche und soziale Situation benachteiligter Gruppen zu stärken und sie besser in die Gesellschaft zu integrieren. Wie unterscheiden sich hierbei ein skandinavischer Wohlfahrtsstaat und ein kontinentaleuropäischer Sozialstaat?
Phil Hänßler vergleicht in dieser Publikation Schweden und Deutschland hinsichtlich ihrer jeweiligen sozialpolitischen Tätigkeiten. Dazu beleuchtet er das soziale Sicherungssystem, die soziale Gerechtigkeit sowie die gesellschaftlichen Konfliktlinien beider Länder.
Hänßler stellt die wichtigsten Felder der sozialen Sicherung kritisch dar und vergleicht sie miteinander. Dabei beantwortet er die Frage, welcher Grad an sozialer Gerechtigkeit erreicht wird.
Aus dem Inhalt:
- Sozialpolitik;
- Wohlfahrtsstaat;
- Sozialstaat;
- Schweden;
- Deutschland
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Untersuchungsgegenstand und Methode
- 1.2 Wohlfahrtsstaat und Sozialstaat: Begriffsklärung und -setzung
- 2 Wohlfahrtstaatliche Grundmodelle und Wohlfahrtsstaatsregime
- 2.1 Staatsbürgerversorgung, Sozialversicherung und Fürsorge
- 2.2 Versicherungs- und Fürsorgemodell
- 2.3 Drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus: Esping-Andersen drei Wohlfahrtsstaatsregime
- 2.4 Kritik an Esping-Andersens drei Welten des Wohlfahrtsstaatskapitalismus
- 3 Wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Wirkungen der Sozialpolitik
- 3.1 Wirtschaftliche Wirkungen der Sozialpolitik
- 3.2 Gesellschaftliche Wirkungen der Sozialpolitik
- 3.3 Politische Wirkungen von Sozialpolitik
- 4 Übersicht: Schweden und die Bundesrepublik Deutschland
- 5 Gesellschaftliche Konflikte in Schweden und der Bundesrepublik Deutschland
- 5.1 Stadt/Land-Konflikt in Schweden
- 5.2 Staat/Kirche-Konflikt in Deutschland
- 6 Historische Entwicklung der schwedischen und deutschen Sozialpolitik
- 6.1 Sozialpolitische Entwicklung Schwedens im Jahrhundert
- 6.2 Sozialpolitische Entwicklung Deutschlands von 1871 bis 2009
- 6.3 Parteien und deren Bedeutung in der sozialpolitischen Geschichte von Schweden und der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
- 7 Soziales Sicherungssystem in Schweden und der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel des Rentensystems und der Arbeitslosenversicherung
- 7.1 Einführung in das soziale Sicherungssystem in Schweden
- 7.2 Einführung in das soziale Sicherungssystem der Bundesrepublik Deutschland
- 7.3 Der Vergleich des schwedischen Wohlfahrtsstaates und des deutschen Sozialstaates
- 8 Das Bildungssystem in Schweden und der Bundesrepublik Deutschland
- 8.1 Das Bildungssystem in Schweden
- 8.2 Das Bildungssystem in der Bundesrepublik Deutschland
- 8.3 Die Bildungssysteme von Schweden und der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich
- 9 Statistische Einordnung Schwedens und der Bundesrepublik Deutschland
- 9.1 Privatisierungsgrad
- 9.2 Dekommodifizierungsgrad
- 9.3 Stratifizierung und soziale Gerechtigkeit
- 9.4 Exklusivität und Inklusivität
- 10 Kritik am schwedischen Wohlfahrtsstaat und dem deutschen Sozialstaat
- 10.1 Effizienz
- 10.2 Finanzierungsstabilität
- 10.3 Pfadabhängigkeit
- 11 Fazit und Perspektive
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht vergleichend die Sozialpolitik in Schweden und Deutschland, wobei der Fokus auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen Wohlfahrts- und Sozialstaat liegt. Ziel ist es, die jeweiligen Modelle zu analysieren und ihre wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen zu beleuchten.
- Vergleich der Wohlfahrtsstaatsmodelle in Schweden und Deutschland
- Analyse der historischen Entwicklung der Sozialpolitik in beiden Ländern
- Untersuchung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Sozialpolitik
- Bewertung der jeweiligen Systeme im Hinblick auf Effizienz und Finanzierbarkeit
- Betrachtung der Rolle von gesellschaftlichen Konflikten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses einführende Kapitel legt den Untersuchungsgegenstand und die Methodik der Arbeit dar. Es werden die Begriffe "Wohlfahrtsstaat" und "Sozialstaat" geklärt und abgegrenzt, um den Rahmen für den anschließenden Vergleich der schwedischen und deutschen Sozialsysteme zu schaffen. Der Fokus liegt auf der Klärung der zentralen Begriffe und der Definition der Forschungsfrage.
2 Wohlfahrtstaatliche Grundmodelle und Wohlfahrtsstaatsregime: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Wohlfahrtsstaatsmodelle und Regime, insbesondere das dreiteilige Modell von Esping-Andersen. Es analysiert die verschiedenen Ansätze der Staatsbürgerversorgung (Sozialversicherung und Fürsorge) und deren Implikationen für die Gestaltung der Sozialpolitik. Kritische Auseinandersetzung mit Esping-Andersens Modell und seinen Grenzen wird ebenfalls behandelt. Das Kapitel dient als theoretische Grundlage für den Ländervergleich.
3 Wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Wirkungen der Sozialpolitik: Hier werden die Auswirkungen der Sozialpolitik auf die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Politik in einem allgemeinen Rahmen beleuchtet. Es werden verschiedene ökonomische, soziale und politische Effekte der Sozialpolitik diskutiert, um den Kontext für die spätere Länderanalyse zu bilden. Die Zusammenhänge zwischen Sozialpolitik und gesellschaftlicher Entwicklung werden erörtert.
4 Übersicht: Schweden und die Bundesrepublik Deutschland: Dieses Kapitel bietet einen ersten Überblick über die sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten in Schweden und Deutschland, um die Grundlage für einen detaillierten Vergleich zu schaffen. Es liefert eine kurze Einführung in die jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Systeme beider Länder und bildet so den Übergang zu den folgenden, detaillierteren Kapiteln.
5 Gesellschaftliche Konflikte in Schweden und der Bundesrepublik Deutschland: In diesem Kapitel werden relevante gesellschaftliche Konflikte in Schweden und Deutschland vorgestellt, insbesondere der Stadt-Land-Konflikt in Schweden und der Staat-Kirche-Konflikt in Deutschland. Die Bedeutung dieser Konflikte für die Gestaltung und Umsetzung der Sozialpolitik wird analysiert. Die Analyse zeigt, wie gesellschaftliche Spannungen die Sozialpolitik beeinflussen.
6 Historische Entwicklung der schwedischen und deutschen Sozialpolitik: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Sozialpolitik in Schweden und Deutschland. Es werden die wichtigen Meilensteine und Einflussfaktoren in beiden Ländern betrachtet, um die aktuellen Sozialsysteme besser zu verstehen. Die Rolle der jeweiligen Parteien und deren Einfluss auf die Sozialpolitik werden ebenfalls untersucht.
7 Soziales Sicherungssystem in Schweden und der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel des Rentensystems und der Arbeitslosenversicherung: Hier wird ein detaillierter Vergleich der sozialen Sicherungssysteme in Schweden und Deutschland durchgeführt, wobei das Rentensystem und die Arbeitslosenversicherung als Beispiele dienen. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Systeme werden analysiert, um die jeweiligen Stärken und Schwächen zu beleuchten und die unterschiedlichen zugrundeliegenden Modelle zu verdeutlichen. Dieser Vergleich bildet einen zentralen Bestandteil der Arbeit.
8 Das Bildungssystem in Schweden und der Bundesrepublik Deutschland: Dieses Kapitel vergleicht die Bildungssysteme in Schweden und Deutschland und analysiert ihre Strukturen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Die Bedeutung des Bildungssystems für soziale Mobilität und Chancengleichheit wird dabei ebenfalls berücksichtigt. Der Vergleich unterstreicht die unterschiedlichen Ansätze in der Sozialpolitik beider Länder.
9 Statistische Einordnung Schwedens und der Bundesrepublik Deutschland: Dieses Kapitel präsentiert statistische Daten zu verschiedenen Indikatoren wie Privatisierungsgrad, Dekommodifizierungsgrad, Stratifizierung und sozialer Gerechtigkeit, um die Ergebnisse des Ländervergleichs quantitativ zu untermauern und zu veranschaulichen. Die Daten dienen zur empirischen Unterfütterung der vorherigen Analysen.
Schlüsselwörter
Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat, Schweden, Deutschland, Sozialpolitik, Vergleich, Geschichte, Rentensystem, Arbeitslosenversicherung, Bildungssystem, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Esping-Andersen, Dekommodifizierung, Privatisierung, soziale Gerechtigkeit, Konflikte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vergleich der Sozialpolitik in Schweden und Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Sozialpolitik Schwedens und Deutschlands. Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen dem Wohlfahrtsstaat (Schweden) und dem Sozialstaat (Deutschland). Analysiert werden die jeweiligen Modelle, ihre wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen sowie deren historische Entwicklung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der Sozialpolitik beider Länder, darunter die Wohlfahrtsstaatsmodelle, die historische Entwicklung, die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen, die Rolle gesellschaftlicher Konflikte (z.B. Stadt/Land in Schweden, Staat/Kirche in Deutschland), das Rentensystem, die Arbeitslosenversicherung, das Bildungssystem, und die kritische Bewertung der Systeme hinsichtlich Effizienz und Finanzierbarkeit. Es werden statistische Daten zur Untermauerung der Analyse verwendet (Privatisierungsgrad, Dekommodifizierungsgrad, soziale Gerechtigkeit etc.). Das dreiteilige Modell von Esping-Andersen dient als theoretischer Rahmen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, die den Untersuchungsgegenstand und die Methode beschreibt. Es folgen Kapitel zu Wohlfahrtsstaatsmodellen, den Wirkungen von Sozialpolitik, einem Überblick über Schweden und Deutschland, gesellschaftlichen Konflikten, der historischen Entwicklung der Sozialpolitik in beiden Ländern, einem detaillierten Vergleich der sozialen Sicherungssysteme (am Beispiel Rente und Arbeitslosenversicherung), einem Vergleich der Bildungssysteme, einer statistischen Einordnung, einer kritischen Bewertung und abschließend einem Fazit.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat, Schweden, Deutschland, Sozialpolitik, Vergleich, Geschichte, Rentensystem, Arbeitslosenversicherung, Bildungssystem, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Esping-Andersen, Dekommodifizierung, Privatisierung, soziale Gerechtigkeit, Konflikte.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Methode, um die Sozialpolitik Schwedens und Deutschlands zu analysieren. Sie kombiniert theoretische Überlegungen mit empirischen Daten und einer historischen Perspektive. Das Esping-Andersen Modell dient als analytischer Rahmen.
Was sind die zentralen Ergebnisse? (Ohne detaillierte Ergebnisse)
Die Arbeit liefert einen detaillierten Vergleich der Sozialpolitik in Schweden und Deutschland, beleuchtet deren Stärken und Schwächen und untersucht deren Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Die Ergebnisse zeigen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Systeme auf.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Sozialpolitik Schwedens und Deutschlands vergleichend zu untersuchen, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Modelle zu analysieren und deren wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Auswirkungen zu beleuchten. Eine Bewertung der Effizienz und Finanzierbarkeit der Systeme ist ebenfalls ein Ziel.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die Inhalte und den Fokus jedes Abschnitts beschreibt.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Personen gedacht, die sich für einen Vergleich der Sozialpolitik in Schweden und Deutschland interessieren, insbesondere für Studierende und Wissenschaftler im Bereich der Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften.
- Arbeit zitieren
- Phil Hänßler (Autor:in), 2018, Wohlfahrtsstaat und Sozialstaat im Vergleich. Die Sozialpolitik in Schweden und Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/427419