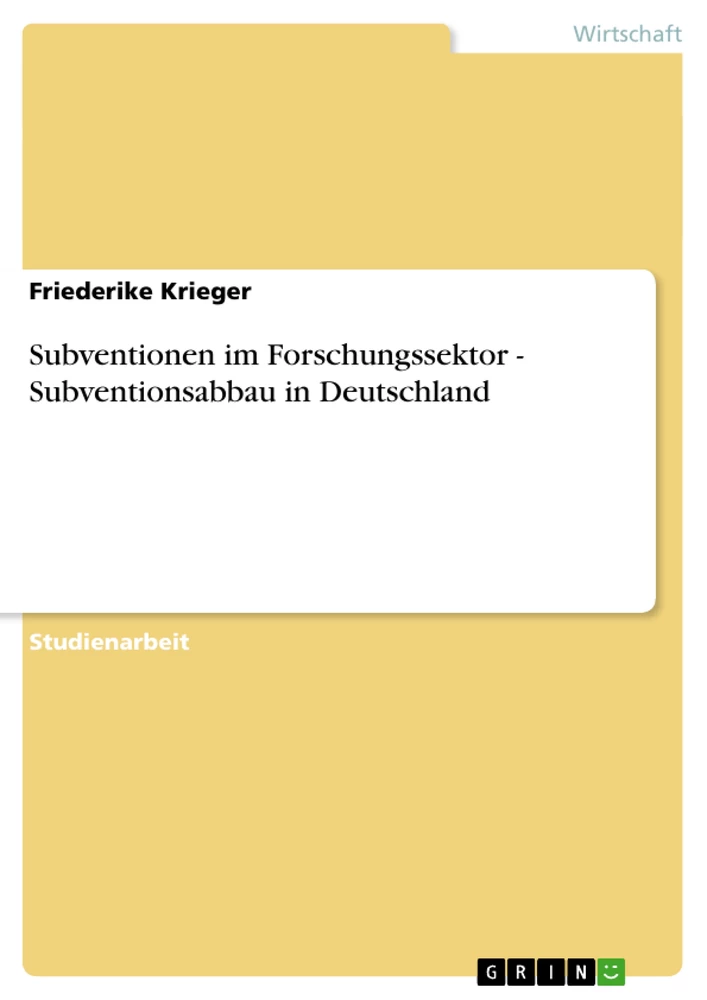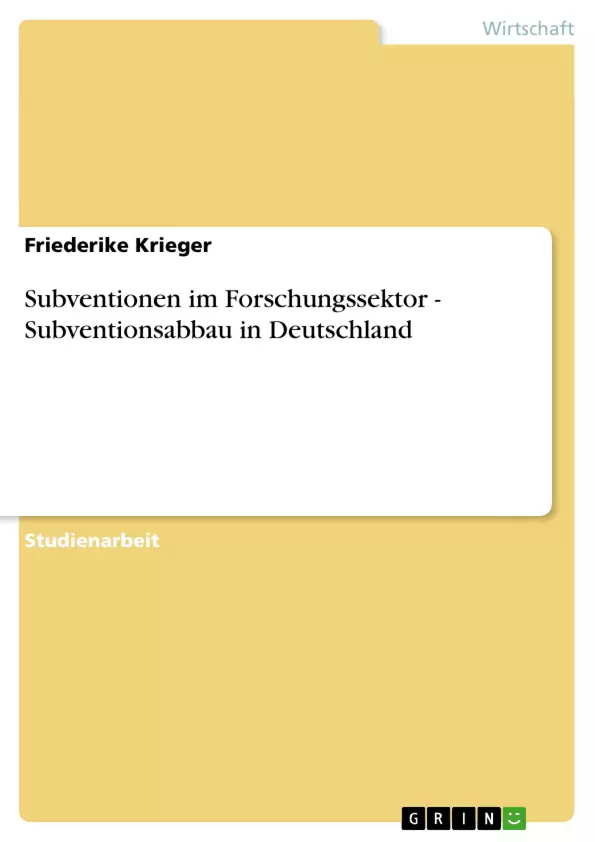Die Subventionierung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E) wird meist mit der Existenz so genannter positiver externer Effekte begründet. Der Wirtschaftswissenschaftler Adam B. Jaffee definiert sie als „excess of the social rate of return over the private rate of return enjoyed by the innovating firm“ (Jaffee 1996, S. 2). Bei der Entscheidung, ob bzw. in welcher Intensität ein Unternehmen F&E betreibt, wiegt es die Kosten, die F&E mit sich bringen, gegen die zukünftigen Profite ab, welche die Innovation für die Firma erschließen könnte. Ignoriert wird in dieser Kosten/Nutzen-Kalkulation allerdings, dass die Innovation auch Vorteile für die Gesellschaft als Ganzes mit sich bringt, die zusammen mit dem privaten Nutzen der Firma den sozialen Nutzen von F&E ausmachen. Wird das forschende Unternehmen nicht für die „gemeinnützige“ Wirkung seiner F&E- Aktivitäten kompensiert, kommen manche sozial wünschenswerten Projekte nicht zustande. In die F&E-Vorhaben, welche die Firmen realisieren, investieren sie zu wenig.
Viele Wirtschaftswissenschaftler haben schon versucht, das Ausmaß dieser positiven externen Effekte zu messen, also mit der Forschung anzusetzen, wenn die Innovation schon auf dem Markt ist. Jean-Francois Tremblay, der Autor des Workingspapers „Taxation and Technology Adoption in the Presence of Strategic Investment“, das hier analysiert werden soll, geht indes einen Schritt zurück. Ihn interessiert vielmehr der Prozess mit dem neue Produktionstechnologien in den Markt eingeführt werden.
Strategisches Verhalten der Firmen kann zu einem sozial ineffizienten Investitionsvolumen in die neue Technologie führen. Zudem besteht die Gefahr, dass sie nicht zum sozial optimalen Zeitpunkt zum Einsatz kommt. Tremblay ist in seinem Paper deshalb der Frage nachgegangen, wie man Unternehmen besteuern/subventionieren müsste, damit die Investitions- und Markteintrittsentscheidungen wieder sozial optimal getroffen werden. Seine Ergebnisse sind sehr überraschend. Sein Modell zeigt nämlich, dass eine Besteuerung der Unternehmensgewinne die Einführung neuer Technologien in den Markt beschleunigt und deshalb wohlfahrtsfördernd sein könnte. Damit stellt er das gesamte bisherige System der Forschungsförderung durch Subvention in Frage.
Ziel dieses Aufsatzes ist daher, verbal wie mathematisch nachzuvollziehen, wie Tremblay zu derart ungewöhnlichen Ergebnissen kommen konnte. Auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Paper scheint angebracht.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung: Subventionen im Forschungssektor
- Das Modell
- Die privaten Optima der Unternehmen
- Grundlagen
- Der Markteintritts- und Marktaustrittszeitpunkt
- Die Investitionen
- Der F&E-Wettbewerb
- Die sozialen Optima der Volkswirtschaft
- Vergleich der privaten und sozialen Optima
- Das optimale Steuer/Subventionssystem
- Fazit: Modellkritik
- Anhang
- Die Produktion des Monopolisten
- Das Investitions-Problem: Gleichung (4) zu Gleichung (5)
- Die Höhe der Abschreibungsrate
- Zeitpunkt Beginn F&E-Wettbewerb: Gleichung (6) zu Gleichung (7)
- Zeitpunkt Beginn F&E-Wettbewerb: Variationen
- Die sozialen Optima: Gleichung (8) zu Gleichungen (9) und (10)
- Die sozial optimale Abschreibungsrate: Gleichung (8) zu Gleichung (9)
- Der sozial optimale Markteintritt: Gleichung (8) zu Gleichung (10)
- Optimale Produktionssubvention: Gleichung (1) zu Gleichung (11)
- Optimale Gewinnbesteuerung: Gleichungen (3) und (10) zu Gleichung (12)
- Optimale Investitionsbesteuerung: Gleichungen (5) und (9) zu Gleichung (13)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Subventionen auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E) im Forschungssektor. Im Mittelpunkt steht die Analyse des optimalen Subventionssystems zur Förderung von Innovationen unter Berücksichtigung sowohl privater als auch sozialer Optima.
- Marktversagen aufgrund positiver externer Effekte von F&E
- Optimierung des F&E-Prozesses durch staatliche Intervention
- Modellierung der privaten und sozialen Optima im F&E-Kontext
- Analyse des optimalen Steuer/Subventionssystems
- Kritik des entwickelten Modells
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Subventionen im Forschungssektor: Dieser Abschnitt definiert den Begriff der externen Effekte und erläutert die Notwendigkeit staatlicher Intervention im Forschungssektor zur Internalisierung dieser Effekte.
- Das Modell: Dieses Kapitel stellt ein Modell vor, welches die privaten Optima der Unternehmen und die sozialen Optima der Volkswirtschaft im Kontext von F&E-Aktivitäten gegenüberstellt.
- Die privaten Optima der Unternehmen: Dieser Abschnitt beschreibt die Entscheidungen von Unternehmen hinsichtlich Markteintritt, Marktaustritt und Investitionen in F&E unter Berücksichtigung ihrer privaten Nutzenmaximierung.
- Die sozialen Optima der Volkswirtschaft: Hier werden die sozial optimalen Entscheidungen für den F&E-Prozess betrachtet, die den gesamten gesellschaftlichen Nutzen maximieren.
- Vergleich der privaten und sozialen Optima: Dieser Abschnitt analysiert die Diskrepanz zwischen privaten und sozialen Optima im F&E-Bereich und zeigt die Notwendigkeit staatlicher Eingriffe auf.
- Das optimale Steuer/Subventionssystem: Das Kapitel untersucht die Gestaltung eines optimalen Steuer/Subventionssystems, welches die Unternehmen dazu anregt, die sozial optimale Menge an F&E zu betreiben.
- Fazit: Modellkritik: Dieser Abschnitt fasst die Ergebnisse des Modells zusammen und diskutiert kritisch die Annahmen und Limitationen des Modells.
Schlüsselwörter
Forschung und Entwicklung (F&E), Subventionen, positive externe Effekte, Marktversagen, soziales Optimum, private Optima, Steuer/Subventionssystem, Modellkritik.
Häufig gestellte Fragen
Warum werden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E) staatlich subventioniert?
Subventionen werden durch positive externe Effekte begründet, da der gesellschaftliche Nutzen von Innovationen oft höher ist als der private Gewinn der forschenden Unternehmen.
Was definiert Adam B. Jaffee als positive externe Effekte?
Jaffee beschreibt sie als den Überschuss der sozialen Ertragsrate über die private Ertragsrate, die das innovierende Unternehmen erzielt.
Welche zentrale Frage untersucht Jean-Francois Tremblay in seinem Modell?
Tremblay untersucht, wie Unternehmen besteuert oder subventioniert werden müssten, damit Investitions- und Markteintrittsentscheidungen sozial optimal getroffen werden.
Warum könnte eine Gewinnbesteuerung laut dem Modell wohlfahrtsfördernd sein?
Überraschenderweise zeigt das Modell, dass eine Besteuerung die Einführung neuer Technologien beschleunigen kann, was dem herkömmlichen System der Forschungsförderung widerspricht.
Was ist die Diskrepanz zwischen privaten und sozialen Optima bei F&E?
Unternehmen investieren oft zu wenig oder zum falschen Zeitpunkt in F&E, weil sie nur ihren eigenen Profit und nicht den Nutzen für die gesamte Gesellschaft kalkulieren.
Welche Rolle spielt das strategische Verhalten von Firmen?
Strategisches Verhalten im Wettbewerb kann zu ineffizienten Investitionsvolumina führen und den Markteintritt neuer Technologien verzögern.
- Arbeit zitieren
- Diplom-Volkswirtin Friederike Krieger (Autor:in), 2005, Subventionen im Forschungssektor - Subventionsabbau in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42648