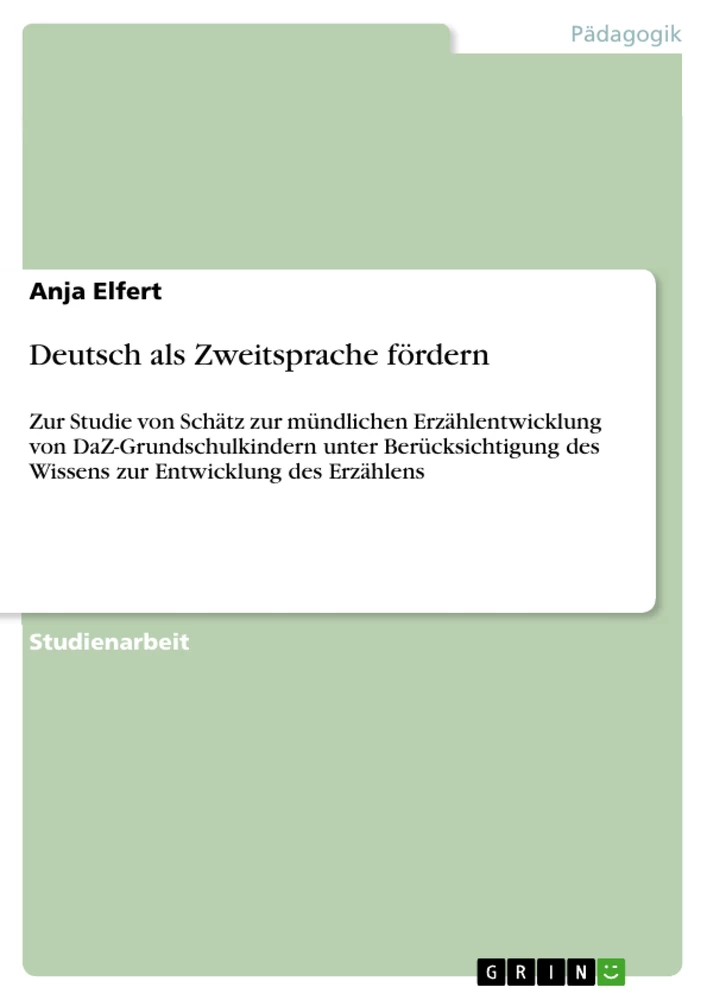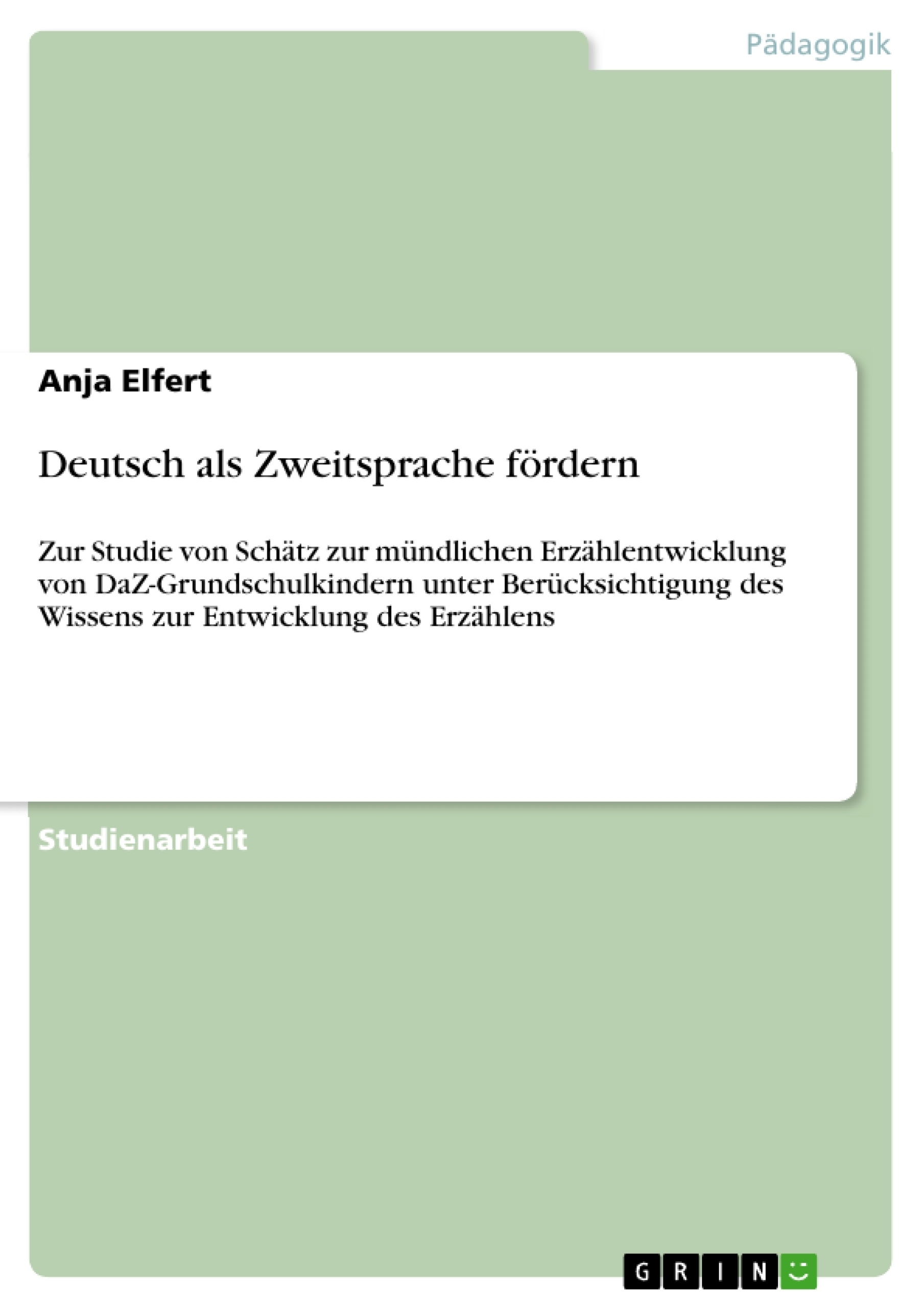In den letzten Jahren erlebte Deutschland einen wahren „Flüchtlings-Boom“. In den Jahren von 2015 bis 2017 wurden in Deutschland 1.362.586 Erstanträge auf Asyl eingereicht. Zum Vergleich: In den Jahren von 2012 bis 2014 waren es lediglich 347.191 Erstanträge, also rund 75% weniger. Diese Zahlen wirken sich natürlich auch auf das deutsche Bildungssystem aus, denn so strömen immer mehr Kinder, die Deutsch als Zweitsprache neu erlernen müssen, in die Schulen.
Aus der Aktualität dieses Themas heraus ist es naheliegend, die Förderung dieser Kinder noch einmal genauer in den Blick zu nehmen. Deswegen beschäftigt sich diese Arbeit mit der Studie von Raphaela Schätz zur mündlichen Erzählentwicklung von DaZ-Grundschulkindern. Bisheriges Wissen zur Entwicklung von Erzählen soll mit in die Betrachtungen einbezogen werden.
Da sich diese Arbeit mit einer speziellen Studie befasst, wird diese auch als Hauptliteratur dienen. Des Weiteren wird die von Schätz verwendete Literatur genauer betrachtet werden, um ein eigenes Bild vom Forschungsstand zum Zeitpunkt von Schätz‘ Studie zu erlangen.
Das Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung der Studie, um die bisherigen Förderungsansätze und deren Wirksamkeit zu überprüfen. Dazu soll folgende Frage beantwortet werden: Wie lassen sich durch die Ergebnisse von Schätz‘ Studie die Fördermöglichkeiten für DaZ-Grundschulkinder zusammenfassen und bewerten? Dazu sollen zunächst die wichtigsten Begriffe, wie beispielsweise Muttersprache und Zweitsprache, erklärt werden, denn diese sind Grundlage für das Verständnis der nachfolgenden Ausführungen. Ebenfalls wichtige Grundlagen sind die bisherigen Erkenntnisse zu den Komponenten, zum Erwerbsverlauf und zur Förderung der mündlichen Erzählfähigkeit. Deshalb werden diese im Anschluss an die Begriffsbestimmungen ausführlich erläutert. Bezüglich der Förderung mündlicher Erzählfähigkeit soll dann ein kurzer Einblick in das von Schätz‘ betrachtete Sprachförderprogramm MITsprache gegeben werden, damit danach Schätz‘ Fragestellung sowie die Ergebnisse der Studie erläutert werden können.
Aufgrund des Umfanges dieser Arbeit erfolgt die Fokussierung auf die sprachlichen Komponenten der mündlichen Erzählfähigkeit, personale oder situative Faktoren werden bewusst ausgeklammert, da diese in Schätz‘ Studie eine eher untergeordnete Rolle spielen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegende Begriffsbestimmungen
- Komponenten mündlicher Erzählfähigkeit
- Basale sprachliche Fähigkeiten
- Spezifische pragmatische Fähigkeiten
- Erwerbsverlauf der sprachlichen Komponente mündlicher Erzählfähigkeit zweisprachiger Kinder
- Erwerb der basalen sprachlichen Fähigkeiten
- Erwerb der spezifischen pragmatischen Fähigkeiten
- Förderung der mündlichen Erzählfähigkeit in Deutsch als Zweitsprache
- Förderung der basalen sprachlichen Fähigkeiten
- Förderung der spezifischen pragmatischen Fähigkeiten
- MITsprache als Sprachförderprogramm
- Empirische Studie nach Schätz
- Fragestellungen
- Ergebnisse
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Studie von Raphaela Schätz zur mündlichen Erzählentwicklung von DaZ-Grundschulkindern. Die Studie soll analysiert und die bisherigen Förderungsansätze sowie deren Wirksamkeit überprüft werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die Ergebnisse der Studie zur Verbesserung der Fördermöglichkeiten für DaZ-Grundschulkinder nutzen lassen. Die Arbeit untersucht dabei die wichtigsten Begriffe, die Komponenten, den Erwerbsverlauf und die Förderung der mündlichen Erzählfähigkeit sowie das Sprachförderprogramm MITsprache.
- Entwicklung der mündlichen Erzählfähigkeit bei DaZ-Grundschulkindern
- Förderung der mündlichen Erzählfähigkeit im DaZ-Kontext
- Bedeutung der basalen sprachlichen Fähigkeiten für das Erzählen
- Analyse der Studie von Schätz zur mündlichen Erzählentwicklung von DaZ-Kindern
- Evaluierung der Wirksamkeit verschiedener Förderansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die aktuelle Situation von DaZ-Kindern in Deutschland beleuchtet und die Relevanz der Studie von Schätz hervorhebt. Anschließend werden grundlegende Begriffsbestimmungen wie Muttersprache, Fremdsprache und Zweitsprache definiert. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Komponenten der mündlichen Erzählfähigkeit, wobei die basalen sprachlichen Fähigkeiten (Phonetik/Phonologie, Semantik/Lexikon, Morphologie/Syntax) und die spezifischen pragmatischen Fähigkeiten (z. B. Relevanz, Kohärenz) erläutert werden. Das vierte Kapitel beschreibt den Erwerbsverlauf der sprachlichen Komponente der mündlichen Erzählfähigkeit bei zweisprachigen Kindern. Hier werden sowohl die basalen sprachlichen Fähigkeiten als auch die spezifischen pragmatischen Fähigkeiten im Detail betrachtet. Im fünften Kapitel werden verschiedene Förderansätze für die mündliche Erzählfähigkeit in Deutsch als Zweitsprache vorgestellt. Das sechste Kapitel gibt einen kurzen Einblick in das Sprachförderprogramm MITsprache, das in Schätz' Studie eine Rolle spielt. Im siebten Kapitel werden die Fragestellungen und Ergebnisse der Studie von Schätz präsentiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die mündliche Erzählentwicklung von DaZ-Grundschulkindern und beleuchtet wichtige Aspekte wie Muttersprache, Zweitsprache, basale sprachliche Fähigkeiten, spezifische pragmatische Fähigkeiten, Förderansätze, Sprachförderprogramme und die Analyse von empirischen Forschungsdaten. Die Studie von Schätz steht im Zentrum der Arbeit und dient als Grundlage zur Evaluierung der Wirksamkeit verschiedener Förderansätze.
- Quote paper
- Anja Elfert (Author), 2018, Deutsch als Zweitsprache fördern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/425590