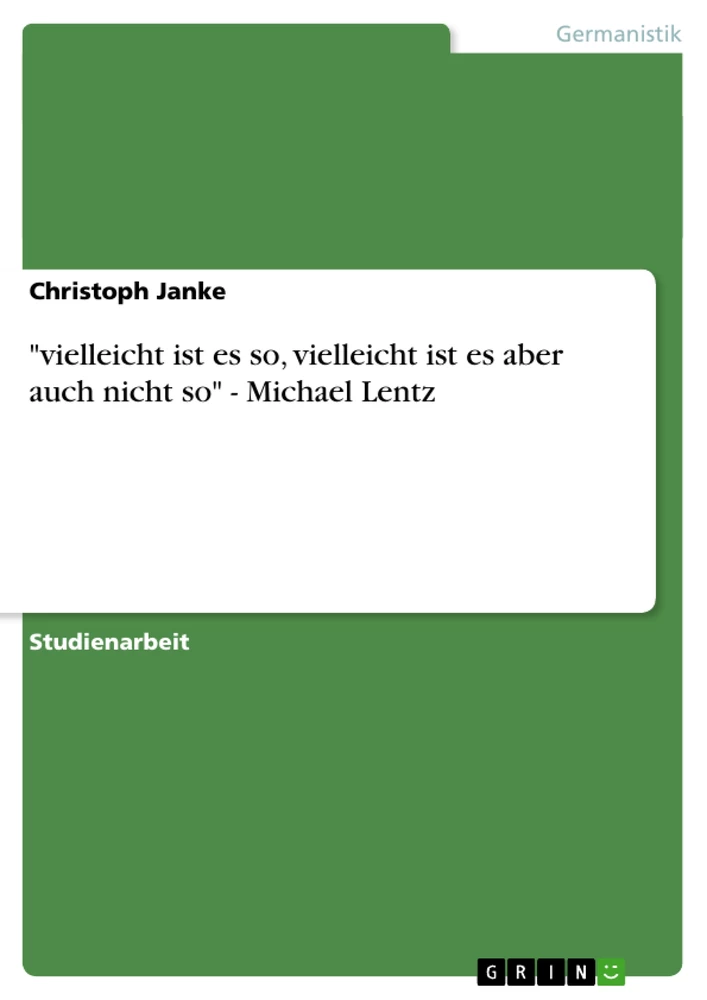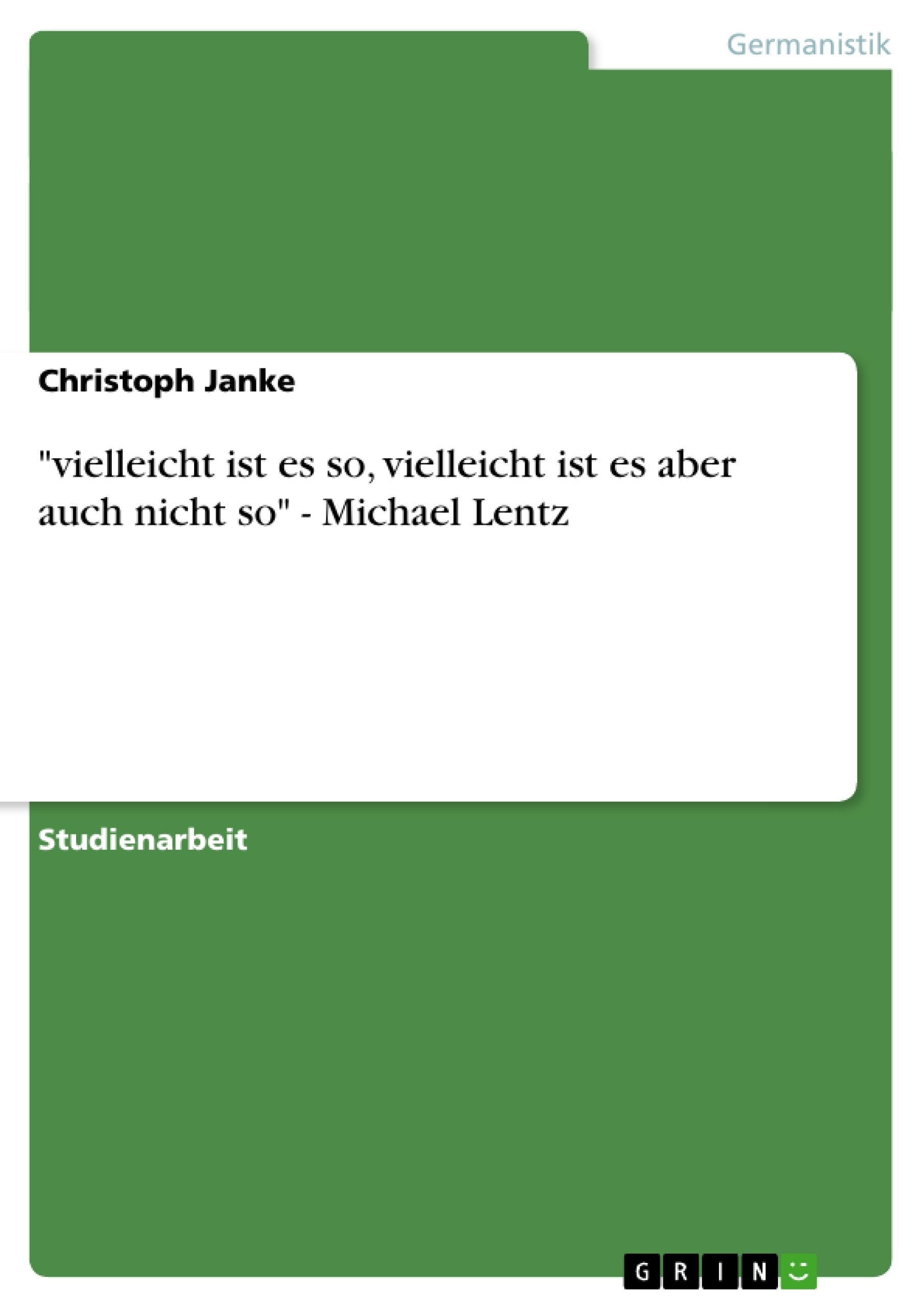Einleitung
„Der längste Beitrag, welcher der Lyrik jemals im deutschen Fernsehen gewidmet wurde. Daraus entwickelt sich nun eine gute Tradition.“1 Auf die in mehr als sechs Stunden „Lange Nacht der Lyrik“ am 5. und 12. April 2000 im ZDF-Nachtstudio ausgestrahlten „ExplosivLaute“2 folgt im Jahr darauf am zweiten UNESCO-Welttag der Poesie 2001 eine dreistündige lautpoetische Ausgabe mit dem Titel „Die Stimme kommt zum Text“3. In der Ankündigung zu jener zweiten „Langen Nacht der Poesie“ lobt das Nachtstudio voreilig „eine gute Tradition“ aus. Die Sendungen um den dritten UNESCO-Welttag der Poesie im Jahr darauf behandeln „Erkenntnisse der Hirnforschung“4.
Dennoch sind jedwede Gesänge um die schwierige Situation der Lyrik übellaunig und schief, zumal sie deren Bedeutsamkeit einzig mittels der Auflagenzahlen im gebundenen Medium bestimmen, und die gehen bekanntlich gegen Null. Die rasche Verbreitung im Internet indes wird zumeist ignoriert, obwohl hier eine weitaus größere Leserschaft erreicht wird, die verschiedenste Foren bildet, in denen sie rege diskutiert und bespricht5. Vor allem aber werden Gedichte wieder gesprochen, zitiert und vorgetragen. Stichpunkte hier sind die Slam-Poetrie und das Hörbuch. Auf jedem größeren Literaturfestival sind Lyriklesungen ein fester Bestandteil. Es scheint fast, als tauchen Gedichte bevorzugt dort auf, wo sie benutzt werden, ihre Anpassungsfähigkeit wird nach wie vor despektierlich unterschätzt. Eine Bewegung, die unmöglich ohne das Sprechen ihrer Texte auskäme, ist die Lautpoesie. Neben einer Übersicht zur Lautpoesie (3.) und näheren Ausführungen zum ZDF-Nachtstudio (4.), möchte ich unter 5. zunächst auf einen Autor der ersten lautpoetischen Generation, auf Oskar Pastior zu sprechen kommen, sowie anschließend speziell auf dessen Auftritt im Nachtstudio. Im 6. Abschnitt sollen zwei Texte des jüngeren Lyrikers und Lautpoeten Michael Lentz betrachtet werden, anhand deren Analyse und Interpretation ich versuche, in dessen Poetik einzuführen, seinen Vortrag, seine Performance...
--------
1 Http://www.lyrikline.de/(qe5h2bzkbjhwt5jozaikbvi0)/Show.aspx?action=news&entry=81, 15.08.2004.
2 Titel der Veranstaltung.
3 Aufzeichnung am 17.03.2001 im ZDF-Hauptstadtstudio, Foyer „Zollernhof“.
4 Haben wir einen freien Willen? Erkenntnisse der Hirnforschung., ZDF Nachtstudio, 17.03.2002, 0.05 Uhr, ZDF / Wiederholung am 22.03.2002, 11.45 Uhr, 3 SAT.
5 Siehe Anhang, Gesprächstranskript, Thomas Wohlfahrt, S. 6.
Inhaltsverzeichnis
- Gliederung
- Einleitung
- Der Sendeablaufplan des ZDF-Nachtstudios am 17.03.2001 in Berlin
- Das ZDF-Nachtstudio am 17.03.2001
- Oskar Pastior
- Michael Lentz
- Bibliographie
- Anhang
- Gesprächstranskript
- 5 Gedichte
- Webadressen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Präsentation von Lautpoesie im ZDF-Nachtstudio am 17. März 2001. Sie untersucht die Performance von Oskar Pastior und Michael Lentz, um die Besonderheiten lautpoetischer Ästhetik und deren Rezeption zu beleuchten. Die Arbeit beleuchtet den Kontext der Veranstaltung im Hinblick auf den UNESCO-Welttag der Poesie.
- Analyse der lautpoetischen Performance im ZDF-Nachtstudio
- Vergleichende Betrachtung der Poetik von Oskar Pastior und Michael Lentz
- Rezeption von Lautpoesie im Fernsehmedium
- Der Stellenwert der Lautpoesie in der zeitgenössischen Lyrik
- Der Kontext des UNESCO-Welttages der Poesie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar: die „Lange Nacht der Lyrik“ im ZDF-Nachtstudio und die zunehmende Bedeutung von Lyriklesungen und der Verbreitung von Gedichten im Internet. Sie führt in die Thematik der Lautpoesie ein und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich auf die Analyse der Auftritte von Oskar Pastior und Michael Lentz im ZDF-Nachtstudio konzentriert. Die Einleitung betont die Relevanz der Lautpoesie und die scheinbare Diskrepanz zwischen geringen Auflagenzahlen im Buchhandel und der Verbreitung via Internet und Live-Auftritten.
Der Sendeablaufplan des ZDF-Nachtstudios am 17.03.2001 in Berlin: Dieses Kapitel bietet einen detaillierten Überblick über den Ablaufplan der ZDF-Nachtstudio-Sendung vom 17. März 2001. Es listet die teilnehmenden Lautpoeten auf, sowohl etablierte Vertreter wie Pastior und Rühm als auch jüngere Künstler. Der Ablaufplan zeigt die Struktur der Sendung auf und gibt einen Einblick in die Auswahlkriterien der Redaktionsleitung. Der Fokus liegt auf der Präsentation einer breiten Palette an lautpoetischen Ausdrucksformen und Generationen innerhalb der Bewegung.
Das ZDF-Nachtstudio am 17.03.2001: Dieses Kapitel beschreibt den Kontext der Sendung, den UNESCO-Welttag der Poesie und die thematische Ausrichtung auf Lautpoesie. Es dient als Grundlage für die anschließende detaillierte Analyse der Auftritte von Pastior und Lentz. Die Beschreibung des Veranstaltungsortes und der Atmosphäre schafft ein besseres Verständnis des Gesamteindrucks der Sendung und bietet einen Rahmen für die Interpretation der einzelnen Performances.
Oskar Pastior: Dieses Kapitel analysiert den Auftritt von Oskar Pastior im ZDF-Nachtstudio. Es beschreibt den Vortrag, die verwendeten Texte und die Reaktionen des Publikums. Die Analyse basiert auf hör- und sichtbaren Kriterien und untersucht strukturelle und inhaltliche Merkmale des Vortrags. Die Untersuchung beinhaltet auch biographische Aspekte Pastiors und seine Stellung innerhalb der Lautpoesie-Bewegung. Das Kapitel nutzt das bereitgestellte Transkript zur Unterstützung der Analyse.
Michael Lentz: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Performance von Michael Lentz und analysiert zwei seiner Gedichte: „vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch nicht so“ und „ende gut, frage“. Die Interpretation folgt dem Ablauf der Performance und berücksichtigt die verwendeten Mittel der lautpoetischen Gestaltung. Die Analyse beleuchtet die spezifischen poetischen Elemente und deren Wirkung. Die enge Verknüpfung von Text und Performance bildet den zentralen Analysepunkt dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Lautpoesie, ZDF-Nachtstudio, Oskar Pastior, Michael Lentz, Performance, Lyrik, UNESCO-Welttag der Poesie, Sprechkünste, Textinterpretation, Medienrezeption, Lautkomposition.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Lautpoesie im ZDF-Nachtstudio
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die Präsentation von Lautpoesie im ZDF-Nachtstudio am 17. März 2001, insbesondere die Performances von Oskar Pastior und Michael Lentz. Der Fokus liegt auf der lautpoetischen Ästhetik, deren Rezeption im Fernsehmedium und dem Kontext des UNESCO-Welttages der Poesie.
Welche Aspekte werden in der Analyse untersucht?
Die Arbeit untersucht die lautpoetische Performance im ZDF-Nachtstudio, vergleicht die Poetik von Pastior und Lentz, analysiert die Rezeption von Lautpoesie im Fernsehen, beleuchtet den Stellenwert der Lautpoesie in der zeitgenössischen Lyrik und betrachtet den Kontext des UNESCO-Welttages der Poesie. Die Analyse basiert auf dem Sendeablaufplan, dem Gesprächtstranskript und den vorgetragenen Gedichten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Sendeablaufplan des ZDF-Nachtstudios, ein Kapitel zum ZDF-Nachtstudio selbst, Einzelkapitel zu Oskar Pastior und Michael Lentz, eine Bibliographie und einen Anhang mit Transkript, Gedichten und Webadressen. Jedes Kapitel trägt zur umfassenden Analyse der Lautpoesie-Performance bei.
Wie wird die Performance von Oskar Pastior analysiert?
Die Analyse des Auftritts von Oskar Pastior im ZDF-Nachtstudio basiert auf hör- und sichtbaren Kriterien, untersucht strukturelle und inhaltliche Merkmale seines Vortrags und berücksichtigt biographische Aspekte und seine Stellung innerhalb der Lautpoesie-Bewegung. Das bereitgestellte Transkript wird zur Unterstützung der Analyse herangezogen.
Wie wird die Performance von Michael Lentz analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf zwei Gedichte von Michael Lentz ("vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch nicht so" und "ende gut, frage"). Die Interpretation folgt dem Ablauf der Performance und berücksichtigt die verwendeten Mittel der lautpoetischen Gestaltung. Die enge Verknüpfung von Text und Performance bildet den zentralen Analysepunkt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lautpoesie, ZDF-Nachtstudio, Oskar Pastior, Michael Lentz, Performance, Lyrik, UNESCO-Welttag der Poesie, Sprechkünste, Textinterpretation, Medienrezeption, Lautkomposition.
Welchen Zweck erfüllt die Zusammenfassung der Kapitel?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über den Inhalt und die Argumentationslinie der einzelnen Kapitel, um dem Leser einen schnellen Einstieg in die Thematik und die Struktur der Arbeit zu ermöglichen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Analyse der Präsentation von Lautpoesie im ZDF-Nachtstudio, um die Besonderheiten lautpoetischer Ästhetik und deren Rezeption zu beleuchten. Die Arbeit untersucht die Performances von Oskar Pastior und Michael Lentz im Kontext des UNESCO-Welttages der Poesie.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text ist nicht hier enthalten, sondern die HTML-Datei bietet lediglich eine Zusammenfassung und einen Überblick über die Arbeit.
- Quote paper
- Christoph Janke (Author), 2004, "vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch nicht so" - Michael Lentz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42518