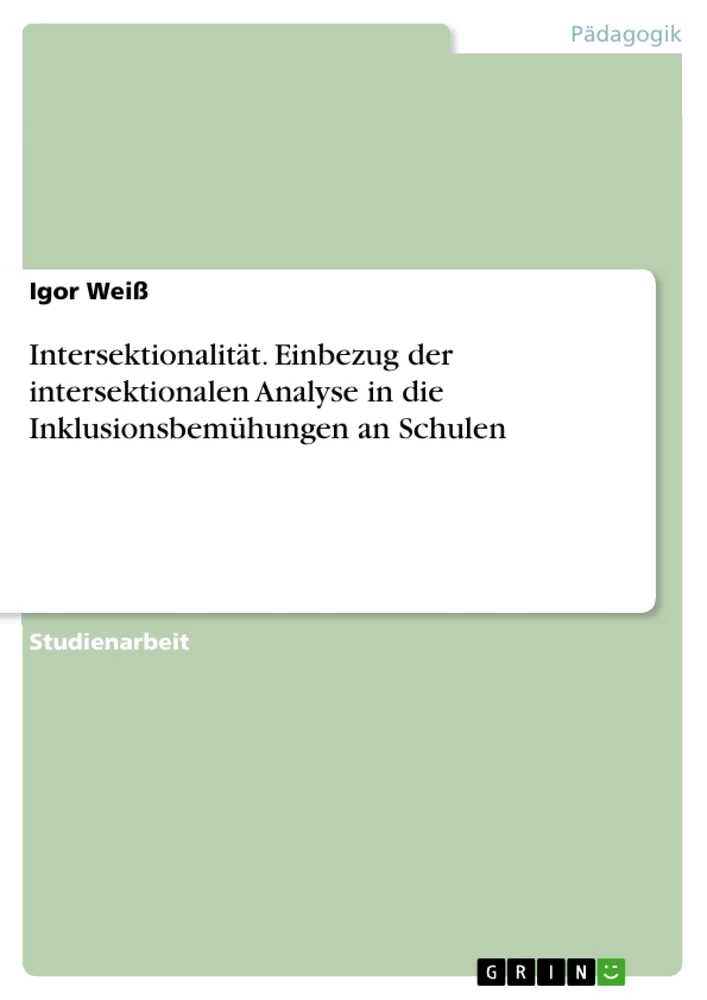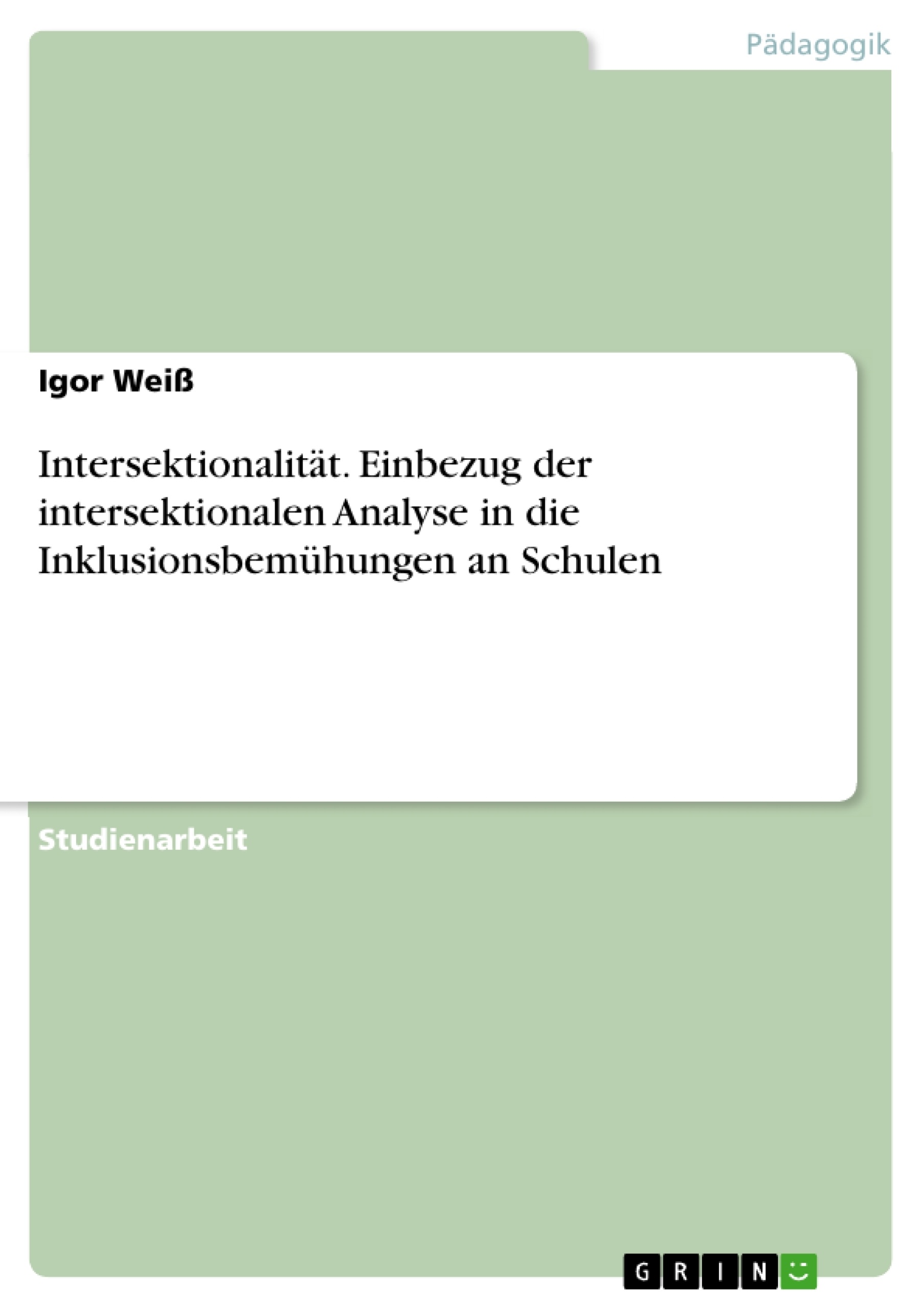„Inklusion – Neue Hoffnung für Kinder mit Behinderung“ so in etwa lauteten Überschriften zahlreicher Zeitungsartikel, als 2009 die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland verbindlich eingeführt wurden. Neugeordnete Voraussetzungen zur Teilhabe aller Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft, v. a. in der Schule, wurden von einer Vielzahl von Politikern propagierte. Gestützt wurde das Konstrukt durch Eingebungen wie Diversität und Heterogenität, die ebenfalls als folgenreiche Konzepte in Theorie und Praxis Eingang fanden. Das der Gedanke der Heterogenität bis zur Kategorienlehre des Aristoteles im antiken Griechenland zurückreicht, findet in der heutigen Diskussion selten Erwähnung. Dessen Lehre wurde demzufolge in Europa eine lange Zeit als die Schrift zur Logik gesehen und wirkt bis heute in unsere Sprache. Das Wort heterogen lässt sich im altgriechischen Adjektiv heterogénes finden. Es setzt sich aus heteros (verschieden) und gennáo (erzeugen, schaffen) zusammen. Damit sind Phänomene gemeint, die voneinander verschieden sind, ohne sich untergeordnet zu sein. So schnell die Euphorie um das Thema der Inklusion Einzug in Bildung, Politik und Medien fand, umso schneller senkte sich diese wieder ab als die ersten Hürden in der Praxis deutlich wurden. Wird heutzutage über Inklusion an Schulen berichtet, so spricht man von einem „Schleudergang“ der Inklusion und von einem „holprigen Weg zum Miteinander“ für Kinder mit besonderem Förderbedarf.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. THEORETISCHER HINTERGRUND
- 2.1 DEFINITION VON INKLUSION UND EXKLUSION (IM KONTEXT SCHULE)
- 2.2 AKTUELLER STAND DER INKLUSIONSDEBATTE IN DEUTSCHLAND
- 2.3 DAS INTERSEKTIONALITÄTSKONZEPT UND DESSEN BEDEUTUNG FÜR DIE INKLUSIONTHEMATIK
- 2.4 ANALYSEINSTRUMENT INTERSEKTIONALITÄT
- 3. EXEMPLARISCHES FALLBEISPIEL
- 4. BEISPIELANALYSE ANHAND DES EXEMPLARISCHEN FALLBEISPIELS
- 5. AUSBLICK FÜR DEN EINBEZUG DES INTERSEKTIONALITÄTSANSATZES IN DEN INKLUSIONPROZESS AN SCHULEN
- 6. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie der Intersektionalitätsansatz in den Inklusionsprozess an Schulen integriert werden kann, um die Diskriminierungs- und Exklusionserfahrungen bildungsbenachteiligter Schüler zu adressieren. Sie analysiert die Definitionen von Inklusion und Exklusion im schulischen Kontext, beleuchtet den aktuellen Stand der Inklusionsdebatte in Deutschland und präsentiert das Intersektionalitätskonzept als wichtiges Analyseinstrument.
- Definition von Inklusion und Exklusion im Kontext Schule
- Der aktuelle Stand der Inklusionsdebatte in Deutschland
- Das Intersektionalitätskonzept und dessen Bedeutung für die Inklusion
- Intersektionalität als Analyseinstrument für die Untersuchung von Exklusionserfahrungen
- Möglichkeiten der Integration des Intersektionalitätsansatzes in den Inklusionsprozess an Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die anfängliche Euphorie um das Thema Inklusion nach der Einführung der UN-Behindertenrechtskonvention und den darauf folgenden Herausforderungen in der Praxis. Sie hebt die Notwendigkeit einer Neuorientierung der Inklusion hervor, die über die Berücksichtigung von Schülern mit Behinderung und Migrationshintergrund hinausgeht und eine intersektionale Perspektive einnimmt. Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit wird formuliert: Wie kann der Intersektionalitätsansatz im Inklusionsprozess an Schulen genutzt werden, um für eine Sensibilisierung bisher unberücksichtigter Diskriminierungs- und Exklusionserfahrungen bildungsbenachteiligter Schüler zu sorgen?
2. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit den Begriffen Inklusion und Exklusion. Es werden verschiedene Definitionen aus der sonderpädagogischen und bildungsethischen Perspektive vorgestellt und im Kontext der Systemtheorie nach Luhmann diskutiert. Der aktuelle Stand der Inklusionsdebatte in Deutschland wird beleuchtet, inklusive der historischen Entwicklung des Begriffs „Inklusion“ und der Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention. Ein Schwerpunkt liegt auf der Darstellung des Intersektionalitätskonzepts, seiner Bedeutung für die Inklusion und seiner Anwendung als Analyseinstrument. Der intersektionale Analyserahmen nach Riegel (2016) wird vorgestellt, um die Abhängigkeit der drei Analyse-Ebenen (gesellschaftliche Bedingungen, soziale Praxen und Bedeutungen, Subjektebene) zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Inklusion, Exklusion, Intersektionalität, inklusive Bildung, Schulische Inklusion, Bildungsbenachteiligung, Diskriminierung, Heterogenität, UN-Behindertenrechtskonvention, Analyserahmen, soziale Praxen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Intersektionalitätsansatz in der Schulischen Inklusion
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie der Intersektionalitätsansatz in den Inklusionsprozess an Schulen integriert werden kann, um Diskriminierungs- und Exklusionserfahrungen bildungsbenachteiligter Schüler zu adressieren. Sie analysiert die Definitionen von Inklusion und Exklusion im schulischen Kontext, beleuchtet den aktuellen Stand der Inklusionsdebatte in Deutschland und präsentiert das Intersektionalitätskonzept als wichtiges Analyseinstrument.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition von Inklusion und Exklusion im Kontext Schule, den aktuellen Stand der Inklusionsdebatte in Deutschland, das Intersektionalitätskonzept und dessen Bedeutung für die Inklusion, Intersektionalität als Analyseinstrument für Exklusionserfahrungen und Möglichkeiten der Integration des Intersektionalitätsansatzes in den Inklusionsprozess an Schulen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund (inkl. Definitionen von Inklusion/Exklusion, aktueller Stand der Inklusionsdebatte, Intersektionalitätskonzept und -analyse), Exemplarischer Fallbeispiel, Beispielanalyse anhand des Fallbeispiels, Ausblick für den Einbezug des Intersektionalitätsansatzes in den Inklusionsprozess an Schulen und Fazit.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung beleuchtet die anfängliche Euphorie um Inklusion nach der UN-Behindertenrechtskonvention und die Herausforderungen in der Praxis. Sie betont die Notwendigkeit einer intersektionale Perspektive und formuliert die zentrale Forschungsfrage: Wie kann der Intersektionalitätsansatz im Inklusionsprozess an Schulen genutzt werden, um bisher unberücksichtigte Diskriminierungs- und Exklusionserfahrungen bildungsbenachteiligter Schüler zu adressieren?
Was beinhaltet der theoretische Hintergrund?
Der theoretische Hintergrund bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit Inklusion und Exklusion, verschiedenen Definitionen aus sonderpädagogischer und bildungsethischer Perspektive, dem aktuellen Stand der Inklusionsdebatte in Deutschland (inkl. historischer Entwicklung und Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention) und dem Intersektionalitätskonzept als Analyseinstrument. Der intersektionale Analyserahmen nach Riegel (2016) wird vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Inklusion, Exklusion, Intersektionalität, inklusive Bildung, Schulische Inklusion, Bildungsbenachteiligung, Diskriminierung, Heterogenität, UN-Behindertenrechtskonvention, Analyserahmen, soziale Praxen.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet den Intersektionalitätsansatz als Analyseinstrument, um Exklusionserfahrungen bildungsbenachteiligter Schüler zu untersuchen. Ein exemplarischer Fall wird analysiert, um die Anwendung des Ansatzes zu veranschaulichen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Integration des Intersektionalitätsansatzes in den schulischen Inklusionsprozess zu untersuchen und Handlungsempfehlungen für eine inklusive Schulpraxis zu geben, die die vielschichtigen Diskriminierungserfahrungen von Schüler*innen berücksichtigt.
- Quote paper
- Igor Weiß (Author), 2018, Intersektionalität. Einbezug der intersektionalen Analyse in die Inklusionsbemühungen an Schulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424870