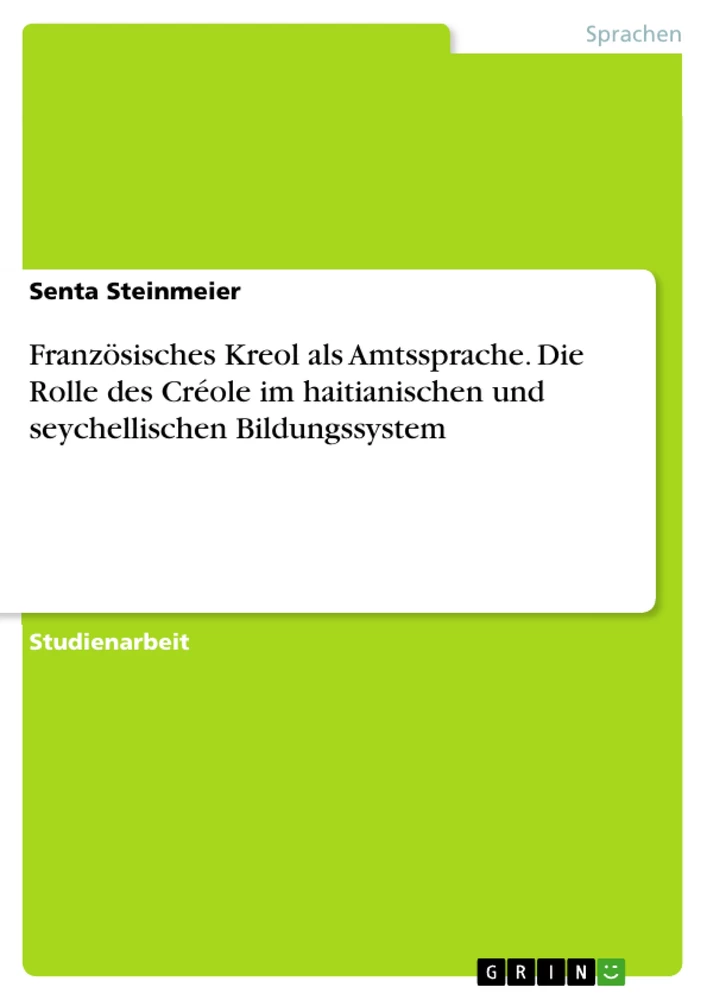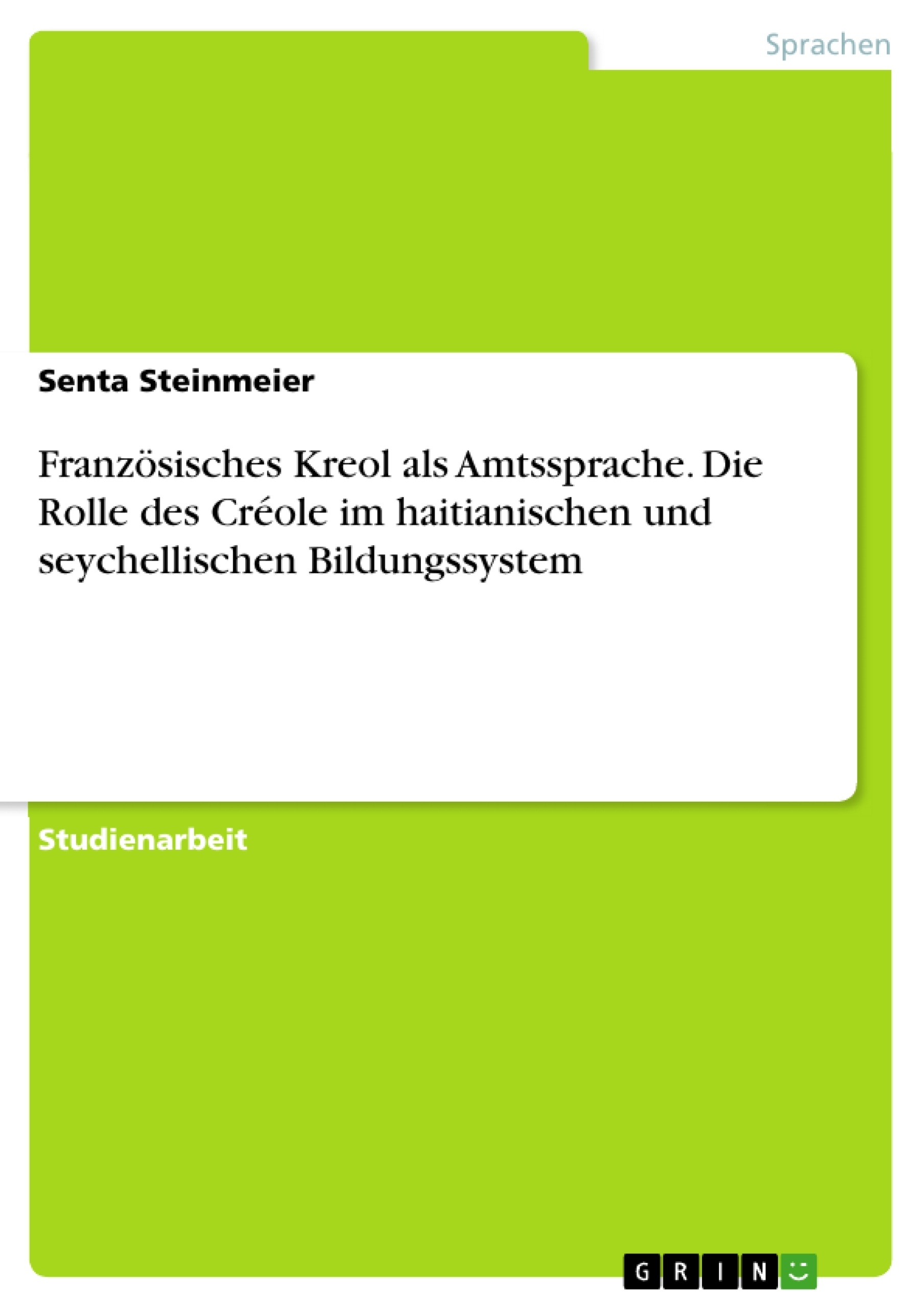Die Seychellen und Haiti sind die einzigen Staaten, in denen das Kreolische neben Französisch bzw. Englisch die offizielle Amtssprache ist. Fleischmann ordnet ein, dass die Motivation zur Durchsetzung einer National- bzw. Amtssprache oft nicht in der sprachlichen Homogenisierung der Staatsbevölkerung liegt, sondern vielmehr in der kulturellen Abgrenzung nach außen. Nationale Unterschiede zu betonen, soll die Solidarität nach innen begünstigen. Jedoch schränkt er für Entwicklungsländer ein, dass die Staatssprache meist noch der Sprache der ehemaligen Kolonialmacht entspricht. Dies wird von der nationalen Elite damit begründet, dass man die Verbindung zu der ehemaligen Kolonialmacht aufrechterhalten, eine kulturelle Isolierung vermeiden und den Verlust des Kontaktes zum fortschrittlicheren Ausland verhindern müsse. Das Ansehen und die Rolle einer Sprache in einer Gesellschaft sind auch Ergebnis einer staatlichen Regulierung, also eines sprachpolitischen Programms. Govain bezieht, definiert Sprachpolitik als « l’ensemble des choix d’un État en matière de la langue et de la culture. Elle tient à la définition d’objectifs généraux (statut, emploi et fonction des langues, implication en matière d’éducation, de formation, d’information et de communication, etc.). Indépendamment des processus décisionnels mis en œuvre, toute politique doit se fonder sur une analyse des situations (sociolinguistiques, sociopolitiques, socioéconomiques et socioculturelles) et sur une approche prospective de leur évolution. » Es wird deutlich, dass die Schule bei der „approche prospective de leur évolution“, also der Sprache, die Rolle einer einflussreichen Institution hat. Aus diesem Grund ist es lohnenswert, die sprachpolitische Umsetzung des Kreolischen im Bildungssystem von Haiti und den Seychellen zu untersuchen – ein Bereich, in dem Amtssprachen nach Nißls Definition zum Tragen kommen –, da Haiti und die Seychellen die ersten Länder sind, die eine kreolische Bildungsreform anstrebten. Genauer wird betrachtet, welchen Status das Kreolische als Amtssprache heute tatsächlich auf Haiti und den Seychellen einnimmt und wie es politisch gefördert wird. Man könnte also davon ausgehen, dass sich die sprachliche Situation ähnelt. Weiter wird analysiert, ob auf den Seychellen und Haiti eine ausgewogene Diglossie herrscht, oder ob das Créole als minderwertiger gegenüber dem Französischen angesehen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kreolsprachen
- 3. Fergusons Diglossiebegriff
- 4. Haiti
- 4.1 Sprachpolitische Gesetzgebung auf Haiti
- 4.2 Rolle des Haitikreols im Bildungssystem
- 5. Seychellen
- 5.1 Sprachpolitische Gesetzgebung auf den Seychellen
- 5.2 Rolle des Seychellenkreols im Bildungssystem
- 6. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Status kreolischer Sprachen, insbesondere auf Haiti und den Seychellen, als Amtssprachen. Sie analysiert die sprachpolitischen Maßnahmen in beiden Ländern und deren Auswirkungen auf das Bildungssystem. Ein weiterer Fokus liegt auf der Untersuchung, ob eine ausgewogene Diglossie zwischen Kreolisch und den jeweiligen europäischen Amtssprachen (Französisch und Englisch) besteht.
- Definition und Entstehung von Kreolsprachen
- Fergusons Diglossiebegriff und seine Anwendbarkeit auf Haiti und die Seychellen
- Sprachpolitik in Haiti und auf den Seychellen
- Rolle des Kreolischen im Bildungssystem beider Länder
- Soziolinguistischer Status des Kreolischen auf Haiti und den Seychellen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Ausgangssituation dar: Haiti und die Seychellen sind die einzigen Staaten, in denen eine kreolische Sprache neben Französisch bzw. Englisch offizielle Amtssprache ist. Sie führt die Definition von Amtssprache nach Nißl ein und skizziert die Forschungsfrage nach dem tatsächlichen Status des Kreolischen in Bildung und Politik beider Länder. Die Einleitung verweist auf die unterschiedlichen Motivationen hinter der Durchsetzung von Amtssprachen, insbesondere den Aspekt der kulturellen Abgrenzung und die Rolle der ehemaligen Kolonialmacht. Sie legt den Grundstein für die Analyse der sprachpolitischen Programme und ihrer Umsetzung im Bildungswesen.
2. Kreolsprachen: Dieses Kapitel widmet sich der Definition von Kreolsprachen und deren Entstehung im Kontext der europäischen Kolonialgeschichte. Es beleuchtet die unterschiedlichen Bedeutungen und Verwendung des Begriffs "Créole" in verschiedenen Kontexten, insbesondere auf den Seychellen und in Haiti. Die Arbeit verwendet eine soziolinguistische Definition von Bollée und Stein, die die Entstehung von Kreolsprachen als Resultat des unvollständigen Erlernens der Kolonialsprache durch die unterdrückte Bevölkerung beschreibt. Der Fokus liegt auf der sozialen Ungleichheit und der Rolle der Sklaverei in der Entwicklung kreolischer Sprachen.
3. Fergusons Diglossiebegriff: Dieses Kapitel führt den Diglossiebegriff nach Ferguson ein. Obwohl nicht explizit im gegebenen Textausschnitt beschrieben, kann man annehmen, dass dieses Kapitel den theoretischen Rahmen für die Analyse der sprachlichen Situation in Haiti und auf den Seychellen liefern wird. Es wird die Definition und Anwendung des Begriffs erläutert und möglicherweise auf seine Grenzen und seine Anwendbarkeit in Bezug auf Kreolsprachen eingegangen. Die Bedeutung für die weitere Analyse der sprachlichen Verhältnisse in Haiti und auf den Seychellen wird hervorgehoben.
4. Haiti: Dieses Kapitel beschreibt die soziopolitische Situation und die sprachpolitischen Programme in Haiti. Es konzentriert sich auf die Rolle des Haiti-Kreols im Bildungssystem, die Gesetzgebung und die damit verbundenen Herausforderungen. Die Analyse wird den Status des Haiti-Kreols als Amtssprache beleuchten und die politischen Bemühungen zur Förderung der Sprache im Bildungskontext untersuchen. Dabei wird der komplexe Zusammenhang zwischen Sprache, Politik und Gesellschaft in Haiti analysiert.
5. Seychellen: Ähnlich wie Kapitel 4 untersucht dieses Kapitel den Status des Seychellenkreols als Amtssprache und die sprachpolitischen Maßnahmen des Landes. Der Schwerpunkt liegt auf der Rolle der Sprache im Bildungssystem, wobei die sprachpolitische Gesetzgebung und deren Auswirkungen auf die Verbreitung und den Gebrauch des Kreolischen im Unterricht beleuchtet werden. Die Analyse wird den aktuellen Status des Kreolischen auf den Seychellen erörtern und die Herausforderungen bei der Umsetzung sprachpolitischer Ziele im Bildungswesen untersuchen.
Schlüsselwörter
Kreolsprachen, Diglossie, Sprachpolitik, Haiti, Seychellen, Bildungssystem, Amtssprache, Soziolinguistik, Kolonialismus, Sprachplanung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Der Status kreolischer Sprachen auf Haiti und den Seychellen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Status kreolischer Sprachen, insbesondere auf Haiti und den Seychellen, als Amtssprachen. Sie analysiert die sprachpolitischen Maßnahmen in beiden Ländern und deren Auswirkungen auf das Bildungssystem. Ein weiterer Fokus liegt auf der Untersuchung, ob eine ausgewogene Diglossie zwischen Kreolisch und den jeweiligen europäischen Amtssprachen (Französisch und Englisch) besteht.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Entstehung von Kreolsprachen, Fergusons Diglossiebegriff und seine Anwendbarkeit auf Haiti und die Seychellen, Sprachpolitik in Haiti und auf den Seychellen, die Rolle des Kreolischen im Bildungssystem beider Länder und den soziolinguistischen Status des Kreolischen auf Haiti und den Seychellen.
Welche Länder stehen im Mittelpunkt der Untersuchung?
Die Arbeit konzentriert sich auf Haiti und die Seychellen, da diese die einzigen Staaten sind, in denen eine kreolische Sprache neben Französisch bzw. Englisch offizielle Amtssprache ist.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Kreolsprachen, Fergusons Diglossiebegriff, Haiti (inkl. Sprachpolitische Gesetzgebung und Rolle des Haitikreols im Bildungssystem), Seychellen (inkl. Sprachpolitische Gesetzgebung und Rolle des Seychellenkreols im Bildungssystem) und Schlussfolgerung.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den tatsächlichen Status des Kreolischen in Bildung und Politik auf Haiti und den Seychellen zu untersuchen und die sprachpolitischen Maßnahmen und deren Auswirkungen zu analysieren.
Welcher theoretische Rahmen wird verwendet?
Die Arbeit verwendet Fergusons Diglossiebegriff als theoretischen Rahmen, um die sprachliche Situation in Haiti und auf den Seychellen zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Definition und Anwendung des Begriffs und geht möglicherweise auf seine Grenzen und Anwendbarkeit in Bezug auf Kreolsprachen ein.
Wie wird der Begriff "Kreolsprache" definiert?
Die Arbeit verwendet eine soziolinguistische Definition von Bollée und Stein, die die Entstehung von Kreolsprachen als Resultat des unvollständigen Erlernens der Kolonialsprache durch die unterdrückte Bevölkerung beschreibt. Der Fokus liegt auf der sozialen Ungleichheit und der Rolle der Sklaverei in der Entwicklung kreolischer Sprachen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kreolsprachen, Diglossie, Sprachpolitik, Haiti, Seychellen, Bildungssystem, Amtssprache, Soziolinguistik, Kolonialismus, Sprachplanung.
Wie werden Haiti und die Seychellen im Detail untersucht?
Die Kapitel zu Haiti und den Seychellen beschreiben die soziopolitische Situation und die sprachpolitischen Programme der jeweiligen Länder. Der Fokus liegt auf der Rolle des Kreols im Bildungssystem, der Gesetzgebung und den damit verbundenen Herausforderungen. Die Analyse beleuchtet den Status des Kreols als Amtssprache und die politischen Bemühungen zur Förderung der Sprache im Bildungskontext.
- Quote paper
- Senta Steinmeier (Author), 2017, Französisches Kreol als Amtssprache. Die Rolle des Créole im haitianischen und seychellischen Bildungssystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424182