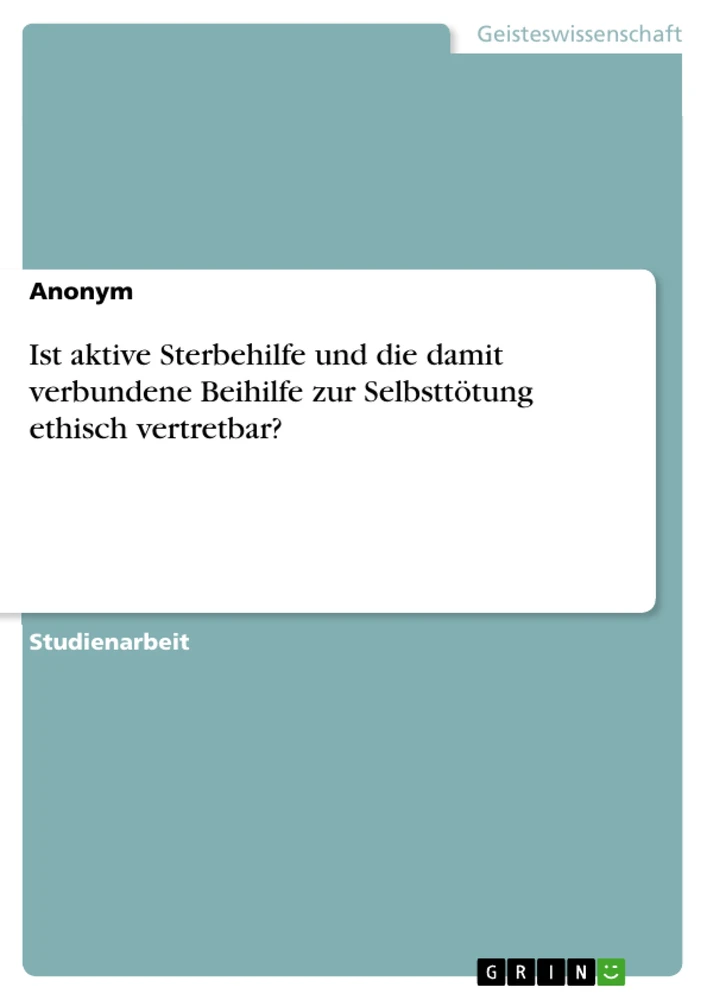Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde die aktive Sterbehilfe in den Niederlanden und in Belgien legalisiert, in der Schweiz ist die Beihilfe zum Suizid keine Straftat mehr. Schwerkranken Menschen ist es dort möglich, auf eigenen und freien Willen hin von den Leiden und Qualen ihrer Krankheit befreit zu werden. Wir Deutschen werden schnell kleinlaut, wenn es um das Thema Tod geht. So auch, wenn über die Situation am Lebensende diskutiert wird. Vermutlich ist das auf unsere jüngste Geschichte zurückzuführen. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurden über 100 000 Menschen mutwillig und geplant umgebracht. Ein Massenmord, von dem meist wehrlose Menschen, wie geistig und körperlich Behinderte, betroffen waren.
Obwohl das Thema Sterbehilfe in Deutschland vor einigen Jahren noch ein Tabuthema war, läuft jetzt die Debatte über die Einführung der aktiven Sterbehilfe und des assistierten Suizids. Aufgrund eines gesellschaftlichen Wertewandels ist die Sterbehilfe nicht mehr derartig verrufen wie noch vor einigen Jahren. Der Drang nach einer persönlichen Selbstbestimmung ist ein wichtiger Faktor, der diese Debatte anheizt. Grund für die Diskussion ist aber der technische Fortschritt in der Medizin, welcher mittlerweile eine Vielzahl an Möglichkeiten bietet, schwere Krankheiten zu heilen oder zumindest das Leben um einige Monate oder sogar Jahre zu verlängern. Allerdings muss sich hierbei die Frage gestellt werden, bis zu welchem Gesundheits- beziehungsweise Krankheitsstatus ein würdiges Leben garantiert werden kann.
Im Folgenden soll ein Überblick über die deutsche Sterbehilfepolitik gegeben werden. Hierfür werden zuerst verschiedene Arten der Sterbehilfe aufgezeigt und ihre rechtlichen Grundlagen dargelegt. Anschließend folgt eine ethische Debatte über die Gründe, die für eine legale Sterbehilfe sprechen und die negativen Auswirkungen, welche dies zu Folge haben könnte. Für die Definitionen der Sterbehilfe und der Palliativmedizin und für die rechtlichen Grundlagen habe ich mich auf die Literaturrecherche bezogen, wohingegen die ethische Debatte meinen Argumenten zugrunde liegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Aktive Sterbehilfe
- Beihilfe zur Selbsttötung (assistierter Suizid)
- Passive Sterbehilfe
- Indirekte Sterbehilfe
- Rechtliche Grundlagen
- Ethischer Diskurs
- Gründe gegen die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und des assistierten Suizids
- Gründe für die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und des assistierten Suizids
- Palliativ Care als Alternative zum assistierten Suizid
- Die Entwicklung von Palliativ Care
- Zentrale Ziele
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit gibt einen Überblick über die deutsche Sterbehilfepolitik. Sie beleuchtet verschiedene Arten der Sterbehilfe, deren rechtliche Grundlagen und den ethischen Diskurs darum. Die Arbeit untersucht die Argumente für und gegen die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und des assistierten Suizids und betrachtet Palliativmedizin als Alternative.
- Definition und Abgrenzung verschiedener Formen der Sterbehilfe
- Rechtliche Situation der Sterbehilfe in Deutschland
- Ethische Argumentation für und gegen die Legalisierung der Sterbehilfe
- Palliativ Care als Alternative zum assistierten Suizid
- Der gesellschaftliche Wandel im Umgang mit dem Thema Sterben
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die aktuelle Situation der Sterbehilfe in verschiedenen Ländern dar, insbesondere den Unterschied zur deutschen Debatte. Sie führt in die Thematik ein, indem sie auf die Legalisierung in den Niederlanden, Belgien und die Situation in der Schweiz eingeht und den historischen Kontext in Deutschland (Nationalsozialismus) erwähnt. Sie betont den gesellschaftlichen Wertewandel und den Einfluss des medizinischen Fortschritts auf die Debatte um die Sterbehilfe und Selbstbestimmung am Lebensende.
Definitionen: Dieses Kapitel differenziert zwischen Sterbehilfe und Sterbebegleitung, wobei letztere als Unterstützung in der letzten Lebensphase beschrieben wird. Es definiert und erläutert die verschiedenen Arten der Sterbehilfe: aktive Sterbehilfe (Tötung auf Verlangen), Beihilfe zur Selbsttötung (assistierter Suizid), passive Sterbehilfe (Unterlassen lebensverlängernder Maßnahmen) und indirekte Sterbehilfe (Schmerzlinderung mit der Möglichkeit der Lebensverkürzung als Nebenwirkung). Die jeweiligen rechtlichen Implikationen werden angedeutet. Der Fokus liegt auf der klaren Unterscheidung der einzelnen Handlungsweisen und deren ethischen Implikationen.
Rechtliche Grundlagen: Dieses Kapitel (dessen Inhalt hier aufgrund des vorliegenden Textes nur kurz angedeutet werden kann) beschreibt die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Sterbehilfe in Deutschland. Es wird auf die strafrechtlichen Konsequenzen der verschiedenen Formen der Sterbehilfe eingegangen, insbesondere auf die Strafbarkeit der aktiven Sterbehilfe nach §216 StGB. Auch die Rolle der Patientenverfügung im Kontext der passiven Sterbehilfe wird vermutlich beleuchtet.
Ethischer Diskurs: Dieses Kapitel behandelt die ethischen Argumente für und gegen die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und des assistierten Suizids. Es dürfte verschiedene Positionen und Perspektiven präsentieren und die dahinterstehenden Werte und Prinzipien erörtern. Die Diskussion umfasst wahrscheinlich Fragen der Selbstbestimmung, des Rechts auf Leben und Sterben, der Würde des Menschen und der Verantwortung von Ärzten.
Palliativ Care als Alternative zum assistierten Suizid: Dieses Kapitel widmet sich der Palliativmedizin als Alternative zur Sterbehilfe. Es beschreibt die Entwicklung und die zentralen Ziele der Palliativ Care, welche darauf abzielen, die Lebensqualität von schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu verbessern und Leiden zu lindern. Der Fokus liegt wahrscheinlich auf der Darstellung von Palliativ Care als ethisch vertretbare und menschenwürdige Möglichkeit, Sterbende zu begleiten und ihren Lebensabend zu gestalten.
Schlüsselwörter
Sterbehilfe, assistierter Suizid, aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, indirekte Sterbehilfe, Palliativ Care, Selbstbestimmung, Lebensende, ethische Fragen, Rechtliche Grundlagen, Deutschland, §216 StGB, Patientenverfügung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Überblick über die deutsche Sterbehilfepolitik
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die deutsche Sterbehilfepolitik. Es beinhaltet eine Einleitung, Definitionen verschiedener Formen der Sterbehilfe, die rechtlichen Grundlagen, einen ethischen Diskurs zu den Argumenten für und gegen die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und des assistierten Suizids, eine Betrachtung der Palliativmedizin als Alternative sowie ein Fazit. Es werden Kapitelzusammenfassungen, Schlüsselwörter und eine Zielsetzung aufgeführt.
Welche Arten der Sterbehilfe werden definiert?
Das Dokument unterscheidet zwischen aktiver Sterbehilfe (Tötung auf Verlangen), Beihilfe zur Selbsttötung (assistierter Suizid), passiver Sterbehilfe (Unterlassen lebensverlängernder Maßnahmen) und indirekter Sterbehilfe (Schmerzlinderung mit der Möglichkeit der Lebensverkürzung als Nebenwirkung). Die jeweiligen rechtlichen Implikationen werden angedeutet.
Wie ist die rechtliche Situation der Sterbehilfe in Deutschland?
Das Dokument beschreibt die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Sterbehilfe in Deutschland und geht auf die strafrechtlichen Konsequenzen der verschiedenen Formen der Sterbehilfe ein, insbesondere auf die Strafbarkeit der aktiven Sterbehilfe nach §216 StGB. Die Rolle der Patientenverfügung im Kontext der passiven Sterbehilfe wird ebenfalls erwähnt.
Welche ethischen Argumente werden im Dokument behandelt?
Der ethische Diskurs behandelt Argumente für und gegen die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und des assistierten Suizids. Es werden verschiedene Positionen und Perspektiven präsentiert und die dahinterstehenden Werte und Prinzipien (Selbstbestimmung, Recht auf Leben und Sterben, Würde des Menschen, Verantwortung von Ärzten) erörtert.
Wie wird Palliativ Care im Kontext der Sterbehilfe dargestellt?
Palliativmedizin wird als Alternative zur Sterbehilfe dargestellt. Das Dokument beschreibt die Entwicklung und die zentralen Ziele der Palliativ Care, die darauf abzielen, die Lebensqualität von schwerkranken Menschen zu verbessern und Leiden zu lindern. Es wird als ethisch vertretbare und menschenwürdige Möglichkeit der Begleitung Sterbender präsentiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Thema?
Schlüsselwörter beinhalten: Sterbehilfe, assistierter Suizid, aktive Sterbehilfe, passive Sterbehilfe, indirekte Sterbehilfe, Palliativ Care, Selbstbestimmung, Lebensende, ethische Fragen, Rechtliche Grundlagen, Deutschland, §216 StGB, Patientenverfügung.
Welche Ziele verfolgt das Dokument?
Das Dokument gibt einen Überblick über die deutsche Sterbehilfepolitik und beleuchtet verschiedene Arten der Sterbehilfe, deren rechtliche Grundlagen und den ethischen Diskurs. Es untersucht Argumente für und gegen die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und des assistierten Suizids und betrachtet Palliativmedizin als Alternative. Es soll ein Verständnis für die Komplexität des Themas schaffen.
Wie wird der internationale Kontext berücksichtigt?
Die Einleitung vergleicht die Situation der Sterbehilfe in Deutschland mit der in anderen Ländern (Niederlande, Belgien, Schweiz) und erwähnt den historischen Kontext in Deutschland (Nationalsozialismus). Dies dient als Einordnung der deutschen Debatte in einen internationalen und historischen Rahmen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Ist aktive Sterbehilfe und die damit verbundene Beihilfe zur Selbsttötung ethisch vertretbar?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/423495