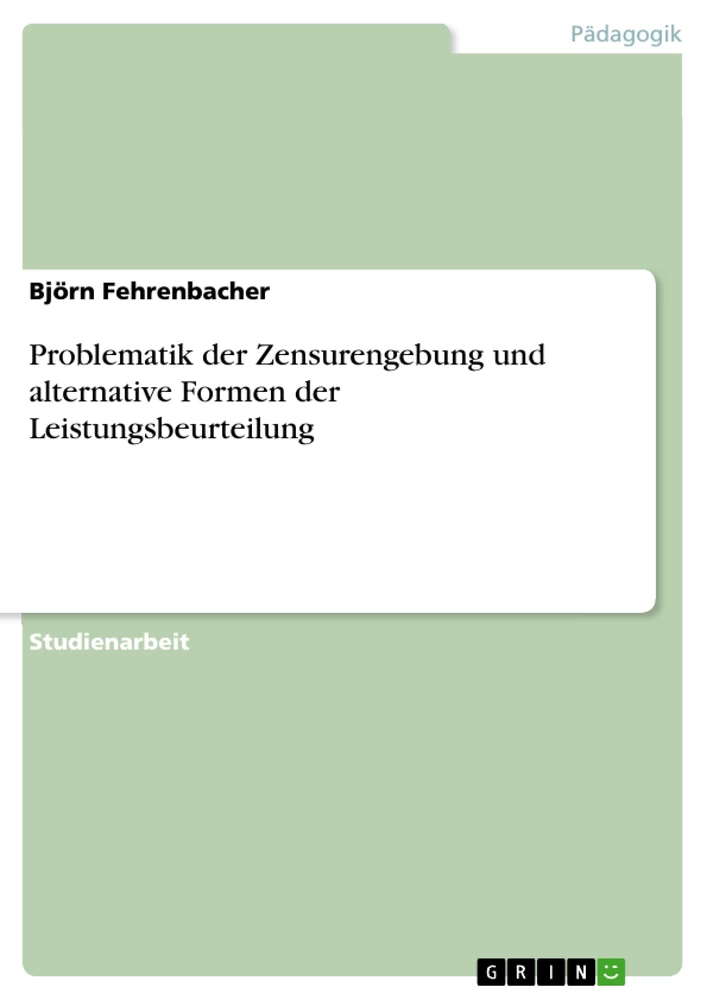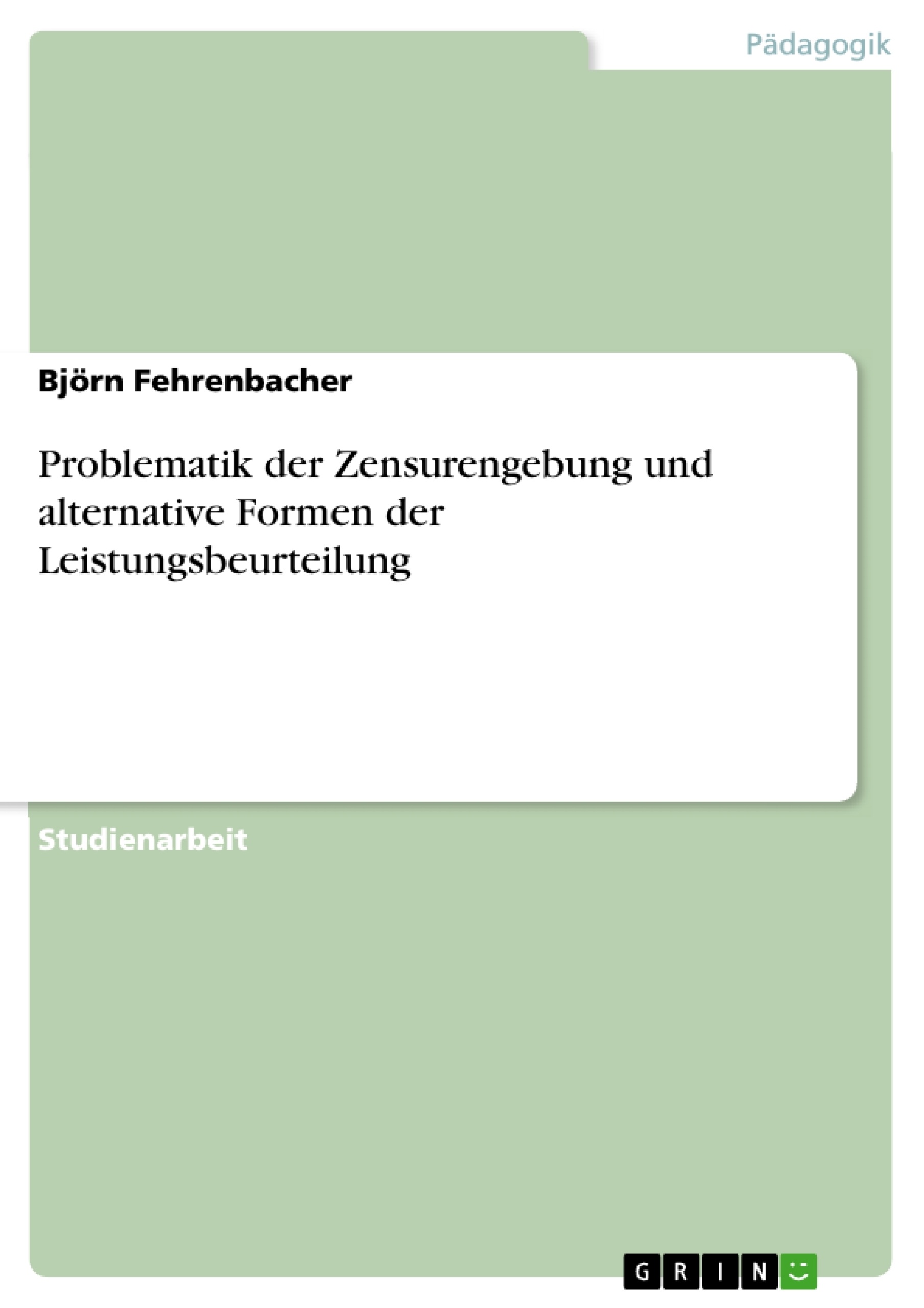Feststellung und Bewertung von Schülerleistungen sind häufig besonders schwierig, insbesondere deshalb, weil der reine Informationsgehalt von Noten relativ niedrig ist. Diese Problematik wird an mehreren Beispielen exemplarisch aufgezeigt, insbesondere werden der Wert der Schulnotenskala, die vielfach vorherrschende Normalverteilung und die unterschiedlichen Bezugsnormen kritisch hinterfragt. Die Bewertung von Schülerleistungen ist vielfach auch durch subjektive Fehlerquellen in erheblichem Maße beeinflusst. Da es für den Lehrer wichtig ist, diese zu kennen, werden diese Fehlerquellen besonders detailliert beschrieben. Was letztlich bleibt ist die Frage, was man heute besser machen sollte. Der Schrei nach alternativen Bewertungsformen wird immer lauter. Wie können Schülerleistungen heute objektiver bewertet werden, was leisten beispielsweise Verbalbeurteilungen, Schülerselbstbewertungen oder Portfolios? Letztlich soll geklärt werden, mit welchen Maßnahmen sich Klassenarbeiten gezielter vorbereiten lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführende Worte
-
1. Problematik der Notengebung
- 1.1 Geschichtliche Entwicklung der Zensur
- 1.2 Der Wert der Schulnotenskala
-
1.3 Die Funktion der Zensur im Spannungsfeld von Anspruch und Wirklichkeit
- 1.3.1 Berichts-/Kontroll- und Orientierungsfunktion (Diagnostische Funktion)
- 1.3.2 Pädagogische Funktion („Anreiz-Funktion“)
- 1.3.3 Auslese-, Berechtigungs- und Rangierungsfunktion (Rechtliche Funktion)
- 1.4 Das Problem der Normalverteilung
-
1.5 Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung
-
1.5.1 Bezugsnormen der Leistungsbeurteilung
- 1.5.1.1 Sozialer oder gruppenbezogener Normmaßstab
- 1.5.1.2 Vorteile der sozialen / gruppenbezogenen Bezugsnorm
- 1.5.1.3 Nachteile der sozialen / gruppenbezogenen Bezugsnorm
-
1.5.2 Individueller oder personenbezogener Normmaßstab
- 1.5.2.1 Vorteile der individuellen / personenbezogenen Bezugsnorm
- 1.5.2.2 Nachteile der individuellen / personenbezogenen Bezugsnorm
-
1.5.3 Sachbezogener / kritikaler / curricularer oder lehrzielorientierter Norm-
- 1.5.3.1 Vorteile der sachlichen Bezugsnorm
- 1.5.3.2 Praktische Schwierigkeiten der sachlichen Bezugsnorm
- 1.5.3.3 Nachteile der sachlichen Bezugsnorm
- 1.5.4 Zusammenfassung der Auswertungsergebnisse
-
1.5.1 Bezugsnormen der Leistungsbeurteilung
- 1.6 Kriterien von Schulleistungsmessungen
-
1.7 Subjektive Fehlerquellen bei der Notengebung
- 1.7.1 Logische Fehler
- 1.7.2 Halo-Effekt (Hof- oder Überstrahlungseffekt)
- 1.7.3 Perseverationstendenz / Nähe -Fehler
- 1.7.4 Reihungseffekt und Kontrasteffekt
- 1.7.5 Beurteilungstendenzen
- 1.7.6 Projektions-/ Ähnlichkeits- und Kontrastfehler
- 1.7.7 Wissen-um-die-Folgen-Fehler
- 1.7.8 Bezugsgruppenfehler / Klassenzugehörigkeit
- 1.7.9 Pygmalion-Effekt
-
1.7.10. Weitere Fehlerquellen bei der Notengebung
- 1.7.10.1 Fachunterschiede bei der Notengebung
- 1.7.10.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Notengebung
- 1.7.10.3 Schichtspezifische Unterschiede bei der Notengebung
-
2. Verbesserungsvorschläge und Alternativen zur Leistungsbewertung
-
2.1 Verbesserungsmöglichkeiten bei Klassenarbeiten
- 2.1.1 Gezieltere Klassenarbeitsvorbereitung
-
2.1.2 Gezieltere Arbeitszusammenstellung
- 2.1.2.1 Gebundene Aufgabenformen
- 2.1.2.2 Freie Aufgabenformen
- 2.1.2.3 Weitere Festhaltungen zur verbesserten Arbeitszusammenstellung
- 2.1.3 Verbesserte Klassenarbeitsdurchführung
- 2.1.4 Verbesserte Leistungsauswertung
- 2.1.5 Verbesserte Arbeitsrückgabe bzw. Auswertung
-
2.2 Verbale Beurteilungen
- 2.2.1 Vorbemerkungen
- 2.2.2 Vorzüge und Prinzipien verbaler Beurteilungen
- 2.2.3 Beispiel: Lernberichte an der Bielefelder Laborschule
-
2.3 Schülerselbstbewertung
- 2.3.1 Vorteile der Schülerselbstbewertung
- 2.3.2 Einsatz von Schülerselbstbewertungen
- 2.3.3 Schülerselbst- und Schülerfremdbeurteilungen
-
2.4 Portfolios
- 2.4.1 Merkmale von Portfolios
- 2.4.2 Abgrenzung und Vorzüge der Portfoliomethode
- 2.4.3 Methodisch-didaktische Hinweise
- 2.4.4. Bewertung von Portfolios
-
2.1 Verbesserungsmöglichkeiten bei Klassenarbeiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Problemen der herkömmlichen Notengebung und untersucht alternative Formen der Leistungsbeurteilung im Bildungssystem. Die Analyse der Problematik der Notengebung bildet den Ausgangspunkt der Arbeit und dient als Grundlage für die Entwicklung und Vorstellung alternativer Bewertungssysteme.
- Historische Entwicklung der Zensur
- Kritikpunkte an der Schulnotenskala
- Funktionen und Auswirkungen der Notengebung
- Analyse von Fehlerquellen bei der Notengebung
- Verbesserungsvorschläge und alternative Leistungsbewertungssysteme
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 beleuchtet die Problematik der herkömmlichen Notengebung. Es wird die historische Entwicklung der Zensur sowie die Funktionsweise und die Kritik an der Schulnotenskala beleuchtet. Zudem werden die verschiedenen Bezugsnormen der Leistungsbewertung und die damit verbundenen Vor- und Nachteile diskutiert. Schließlich werden Fehlerquellen bei der Notengebung wie der Halo-Effekt und der Perseverationstendenz erläutert.
- Kapitel 2 befasst sich mit Verbesserungsvorschlägen und Alternativen zur Leistungsbewertung. Es werden Möglichkeiten zur Verbesserung von Klassenarbeiten und die Vorteile von verbalen Beurteilungen diskutiert. Zudem werden die Schülerselbstbewertung und die Portfoliomethode als wirkliche Alternativen zur Zensurengebung vorgestellt und erläutert.
Schlüsselwörter
Zensurengebung, Leistungsbeurteilung, alternative Formen der Bewertung, Bildungssystem, Bezugsnormen, Fehlerquellen, Verbesserungsvorschläge, Klassenarbeiten, verbale Beurteilungen, Schülerselbstbewertung, Portfoliomethode.
- Quote paper
- Björn Fehrenbacher (Author), 2003, Problematik der Zensurengebung und alternative Formen der Leistungsbeurteilung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42290