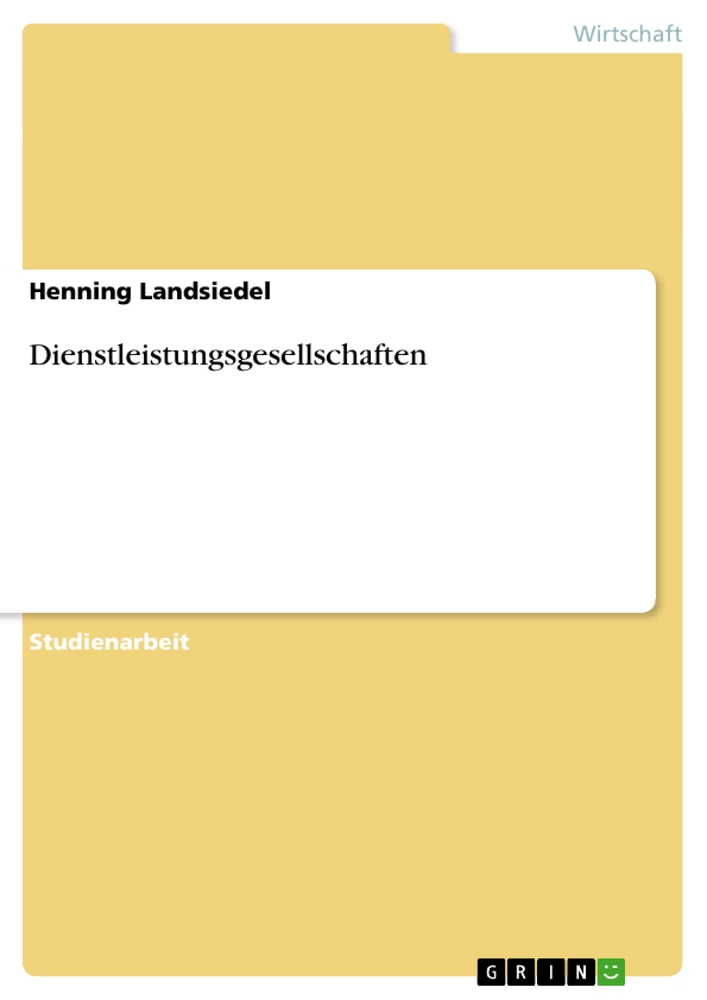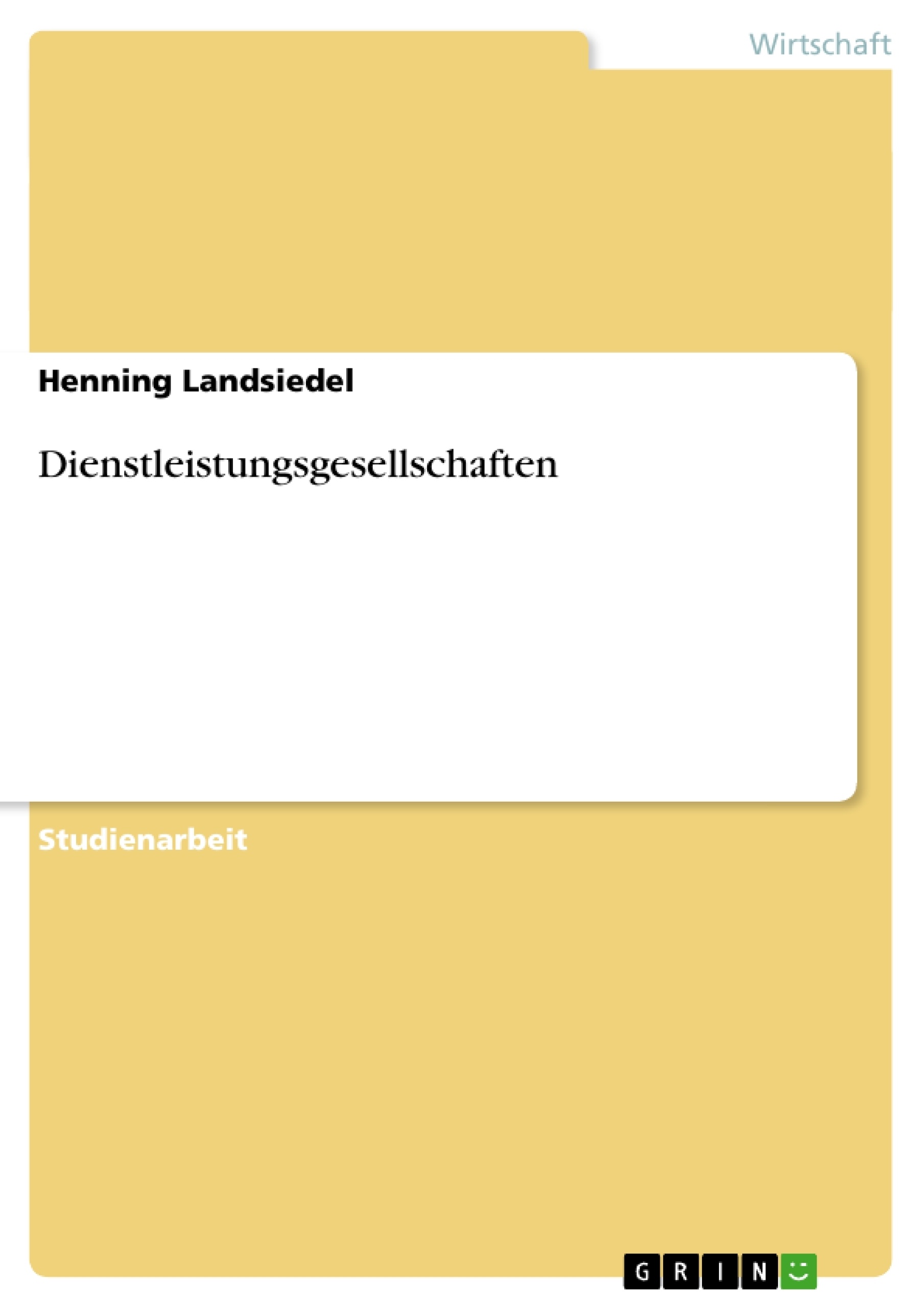Einleitung
„Wenn wir es nicht schaffen, die Arbeitslosenquote signifikant zu senken, dann haben wir es nicht verdient, wiedergewählt zu werden“ Die aktuelle Debatte um die Anzahl der Erwerbslosen in Deutschland zeigt, wie wichtig es ist, die Grundprobleme der industriellen Gesellschaft zu lösen. Die Aufgaben der Arbeitslosigkeit und der schwankenden Konjunkturdaten sind seit mehreren Jahrzehnten2 ungelöst. Die politische Debatte mündet allzu oft in der Beschwörung einer Dienstleistungsgesellschaft in Deutschland.
Bei der Definition der Begrifflichkeit sind sich allerdings viele Wissenschaftler nur in einem Punkt einig: Dienstleistungen sind ein heterogenes Sammelsurium. Meist wird eine Aufspaltung in produktionsorientierte und konsumorientierte Dienstleistungen vorgenommen, jedoch sind auch Kategorisierungen von distributiven oder gesellschaftsorientierten/sozialen4 Dienstleistungen in der Literatur auszumachen. Eine Findung einer Definition der Dienstleistungsgesellschaft scheint in der wissenschaftlich dargebotenen Vielfalt unmöglich. Daher wird die von Hartmut Häußermann und Walter Siebel vereinfachte Definition zunächst übernommen, um den Weg in eine Dienstleistungsgesellschaft fassbar zu machen.
Diese Arbeit will sich einerseits mit den klassischen ökonomischen Theorien zur Dienstleistungsgesellschaft auseinandersetzen (Kapitel zwei), andererseits die Gegebenheiten in Deutschland beschreiben und analysieren, um Gründe zu finden, warum ein zweites Wirtschafts- und Beschäftigungswunder in Deutschland anhand der Dienstleistungsstrukturen ausbleibt (Kapitel drei). Eine von den beiden Soziologen Johannes Berger und Claus Offe aufgestellte Definition der Dienstleistungen (Kapitel vier) bildet zusammen mit einem schlussfolgernden Teil (Kapitel fünf) das Ende.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Klassische Ansätze der Ökonomen
- 2.1. Sektorale und Funktionale Gliederung
- 2.2. Die drei Sektoren Theorie
- 2.3. Die Kostenkrankheit
- 2.4. Die Selbstbedienungsgesellschaft
- III. Deutschland: Eine Dienstleistungsgesellschaft
- 3.1. Die Vorbilder USA und Schweden
- 3.2. Die Umgehung der Kostenkrankheit
- 3.3. Europäische Dienstleistungsgesellschaften im Vergleich
- IV. Der soziologische Diskurs
- 4.1. Die Problematik der soziologischen Definition
- 4.2. Funktionale Erklärungen
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung Deutschlands hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Sie analysiert klassische ökonomische Theorien und vergleicht die deutsche Situation mit anderen Ländern. Ein Schwerpunkt liegt auf der Klärung der Frage, warum sich in Deutschland trotz eines hohen Anteils an Dienstleistungen kein zweites Wirtschaftswunder einstellt. Die Arbeit bezieht auch soziologische Perspektiven auf Dienstleistungen mit ein.
- Ökonomische Theorien zur Dienstleistungsgesellschaft
- Der Strukturwandel der deutschen Wirtschaft
- Vergleich mit anderen Ländern (USA, Schweden)
- Soziologische Definitionen von Dienstleistungen
- Ursachen für ausbleibende Beschäftigungswunder im Dienstleistungssektor
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Debatte um die Arbeitslosigkeit in Deutschland und den damit verbundenen Wunsch nach einer erfolgreichen Dienstleistungsgesellschaft. Sie hebt die Heterogenität des Begriffs "Dienstleistung" hervor und führt die vereinfachte Definition von Häußermann und Siebel ein, die als Grundlage für die weitere Analyse dient. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die Forschungsfragen, die sie zu beantworten versucht.
II. Klassische Ansätze der Ökonomen: Dieses Kapitel untersucht klassische ökonomische Ansätze zur Definition und zum Verständnis der Dienstleistungsgesellschaft. Es beginnt mit einer Unterscheidung zwischen sektoraler und funktionaler Gliederung von Wirtschaftszweigen und erläutert die Schwierigkeiten einer eindeutigen Kategorisierung von Dienstleistungen. Die "Drei-Sektoren-Theorie" von Fourastié wird ausführlich dargestellt, mit Fokus auf das "Uno-Actu-Prinzip" und dessen Implikationen für die Produktivität im Dienstleistungssektor. Die Diskussion umfasst den Einfluss von technischem Fortschritt und Konsumverhalten auf die Entwicklung der Dienstleistungsgesellschaft.
III. Deutschland: Eine Dienstleistungsgesellschaft: Dieses Kapitel analysiert die Situation Deutschlands im Kontext der Dienstleistungsgesellschaft. Es untersucht die Vorbilder USA und Schweden und beleuchtet Strategien zur Bewältigung der "Kostenkrankheit" im Dienstleistungssektor. Ein Vergleich mit anderen europäischen Dienstleistungsgesellschaften wird durchgeführt, um die spezifischen Herausforderungen und Chancen Deutschlands aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis, warum sich in Deutschland trotz des hohen Anteils an Dienstleistungen kein vergleichbares Wirtschaftswunder wie in anderen Ländern eingestellt hat.
IV. Der soziologische Diskurs: Das Kapitel widmet sich soziologischen Perspektiven auf Dienstleistungen. Es beleuchtet die Schwierigkeiten, eine umfassende soziologische Definition von Dienstleistungen zu finden, und untersucht funktionale Erklärungen für die Rolle von Dienstleistungen in der Gesellschaft. Der Schwerpunkt liegt darauf, die ökonomischen Ansätze aus den vorherigen Kapiteln durch ein soziologisches Verständnis zu ergänzen und dadurch ein umfassenderes Bild der Dienstleistungsgesellschaft zu zeichnen.
Schlüsselwörter
Dienstleistungsgesellschaft, Ökonomische Theorien, Sektorale Gliederung, Funktionale Gliederung, Drei-Sektoren-Theorie, Kostenkrankheit, Deutschland, USA, Schweden, Soziologische Definition, Beschäftigung, Wirtschaftswachstum, Produktivität, Konsumverhalten, Technischer Fortschritt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entwicklung Deutschlands zur Dienstleistungsgesellschaft
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung Deutschlands hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft, analysiert klassische ökonomische Theorien, vergleicht die deutsche Situation mit anderen Ländern (insbesondere den USA und Schweden) und bezieht soziologische Perspektiven mit ein. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, warum trotz des hohen Dienstleistungsanteils kein zweites Wirtschaftswunder eintritt.
Welche ökonomischen Theorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt klassische ökonomische Ansätze zur Dienstleistungsgesellschaft, darunter die sektorale und funktionale Gliederung von Wirtschaftszweigen, die Drei-Sektoren-Theorie von Fourastié (mit Fokus auf das Uno-Actu-Prinzip und dessen Auswirkungen auf die Produktivität), und die Problematik der "Kostenkrankheit" im Dienstleistungssektor. Der Einfluss von technischem Fortschritt und Konsumverhalten wird ebenfalls diskutiert.
Wie wird Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern dargestellt?
Deutschland wird im Kontext anderer Dienstleistungsgesellschaften, insbesondere der USA und Schwedens, analysiert. Es wird ein Vergleich angestellt, um die spezifischen Herausforderungen und Chancen Deutschlands aufzuzeigen und zu erklären, warum sich hier trotz des hohen Dienstleistungsanteils kein vergleichbares Wirtschaftswunder eingestellt hat wie in anderen Ländern.
Welche Rolle spielt der soziologische Diskurs?
Die Arbeit integriert soziologische Perspektiven auf Dienstleistungen. Sie beleuchtet die Schwierigkeiten, eine umfassende soziologische Definition von Dienstleistungen zu finden, und untersucht funktionale Erklärungen für deren Rolle in der Gesellschaft. Ziel ist es, die ökonomischen Ansätze durch ein soziologisches Verständnis zu ergänzen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: I. Einleitung: Einführung in die Thematik und Forschungsfragen. II. Klassische Ansätze der Ökonomen: Untersuchung klassischer ökonomischer Theorien zur Dienstleistungsgesellschaft. III. Deutschland: Eine Dienstleistungsgesellschaft: Analyse der deutschen Situation im Vergleich zu anderen Ländern. IV. Der soziologische Diskurs: Einbezug soziologischer Perspektiven. V. Fazit: Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dienstleistungsgesellschaft, Ökonomische Theorien, Sektorale Gliederung, Funktionale Gliederung, Drei-Sektoren-Theorie, Kostenkrankheit, Deutschland, USA, Schweden, Soziologische Definition, Beschäftigung, Wirtschaftswachstum, Produktivität, Konsumverhalten, Technischer Fortschritt.
Welche Forschungsfragen werden beantwortet?
Die Arbeit versucht die Frage zu beantworten, warum sich in Deutschland trotz eines hohen Anteils an Dienstleistungen kein zweites Wirtschaftswunder einstellt. Sie untersucht dazu die relevanten ökonomischen und soziologischen Aspekte.
Welche Definition von "Dienstleistung" wird verwendet?
Die Arbeit verwendet eine vereinfachte Definition von Häußermann und Siebel als Grundlage für die Analyse, wobei die Heterogenität des Begriffs "Dienstleistung" hervorgehoben wird.
- Quote paper
- Henning Landsiedel (Author), 2005, Dienstleistungsgesellschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42268