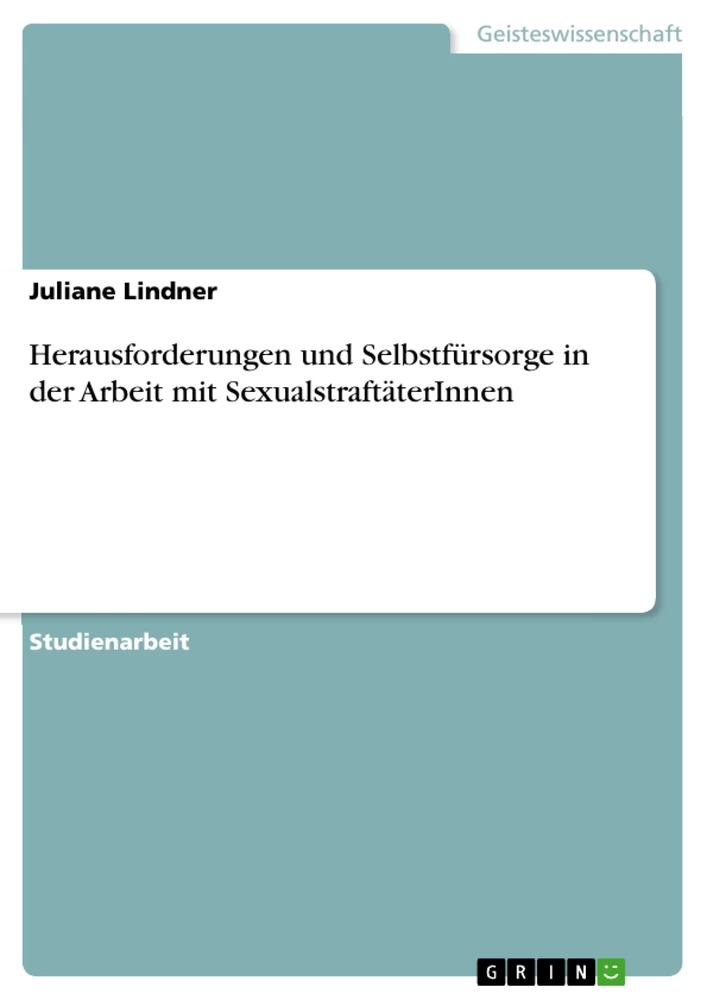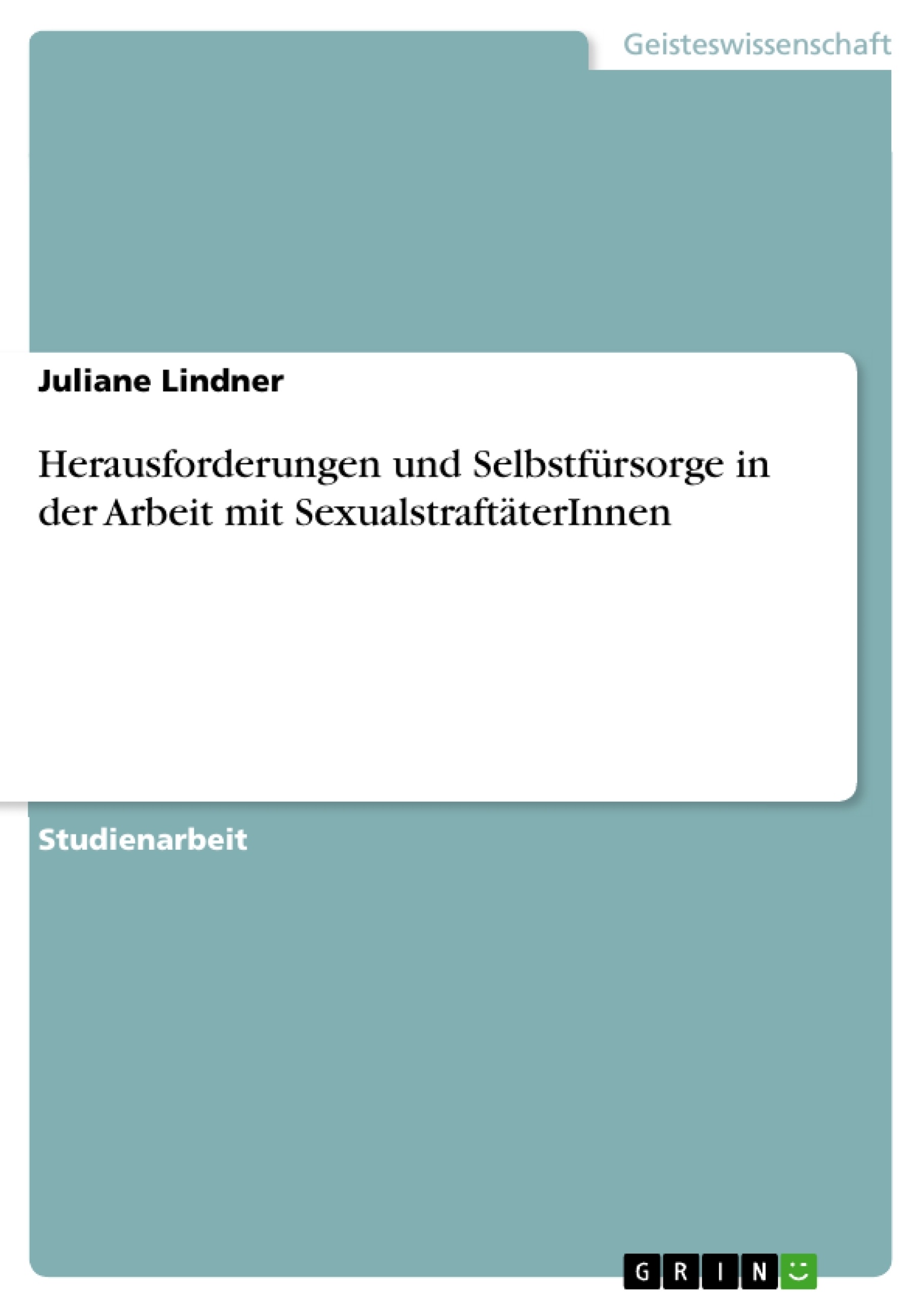Diese Hausarbeit befasst sich mit der Arbeit mit SexualstraftäterInnen und den damit einhergehenden Herausforderungen. Im ersten Teil wird der gesellschaftliche Blick auf die TäterInnen beleuchtet, ein Überblick über Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gegeben und die Frage beantwortet, welche Argumente es gibt, TäterInnen zu behandeln. Daraufhin wird der Fokus gesetzt auf die Art der Arbeit mit diesem Klientel, auf Herausforderungen im direkten Umgang und Widrigkeiten auf institutioneller oder politischer Ebene. Im dritten Teil werden Forderungen beschrieben, die sich aus dem Berufsfeld von BewährungshelferInnen und SozialarbeiterInnen, die mit SexualstraftäterInnen arbeiten, ergeben. Außerdem wird aufgezeigt, welche Haltung hilfreich im Umgang mit TäterInnen ist und was weiterhin zur Gesunderhaltung von Fachkräften in diesem Bereich beitragen kann. Zuletzt folgt eine Zusammenfassung der Rechercheergebnisse.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Annäherung an das Thema Sexualstraftaten
1.1 Gesellschaftlicher Blick auf die TäterInnen
1.2 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
1.3 Behandlung vs. Verwahrung
2 Herausforderungen in der Arbeit mit TäterInnen
2.1 Zahlen und Art der Behandlung
2.2 Herausforderungen im Umgang mit dem Klientel
2.3 Herausforderungen auf institutioneller Ebene
3 Selbstfürsorge in der Arbeit mit SexualstraftäterInnen
4 Fazit
Literaturverzeichnis
Einleitung
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Arbeit mit SexualstraftäterInnen und den damit einhergehenden Herausforderungen. Im ersten Teil wird der gesellschaftliche Blick auf die TäterInnen beleuchtet, ein Überblick über Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe- stimmung gegeben und die Frage beantwortet, welche Argumente es gibt, TäterInnen zu behandeln. Daraufhin wird der Fokus gesetzt auf die Art der Arbeit mit diesem Klientel, auf Herausforderungen im direkten Umgang und Widrigkeiten auf institutioneller oder politischer Ebene. Im dritten Teil werden Forderungen beschrieben, die sich aus dem Berufsfeld von BewährungshelferInnen und SozialarbeiterInnen, die mit Sexualstraftä- terInnen arbeiten, ergeben. Außerdem wird aufgezeigt, welche Haltung hilfreich im Um- gang mit TäterInnen ist und was weiterhin zur Gesunderhaltung von Fachkräften in die- sem Bereich beitragen kann. Zuletzt folgt eine Zusammenfassung der Rechercheergeb- nisse.
1 Annäherung an das Thema Sexualstraftaten
1.1 Gesellschaftlicher Blick auf die TäterInnen
Befasst man sich mit dem Thema sexueller Straftaten und richtet den Blick auf die Täte- rInnen, so kommt man nicht umhin, das Bild, das unsere Gesellschaft zeichnet, wahrzu- nehmen. PolitikerInnen besitzen oft die Gabe, Meinungen, die unter dem Volk kursie- ren, öffentlich auszudrücken. So hat 2001 der damalige Bundeskanzler Gerhard Schrö- der in einem Interview ausgedrückt, was vermutlich viele Menschen denken:
„Was […] die Behandlung von Sexualstraftätern betrifft, komme ich mehr und mehr zu der Auffassung, dass erwachsene Männer, die sich an kleinen Mädchen vergehen, nicht therapierbar sind. Deswegen kann es da nur eine Lösung geben: wegschließen - und zwar für immer!“ (Seifert 2013, S. 62, zit. n. Bild am Sonntag, 8.7.2001)
In Anbetracht der von Straftaten ausgehenden Bedrohung und des hohen Wertes sexuel- ler Selbstbestimmung in unserer Gesellschaft, erhalte die sogenannte ‚Sex-and-Crime- Berichterstattung‘ ein enormes und andauerndes öffentliches Interesse (vgl. Seifert 2013, S. 68). Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die durch die Medien be- kannt würden, seien folglich begleitet von „einem allgemeinen Volkszorn und gesamt- gesellschaftlichen Strafphantasien“ (Seifert 2013, S.68, zit. n. Schetsche 1996, S. 145). Auch die Formulierung „‚Progromstimmung‘ gegen Sexualstraftäter“ (Seifert 2013, S.70) unterstreicht diese Betrachtung. Die meist männlichen Täter erhielten Titel wie ‚Sextäter‘, ‚Sexmonster‘ und ‚Kinderschänder‘ und würden mit etwas dämonenhaftem Bösen assoziiert, das keineswegs behandelbar sei (vgl. Seifert 2013, S. 69). Für den se- xuellen Missbrauch von Kindern z. B. würde laut öffentlicher Meinung lebenslanger Freiheitsentzug als adäquat betrachtet (vgl. Seifert 2013, S. 69). Man solle die TäterIn- nen „Einsperren - Schlüssel wegwerfen - nie mehr rauslassen“ (Gauer 2005, S. 55). Diese gesellschaftlich sehr homogene Bewertung von SexualstraftäterInnen legt die Vorstellung nahe, dass es kaum jemanden geben kann, der bereit wäre, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Es sei hier vorweggenommen, dass es natürlich Sozial- arbeiterInnen im Strafvollzug, der Sozialtherapie und der Bewährungshilfe sowie PsychologInnen gibt, die sich mit TäterInnen befassen. Zunächst einmal wird aber die Frage beantwortet, worum es überhaupt geht, wenn von sexuellem Missbrauch die Rede ist.
1.2 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
Die Formulierung „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ entstammt dem 13. Abschnitt des StGB (§§ 174ff.), der die jeweiligen Verstöße gegen das Rechtsgut der se- xuellen Selbstbestimmung aufführt. Dieses Rechtsgut wird aus dem Schutz der Men- schenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) und der Freiheit vor sexueller Fremdbestimmung (Art. 2 Abs. 1 GG) abgeleitet (vgl. Seifert 2013, S. 77ff). Die beschriebenen Tatbestände erstre- cken sich von von sexueller Nötigung, Vergewaltigung, der Variante dieser beiden Tat- bestände mit Todesfolge über den sexuellen Missbrauch widerstandsunfähiger, kranker oder hilfsbedürftiger Personen bis hin zum sexuellen Missbrauch unter Ausnutzung ei- nes Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses. Hinter diesen Oberbegrif- fen verbergen sich vielfältige „sexuelle Perversionen, ‚hands-off‘- und ‚hands-on‘-De- likte, Taten mit oder ohne vaginaler, oraler und analer Penetration“ (Seifert 2013, S. 78). Es gebe TäterInnen, die sich entweder nur auf Jungen, nur auf Mädchen oder auf beide ausrichten. Missbrauchshandlungen fänden innerhalb und außerhalb von Familiengefü- gen statt. TäterInnen hätten entweder tatsächliches Interesse am Kind oder suchten Er- satz für eine nicht vorhandene Beziehung zu einem (gleichaltrigen) Partner. Variationen gebe es auch in der Anwendung körperlicher Gewalt, die auf die Befriedigung sexueller Lust oder auf Demütigung abziele. Weitere variierende Aspekte seien der Grad der (Un-)Bekanntschaft zwischen TäterIn und Opfer, Anzahl der TäterInnen und Opfer, das Alter der Opfer, die vielfältigen Tatsituationen und -muster sowie die unterschiedlichen Biographien und Persönlichkeitsmerkmale der TäterInnen (vgl. Seifert 2013, S. 78ff.). Stellt man sich vor, was es im Einzelnen für die Opfer bedeutet, wenn ihnen so etwas angetan wird, lassen diese Aufzählungen die eingangs erwähnten Forderungen nach dem lebenslangen Wegsperren von TäterInnen sehr menschlich erscheinen. Gleichzeitig wird die Frage aufgeworfen, ob es damit getan sei, TäterInnen nur wegzusperren bzw. welche Gründe für eine Behandlung von TäterInnen und somit für den Einsatz von Per- sonal in diesem Arbeitsbereich sprechen.
1.3 Behandlung vs. Verwahrung
Auf die 2001 getätigte Aussage Gerhard Schröders folgte wenige Tage später eine scharfe Kritik (nicht nur) vonseiten Gießener Kriminalwissenschaftler. Sie rieten ihm, die kriminalpräventive Arbeit eher zu verstärken und Haft- und Behandlungsbedingun- gen zu verbessern, um dem Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft nachzukommen (vgl. Spiegel Online, zugegriffen am 28.10.2017). Es sei hier erwähnt, dass Sexualstraftäte- rInnen nur in Einzelfällen ‚für immer‘ weggesperrt werden können und nur ein Teil der TäterInnen überhaupt dem Strafvollzug zugeführt wird, wobei dann aber „möglichst lange Inhaftierungen“ (Seifert 2013, S. 64) angestrebt würden. Seit 2003 gebe es zudem eine Therapiepflicht für SexualstraftäterInnen, die mit dem „politischen Ziel eines ver- besserten bzw. nachhaltigen Schutzes der Bevölkerung vor rückfälligen Sexualstraftä- tern begründet“ (Seifert 2013, S. 72) wurde. Erst wenn es keine Gefahr eines Rückfalls mehr gebe, sollten die Delinquenten aus dem Strafvollzug entlassen werden können (vgl. Seifert 2013, S. 64). Laut § 2 Satz 2 StVollzG soll der bzw. die Gefangene im Voll- zug der Freiheitsstrafe befähigt werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Des Weiteren diene Resozialisierung dem Schutz der Ge- meinschaft, da diese das größte Interesse daran habe, dass es zu keinem Rückfall käme (vgl. Seifert 2013, S. 126). An anderer Stelle heißt es:
„Ein Gewalttäter ist sein Gewaltproblem durch die Inhaftierung nicht automatisch los, sondern erst durch die Absolvierung einer entsprechenden Behandlungsmaßnahme. Da- mit werden zukünftige Opfer vermieden, und somit leisten diese Behandlungsangebote einen bedeutenden Beitrag zum Opferschutz. Behandlung von Straftätern ist Opfer- schutz […] und damit eine Präventionsmaßnahme!“ (Gauer 2005, S. 54 u. 64)
Ein effektives Resozialisierungskonzept und einen darauf aufgebauten Strafvollzug zu entwickeln sei unabdingbar, weil selbst lebenslänglich und sicherungsverwahrte Straftä- ter durch Grundgesetz und humanitäre Einstellung des Sozialstaats einen Anspruch ha- ben, ihre „Freiheit wiedererlangen zu können“ (Seifert 2013, S. 126). Die Arbeitsge- meinschaft Bayerischer BewährungshelferInnen (ABB) beruft sich auf Untersuchungen, die ergaben, dass 50 % der SexualstraftäterInnen, die ohne Behandlung entlassen wur- den, rückfällig geworden seien. Hingegen seien auf der Seite der SexualstraftäterInnen, die eine Behandlung durchlaufen haben, nur 25 % rückfällig geworden. Diesen Unter- schied erkläre sich die ABB z. B. aufgrund in der Behandlung neu erlernter Konfliktlö- sungsmechanismen (vgl. ABB, zugegriffen am 28.10.2017). Die Frage nach Gründen für die Behandlung von SexualstraftäterInnen ist mit der Tatsache der Wiederentlassung nach relativ kurzer Zeit und der erneuten Begegnung von TäterIn und Gesellschaft be- antwortet. Es steht also fest, dass SexualstraftäterInnen behandelt werden müssen. Wie sich diese ‚Behandlung‘ gestaltet und welche Herausforderungen sie mit sich bringt, be- handelt das nächste Kapitel.
2 Herausforderungen in der Arbeit mit TäterInnen
2.1 Zahlen und Art der Behandlung
Im Jahre 2010 seien ca. 47.000 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung regis- triert worden. Dabei seien mit ca. 29 % Vergewaltigung bzw. sexuelle Nötigung und mit ca. 27 % der sexuelle Missbrauch von Kindern die häufigsten Sexualstraftaten (vgl. Sei- fert 2013, S. 81-82, zit. n. PKS 2010, S. 34). Nur ein sehr geringer Prozentsatz von Ver- gewaltigungen werde geahndet, ein erheblicher Anteil von Sexualdelinquenz bliebe ent- weder unentdeckt oder werde ohne Einbezug der Strafjustiz gelöst (vgl. Seifert 2013, S. 93). Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Deutscher BewährungshelferInnen (ADB) arbeiten derzeit ungefähr 2500 hauptamtliche BewährungshelferInnen mit ca. 170.000 straffällig gewordenen Menschen (vgl. ADB, zugegriffen am 25.11.2017). Die Arbeits- gemeinschaft Bayerischer BewährungshelferInnen (ABB) gibt an, dass ca. 5 % der deutschlandweit in der Bewährungshilfe betreuten KlientInnen aufgrund von Sexual- straftaten verurteilt worden seien. Rechnet man dies um, so kommt man auf bundesweit 8500 SexualstraftäterInnen in der Bewährungshilfe. Eingesetzt werden SozialarbeiterIn- nen z. B. in der Bewährungshilfe und in der Sozialtherapie (vgl. Seifert 2013, S. 128), wo sie (und andere Professionen) die ‚Behandlung‘ von StraftäterInnen vollziehen kön- nen. Was mit ‚Behandlung‘ gemeint ist, sei vom Gesetzgeber nicht genau definiert. Es lasse sich darunter allerdings verstehen, dass explizit therapeutische Behandlungen so- wie allgemeinere Maßnahmen gemeint seien, die den Delinquenten ein Leben ohne Ver- stöße gegen das Gesetz ermöglichten. Genauer könne unter den ‚allgemeinen Maßnah- men‘ Ausbildung, Unterricht, Unterstützung bei finanziellen Problemen, Suchtberatung, Anti-Gewalt-Maßnahmen und Soziales Training verstanden werden (vgl. Seifert 2013, S. 127 u. 129, Gauer 2005, S. 63). Welche Herausforderungen in diesen Arbeitsbereichen auf SozialarbeiterInnen und auch PsychologInnen zukommen, behandelt der nächste Abschnitt.
2.2 Herausforderungen im Umgang mit dem Klientel
Eine in Sachsen durchgeführte Evaluationsstudie, in deren Rahmen Interviews mit 13 BewährungshelferInnen geführt und Akten von SexualstraftäterInnen analysiert wurden, ergab, dass Herausforderungen in dieser Arbeit in zwei Bereichen zu finden seien: im direkten Umgang mit den TäterInnen und in den Umständen, unter denen diese Arbeit stattfinde (vgl. Klug/Niebauer 2016, S. 343 ff.). Befassen wir uns zunächst mit dem di- rekten Umgang mit den TäterInnen. Es werde als schwierig empfunden, Gespräche über die Straftaten und sexuelle Fantasien zu führen, da es sich dabei um ein sehr intimes Thema handle, das Vertrauen in den bzw. die SozialarbeiterIn verlange sowie den Mut, es anzusprechen. Des Weiteren seien die kognitiven Verzerrungen (Bagatellisierung, Verleugnung) genannt, die bei SexualstraftäterInnen häufig vorliegen. SozialarbeiterIn- nen in der Bewährungshilfe wüssten häufig nicht, wie diesen zu begegnen sei und ver- suchten sich mit Konfrontation oder Reflektion, was aber oft nicht zur Einsicht beitrüge, so dass der Wunsch entstünde, die KlientInnen aufgrund von professioneller Überforde- rung zu besser ausgebildeten TherapeutInnen zu schicken. Speziell für Sexualstraftäte- rInnen ließen sich weitere als belastend wahrgenommene ‚hard-to-reach-Merkmale‘ feststellen: neben den schon angerissenen kognitiven Defiziten, mangelndem Problem- bewusstsein und fehlender Einsicht, hätten BewährungshelferInnen mit „Hohe[n] Abbruchraten von Therapie- und Hilfemaßnahmen“ (Klug/Niebauer 2016, S. 352) und „herausfordernde[r] Beziehungsgestaltung, häufig aufgrund dissozialer Persönlichkeits- störungen“ (Klug/Niebauer 2016, S. 353) umzugehen. Folgen für BewährungshelferIn- nen seien Entmutigung, innerer Widerstand, Pessimismus und Unsicherheit. Auch im Positionsblatt der ABB wird beschrieben, dass regelmäßig Grenzen „persönlicher, menschlicher und sozialpädagogischer Möglichkeiten“ (ABB, zugegriffen am 28.10.2017) erreicht würden und Straftat, Empathie für das Opfer sowie eigene Befan- genheit, Missbehagen und Ängste die TäterInnenarbeit beeinträchtigten (vgl. ABB, zu- gegriffen am 28.10.2017). Ein weiterer Autor berichtet von ihm entgegengebrachten Abwertungen und Aggressionen, mit denen man umzugehen wissen müsse (vgl. Sellin- ger 2005, S. 83). Neben diesen grundlegenden Schwierigkeiten im Umgang mit den Tä- terInnen gibt es weitere Schwierigkeiten, die sich auf institutioneller und politischer Ebene zeigen.
2.3 Herausforderungen auf institutioneller Ebene
Eine beispielhafte Umfrage unter 90 TherapeutInnen eines bayrischen Landkreises zeig- te, dass nur eine Person bereit sei, uneingeschränkt therapeutisch mit SexualstraftäterIn- nen zu arbeiten, 19 TherapeutInnen nur Teilbereiche bejaht und 33 Personen strikt die Zusammenarbeit mit SexualstraftäterInnen abgelehnt hätten (vgl. ABB, zugegriffen am 28.10.2017). Gleichzeitig werde die „Notwendigkeit für fachärztliche und psychothera- peutische Begleitung […] von den Fachkräften bei Sexualstraftätern weithin als hoch eingeschätzt“ (Klug/Niebauer 2016, S. 345) und die psychiatrische Versorgung als großer Mangel empfunden (vgl. Klug/Niebauer 2016, S. 345). Ein Bewährungshelfer beschrieb, dass ein Klient eine Sexualtherapie benötigt hätte, der Therapeut aber wegen der kognitiven Verzerrungen, die eine Zusammenarbeit unmöglich machten, ablehnte und der Helfer so vor einem Dilemma stünde (vgl. Klug/Niebauer 2016, S. 347). Weite- re Einschränkungen ergäben sich aus mangelnden Eingangsuntersuchungen und Voll- zugsplanungen, unzureichend geplanten organisatorischen Abläufen in den JVAs, Man- gel an Personal und Einsparungen finanzieller Art (vgl. Seifert 2013, S. 128f.). Auch von politischer Seite fehle es an Unterstützung, da wiederholt Resozialisierungsmaßnah- men abgewertet und Wegsperren als politisch am einfachsten zu vertretende Forderung konstatiert würden (vgl. Seifert 2013, S. 130). Die Betreuungsintensität von ca. 100 StraftäterInnen pro BewährungshelferIn trage außerdem dazu bei, dass eine qualitativ hochwertige Arbeitsweise nicht gewährleistet werden könne (vgl. Sellinger 2005, S. 104) und die „Bewährungshilfe chronisch überlastet sei“ (Sellinger 2005, S. 87). In fo- rensischen Kliniken komme es hinzu, dass SozialarbeiterInnen zwischen den verschie- denen Berufsgruppen stünden und der Sozialarbeit dadurch „wenig zugetraut oder sie von anderen abgewertet wird“ (Gorynia 2005, S. 10). Die Zusammenarbeit mit Kolle- gInnen im Strafvollzug sei zudem sehr energieraubend und es mangele am gegenseiti- gen Respekt vor jeder Fachrichtung, was einer konstruktiven Arbeit mit den Inhaftierten im Wege stünde (vgl. Gauer 2005, S. 62). Es wird deutlich, dass Fachkräfte in der Ar- beit mit SexualstraftäterInnen mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert sind. Das nächste Kapitel beschreibt, wie diese Fachkräfte auf der einen Seite in ihrer Profession und auf der anderen Seite als Einzelpersonen im Sinne der Selbstfürsorge mit den ge- nannten Hindernissen umgehen können.
3 Selbstfürsorge in der Arbeit mit SexualstraftäterInnen
Mit Blick auf Lösungsansätze, die die politische oder institutionelle Ebene betreffen, stößt man schnell auf Forderungen nach einer bedeutenden Veränderung der Arbeitsbe- dingungen in der Bewährungshilfe (vgl. Sellinger 2005, S. 85ff.). Damit seien die starke Verringerung von Fallzahlen, Supervision und Fortbildungen gemeint. Außerdem könne es helfen, die Entlassvorbereitung besser mit der Bewährungshilfe abzusprechen, Auf- lagen realistischer zu gestalten, der Bewährungshilfe mehr Entscheidungskompetenz zu- zugestehen und mit allen am Verfahren beteiligten Institutionen vernetzt zu arbeiten. Auch die ABB fordert in ihrem Positionsblatt eine intensivere Vernetzung, ein „größere[s] Maß an kompetenten, praxisorientierten Fortbildungen“ (ABB, zugegriffen am 28.10.2017), einen Ausbau der Bewährungshilfe und mehr TherapeutInnen, die be- reit seien, mit SexualstraftäterInnen zu arbeiten (vgl. ABB, zugegriffen am 28.10.2017). Im direkten Umgang mit den KlientInnen der Bewährungshilfe oder (noch) inhaftierten TäterInnen gibt es weitere Möglichkeiten, den im vorigen Teil erwähnten Herausforde- rungen zu begegnen. Es sei wichtig, sich sicher zu sein, dass „Gefühle wie Abscheu, Entsetzen u. Ä. […] der Tat, nicht aber dem Menschen“ (Sellinger 2005, S. 91) entge- gengebracht würden. Als Person, die mit diesem Klientel arbeitet, müsse man die schwere Realität des Täters oder der Täterin ertragen, ohne ihn oder sie zu verurteilen (vgl. Sellinger 2005, S. 92, zit. n. Stiels-Glenn 2003/05, S. 74). Die Grundlage dafür, sich in der Arbeit sicher zu fühlen, sei es, achtsam mit den eigenen Grenzen umzugehen, sowohl auf Fähigkeiten, Wirksamkeit der Arbeit als auch das Maß der Belastung bezo- gen, und in Kauf zu nehmen, dass es dadurch zu Konflikten kommen könne (vgl. Sellin- ger 2005, S. 99f.). Bei verbal-aggressiven Anfeindungen oder in der Fachkraft entste- henden Ängsten gelte es herauszufinden, ob eine tatsächliche Gefahr von dem Klienten oder der Klientin ausginge und angemessen zu reagieren. Bestünde keine Gefahr, so sei es ratsam, sich mit den durch die Aggression ausgedrückten Informationen auseinander- zusetzen und eine Meta-Ebene einzunehmen. Oft offenbare sich durch empfundene Angst in der Fachkraft ein Beziehungsmuster, das der Klient oder die Klientin reprodu- ziere. Diesen psychologischen Vorgang nennt man Gegenübertragung. In solchen Situa- tionen sei es hilfreich, diese Erkenntnisse den KlientInnen zur Verfügung zu stellen und darüber ins Gespräch zu kommen (vgl. Sellinger 2005, S. 102). Würde man diese Emp- findungen nicht ernst nehmen oder ausreichend reflektieren, liefe man Gefahr, sich „un- reflektiert in der Gegenübertragung zu ‚verhaken‘“ (Sellinger 2005, S. 83). Des Weiteren beschreibt Poulsen, die sich im Rahmen eines Forschungsprojekt mit dem Thema Selbstfürsorge für Fachkräfte der Sozialen Arbeit beschäftigte, einige Punkte, die zur Prävention von Burnout-Symptomatiken beitrügen (vgl. Poulsen 2009). Sie empfiehlt „Selbsterkenntnis - Bewusstsein - innere Klarheit“ (Poulsen 2009, S. 109) und meint damit ein Bewusstsein über eigene Belastungsgrenzen zu entwickeln, sie äu- ßern zu können, die eigene Intuition ernstzunehmen und Gefühle wahrzunehmen. Auch ein Bekanntenkreis, der nichts mit der eigenen Profession zu tun habe, das Pflegen so- zialer Beziehungen, ein klares Trennen von Beruf und Privatleben und „keine Sozialar- beit in der Freizeit“ (Poulsen 2009, S. 111) zu verrichten, seien wichtig für die Gesun- derhaltung. Des Weiteren seien Bewegung an der frischen Luft, Zufriedenheit auslösen- de Hobbys und Erfolgserlebnisse außerhalb der Arbeit bedeutend. Im Arbeitsalltag sei es förderlich, zwar einen guten Kontakt zu KollegInnen zu pflegen, sie aber nicht ins Privatleben zu übernehmen. „Supervision, Teamgespräche, kollegiale Beratung, Refle- xion“ (Poulsen 2009, S. 110) und Fortbildungen, die immer wieder stattfinden, wurden auch von Poulsen als gesund erhaltende Faktoren ermittelt. Nicht zuletzt sei es sehr wertvoll, wenn die Träger den Angestellten gegenüber mehr Wertschätzung für ihre Ar- beit entgegenbrächten (vgl. Poulsen 2009, S. 98), aber auch Selbstwertschätzung der ei- genen Arbeit mache das Arbeiten deutlich angenehmer (vgl. Poulsen 2009, S. 111).
4 Fazit
Das Spektrum von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ist groß und lässt ge- sellschaftliche Forderungen wie ‚Wegsperren für immer‘ im Umgang mit Sexualstraftä- terInnen und Zuschreibungen wie ‚Sexmonster‘ oder ‚Kinderschänder‘ menschlich er- scheinen. Doch vor allem der Leitspruch ‚Täterarbeit ist Opferschutz‘ weist darauf hin, dass SexualstraftäterInnen nur selten für immer weggesperrt werden können und viele gar nicht dem Strafvollzug zugeführt werden. Das bedeutet, dass diese Menschen früher oder später wieder mit der Gesellschaft in Kontakt treten und sich so die Frage nach der Rückfallgefährdung stellt. Studien haben gezeigt, dass nur 25 % der TäterInnen, die eine ‚Behandlung‘ erhielten, rückfällig wurden. Unbehandelte TäterInnen hingegen wurden zu 50 % rückfällig. Es gibt schätzungsweise 8500 SexualstraftäterInnen in der gesamt- deutschen Bewährungshilfe, die von SozialarbeiterInnen begleitet und z. B. zu den The- men Finanzen, Sucht, Gewalt und Bildung beraten werden. In der direkten Arbeit sind sie mit starken kognitiven Verzerrungen, hohen Abbruchraten von Maßnahmen, disso- zialen Persönlichkeitsstörungen und teilweise Aggressionen konfrontiert, so dass regel- mäßig Grenzen persönlicher und professioneller Möglichkeiten erreicht werden. Nicht zu unterschätzen sind auch Missbehagen oder Ängste gegenüber TäterInnen. Auf politischer Ebene wird die Arbeit z. B. erschwert durch Mangel an Finanzen, an Perso- nal, an psychiatrischer Versorgung, unzureichende Zusammenarbeit zwischen den Pro- fessionen und zu hohe Fallzahlen. Als Resultat ergeben sich Forderungen nach Fortbil- dungen, Reduzierung der Fallzahlen, Vernetzung und Supervision. Auf individueller Ebene ist es hilfreich, eine dem Menschen aufgeschlossene und nur die Tat verurteilen- de Haltung einzunehmen, Gegenübertragungsprozesse im Blick zu behalten und oft eine Meta-Ebene einzunehmen. Nicht zuletzt ist es sinnvoll, sich mit Selbstfürsorge und ge- sund erhaltendem Verhalten auseinanderzusetzen: z. B. die eigenen Grenzen kennen und äußern, der Intuition vertrauen, sich einen Freundeskreis bewahren, der nichts mit dem Beruf zu tun hat, die eigene Arbeit selbst wertschätzen lernen, gute Beziehungen zu den KollegInnen pflegen und bei Schwierigkeiten um Unterstützung bitten. Überraschend war, dass in der gefundenen Literatur weniger die Schwierigkeiten im direkten Umgang mit SexualstraftäterInnen und mehr die Widrigkeiten, die sich auf institutioneller Ebene zeigen, betont werden. Das lässt vermuten, dass SozialarbeiterInnen, die mit (Sexual-)StraftäterInnen arbeiten, bewusst ihren Arbeitsbereich und die damit verbunde- nen Herausforderungen mit dem Klientel, gewählt und akzeptiert haben.
Literaturverzeichnis
Arbeitsgemeinschaft Bayrischer Bewährungshelfer (ABB): Arbeit mit Sexualstraft ä tern in der Bew ä hrungshilfe [PDF Datei]. Verfügbar unter www.bewaehrungshilfe- bayern.de/sexual.pdf.
Gauer, Doris: Sozialarbeit im Strafvollzug : Profession im Schatten der Gitterstäbe. In: Forensische Psychiatrie und Psychotherapie, 2005 (3), S. 49-64.
Gorynia, Michaela: Sozialarbeit in der Forensik : Was ist sie, was kann sie und was könnte sie sein? In: Forensische Psychiatrie und Psychotherapie, 2005 (3), S. 9- 22.
Klug, Wolfgang/Niebauer, Daniel: Sozialarbeiterisches Handeln mit Sexualstraftätern im Rahmen der Bewährungshilfe. In: Forensische Psychiatrie und Psychothera- pie, 2016 (3), S. 336-356.
Poulsen, Irmhild (2009): Burnoutpr ä vention im Berufsfeld Soziale Arbeit : Perspektiven zur Selbstf ü rsorge von Fachkr ä ften. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaf- ten.
Seifert, Simone (2013): Der Umgang mit Sexualstraft ä tern : Bearbeitung eines sozialen Problems im Strafvollzug und Reflexion gesellschaftlicher Erwartungen. Wiesba- den: Springer VS. [E-Book]. Verfügbar unter link.springer.com/book/10.1007%2 F978-3-658-05705-3.
Sellinger, Lukas: Anders als andere?! : Arbeit mit forensischen Probanden. In: Forensi- sche Psychiatrie und Psychotherapie, 2005 (3), S. 81-106.
www.bewaehrungshilfe.de/?page_id=109 (ADB) [27.11.2017]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Hausarbeit zum Thema Sexualstraftaten?
Die Hausarbeit befasst sich mit der Arbeit mit SexualstraftäterInnen und den damit einhergehenden Herausforderungen. Sie beleuchtet den gesellschaftlichen Blick auf die TäterInnen, gibt einen Überblick über Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und argumentiert für die Behandlung von TäterInnen. Der Fokus liegt auf der Art der Arbeit mit diesem Klientel, auf Herausforderungen im direkten Umgang und auf institutionellen Widrigkeiten. Abschließend werden Anforderungen an BewährungshelferInnen und SozialarbeiterInnen, die mit SexualstraftäterInnen arbeiten, sowie hilfreiche Haltungen und Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Fachkräfte in diesem Bereich beschrieben.
Wie wird die gesellschaftliche Wahrnehmung von SexualstraftäterInnen beschrieben?
Die Gesellschaft neigt dazu, SexualstraftäterInnen als nicht therapierbar und gefährlich einzustufen. Begriffe wie 'Sextäter', 'Sexmonster' und 'Kinderschänder' werden verwendet, und lebenslange Freiheitsentziehung wird oft als angemessene Strafe angesehen.
Welche Straftaten fallen unter den Begriff "Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung"?
Dieser Begriff umfasst sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch widerstandsunfähiger, kranker oder hilfsbedürftiger Personen sowie sexuellen Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses.
Warum wird die Behandlung von SexualstraftäterInnen befürwortet anstatt reiner Verwahrung?
Die Behandlung wird befürwortet, da SexualstraftäterInnen in den meisten Fällen nach einer gewissen Zeit wieder in die Gesellschaft entlassen werden. Die Resozialisierung soll dazu beitragen, dass es nicht zu einem Rückfall kommt und somit die Gesellschaft geschützt wird. Studien deuten darauf hin, dass behandelte TäterInnen seltener rückfällig werden als unbehandelte.
Welche Herausforderungen gibt es in der Arbeit mit SexualstraftäterInnen?
Zu den Herausforderungen gehören Gespräche über intime Themen, kognitive Verzerrungen (Bagatellisierung, Verleugnung) bei den Tätern, hohe Abbruchraten von Therapie- und Hilfemaßnahmen, schwierige Beziehungsgestaltung aufgrund dissozialer Persönlichkeitsstörungen sowie persönliche Betroffenheit, Missbehagen und Ängste bei den Fachkräften.
Welche institutionellen Herausforderungen gibt es in diesem Arbeitsfeld?
Zu den institutionellen Herausforderungen zählen mangelnde Bereitschaft von TherapeutInnen zur Zusammenarbeit, fehlende psychiatrische Versorgung, unzureichende Eingangsuntersuchungen und Vollzugsplanungen, Personalmangel, finanzielle Einsparungen, fehlende politische Unterstützung und eine hohe Betreuungsintensität.
Wie können Fachkräfte im Bereich der Arbeit mit SexualstraftäterInnen Selbstfürsorge betreiben?
Selbstfürsorge umfasst die Reduzierung von Fallzahlen, Supervision und Fortbildungen, die Förderung des Austauschs mit anderen Institutionen, das Akzeptieren und Verurteilen der Tat (aber nicht der Person), das Achten auf die eigenen Grenzen, die Reflexion von Gegenübertragungsprozessen, sowie die Prävention von Burnout-Symptomen durch Selbstwahrnehmung, soziale Beziehungen, klare Trennung von Beruf und Privatleben, Bewegung, Hobbys und Wertschätzung der eigenen Arbeit.
- Quote paper
- Juliane Lindner (Author), 2017, Herausforderungen und Selbstfürsorge in der Arbeit mit SexualstraftäterInnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/421556