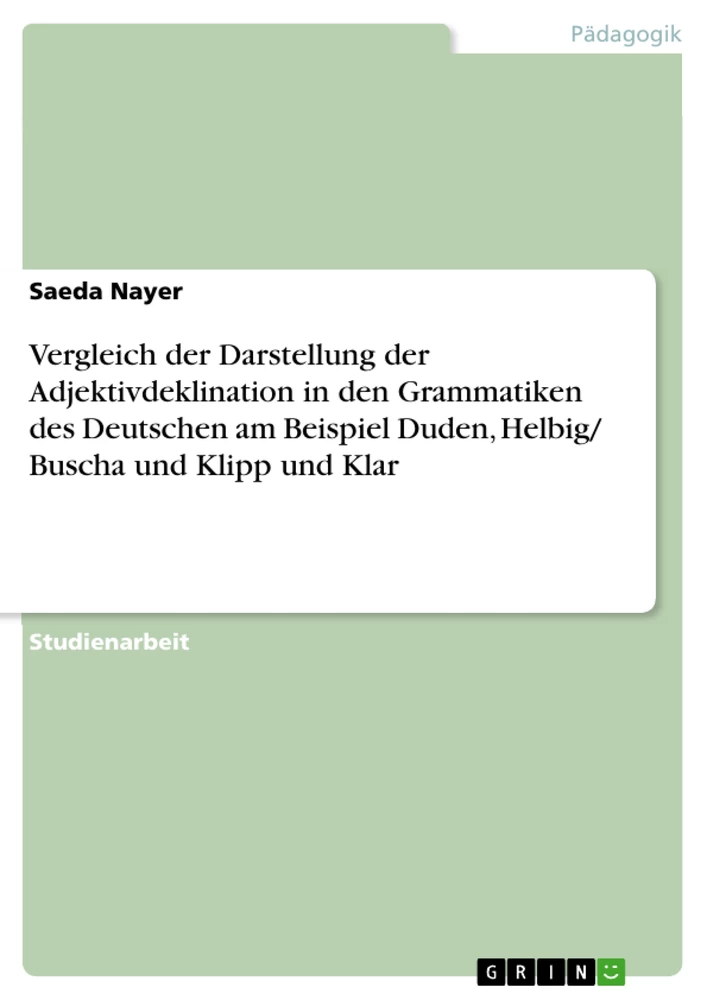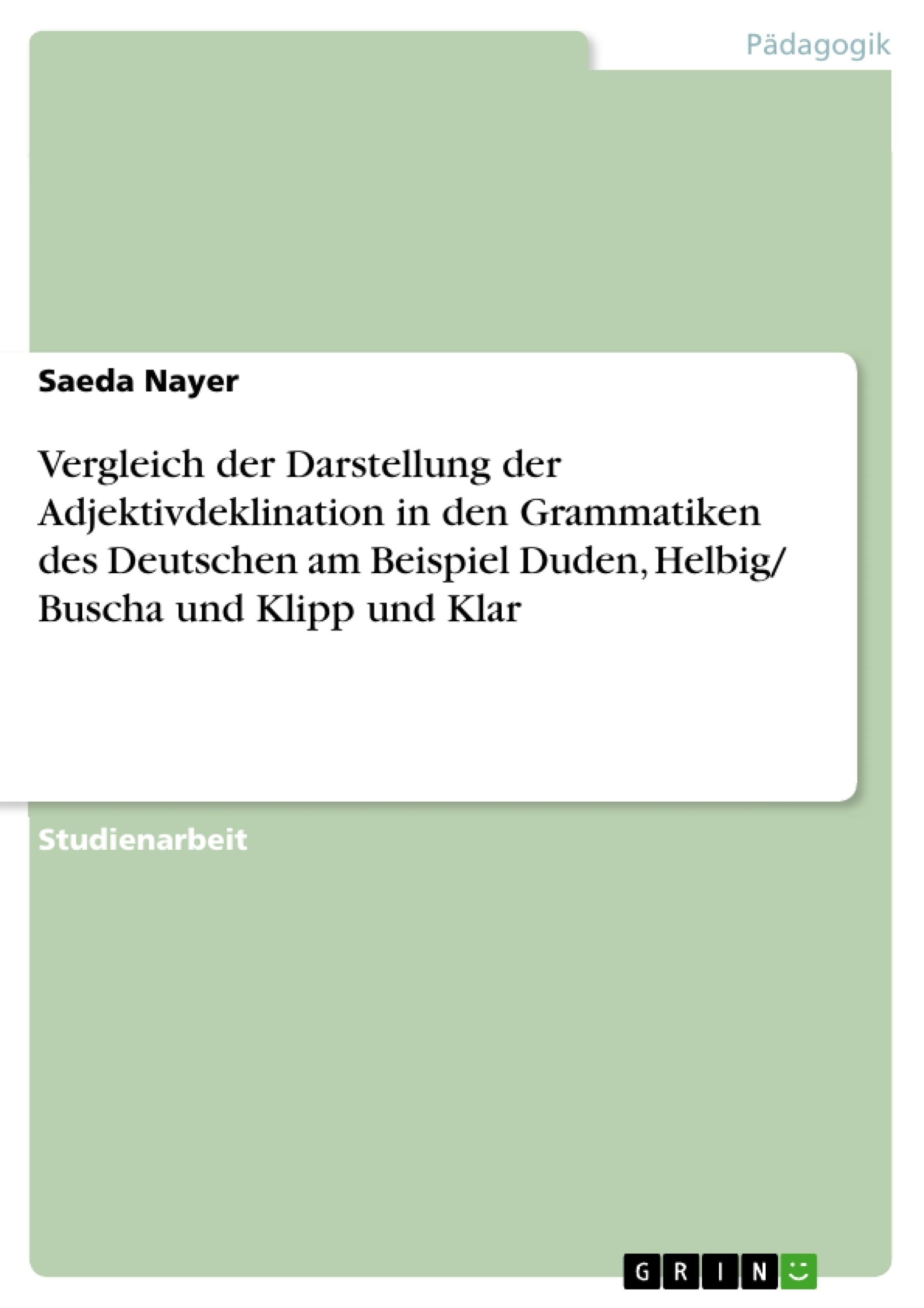Das Grammatikphänomen „Adjektivdeklination“ ist nach wie vor eines der höchstempfindlichsten Probleme im Fremdsprachenunterricht des Deutschen. Aus eigener Erfahrung kann festgestellt werden, dass dieses Phänomen viele Lehr- und Lernschwierigkeiten beim Fremdsprachenunterricht des Deutschen in der Türkei mit sich bringt. Wenn die Deutschlernenden erstmals mit der Adjektivdeklination im DaF-Unterricht konfrontiert werden, verlieren sie ihre Motivation und bilden Voreingenommenheit zu diesem höchstempfindlichsten Grammatikkapitel. Auch für die Lehrenden ist es verwirrend, dieses Phänomen in der Unterrichtseinheit effektiv behandeln zu müssen, um das Interesse der DaF-Lerner zu wecken. Bei der Unterrichtsvorbereitung spielt die Auswahl der Grammatik eine ausschlaggebende Rolle. Eine eindeutige Darstellung der Adjektivdeklination ist in den Grammatiken kaum zu finden. Da in den Grammatiken immer mehrere Deklinationstypen auftauchen, sind die Auswahlkriterien des Lehrers bei den Deklinationstypen meistens unklar. Weil die Grammatiken von verschiedenen Deklinationsparadigmen ausgehen, können die Deklinationsparadigmen bei der Vermittlung dieses Themas eine Vermischung verursachen. Aufgrund meiner gesammelten Erfahrungen aus beiden Perspektiven besteht auch mein Forschungsinteresse darin, herauszufinden, wie dieses Phänomen in den Grammatiken am Beispiel von Helbig/Buscha, Duden und Klipp und klar dargestellt wird, und welche potenzielle Probleme sich bei der Didaktisierung erkennen lassen. Die Analyse von vorhandenen Grammatiken und deren Vergleich ermöglicht die Darlegung der präferierten Darstellungsweisen der Adjektivdeklination und deren Vor- und Nachteile. Da diese Werke in der Regel als Grundsteine der deutschen Grammatik bezeichnet werden, kann eine solche Auseinandersetzung zusätzlich die potenziellen Probleme der Deutschlernenden bei der Beschäftigung mit der Adjektivdeklination in Erscheinung treten lassen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Beschreibung und Bewertung von Darstellungsweisen der Adjektivdeklination in ausgewählten Grammatiken zusammenzufassen. Als Basis dieser Auseinandersetzung dienen die drei Grammatiken, die sich als linguistische und didaktische Grammatiken abgrenzen lassen. Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile. Im ersten Teil werden die linguistische Einordnung, die Charakterisierung des Grammatikphänomens und die potenziellen Probleme mit der Didaktisierung sowie die möglichen Lernschwierigkeiten in Betracht gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Adjektivdeklination in linguistischer und didaktischer Hinsicht
- 2.1. Linguistische Einordnung und Charakterisierung der Adjektivdeklination
- 2.2. Potenzielle Probleme mit der Didaktisierung der Adjektivdeklination und mögliche Lernschwierigkeiten
- 3. Vergleich der Darstellung der Adjektivdeklination in den Grammatiken des Deutschen
- 3.1. Auswahl der Grammatiken und Hinweise zum Vergleich
- 3.2. Helbig/Buscha: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht
- 3.3. Dudengrammatik - Unentbehrlich für richtiges Deutsch
- 3.4. Fayndrch/Tallowitz: Klipp und Klar: Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch
- 3.5. Tabellarische Übersicht
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Adjektivdeklination in drei gängigen deutschen Grammatiken (Helbig/Buscha, Duden, Klipp und Klar) und analysiert potenzielle didaktische Herausforderungen. Das Ziel ist es, die verschiedenen Präsentationsweisen zu vergleichen und deren Vor- und Nachteile für den DaF-Unterricht zu bewerten.
- Vergleichende Analyse der Adjektivdeklinationsdarstellung in drei ausgewählten Grammatiken.
- Identifizierung linguistischer und didaktischer Unterschiede in der Präsentation.
- Bewertung der jeweiligen Stärken und Schwächen der Darstellungsweisen für Lerner.
- Analyse potenzieller Lernschwierigkeiten im Zusammenhang mit der Adjektivdeklination.
- Ausarbeitung von Empfehlungen für den DaF-Unterricht.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Adjektivdeklination im Deutschen als Fremdsprache ein und beschreibt die Herausforderungen, die diese für Lerner und Lehrende darstellt. Sie begründet die Notwendigkeit der Untersuchung anhand von Schwierigkeiten im DaF-Unterricht in der Türkei und der uneinheitlichen Darstellung in gängigen Grammatiken. Die Arbeit fokussiert auf den Vergleich dreier ausgewählter Grammatiken und deren didaktische Implikationen.
2. Adjektivdeklination in linguistischer und didaktischer Hinsicht: Dieses Kapitel bietet eine linguistische Einordnung und Charakterisierung der Adjektivdeklination. Es beleuchtet die historische Entwicklung der Diskussion um die Adjektivdeklination in der Linguistik und Didaktik, beleuchtet die attributive Funktion von Adjektiven und deren morphologische Eigenschaften (Deklination und Komparation). Ein wichtiger Aspekt ist die Analyse unterschiedlicher Reihenfolgen von Kasus und Genus in Grammatiken und Lehrwerken und deren didaktische Auswirkungen, dargestellt anhand von Beispielen und Tabellen. Die verschiedenen Ansätze werden kritisch beleuchtet und auf ihre didaktische Eignung hin untersucht.
Schlüsselwörter
Adjektivdeklination, Deutsch als Fremdsprache (DaF), Grammatikvergleich, Helbig/Buscha, Dudengrammatik, Klipp und Klar, Didaktik, Lernschwierigkeiten, linguistische Analyse, Kasus, Genus, Numerus, Lehrwerkgestaltung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Darstellung der Adjektivdeklination in deutschen Grammatiken"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Adjektivdeklination in drei gängigen deutschen Grammatiken (Helbig/Buscha, Duden, Klipp und Klar) und analysiert die damit verbundenen didaktischen Herausforderungen im Deutsch als Fremdsprache (DaF)-Unterricht. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der verschiedenen Präsentationsweisen und der Bewertung ihrer Vor- und Nachteile für Lerner.
Welche Grammatiken werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Darstellung der Adjektivdeklination in folgenden drei Grammatiken: Helbig/Buscha ("Ein Handbuch für den Ausländerunterricht"), Dudengrammatik ("Unentbehrlich für richtiges Deutsch") und Fayndrch/Tallowitz ("Klipp und Klar: Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch").
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Präsentationsweisen der Adjektivdeklination in den ausgewählten Grammatiken zu vergleichen und deren Vor- und Nachteile für den DaF-Unterricht zu bewerten. Sie identifiziert linguistische und didaktische Unterschiede und analysiert potenzielle Lernschwierigkeiten im Zusammenhang mit der Adjektivdeklination. Letztendlich sollen Empfehlungen für den DaF-Unterricht abgeleitet werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Vergleichende Analyse der Adjektivdeklinationsdarstellung, Identifizierung linguistischer und didaktischer Unterschiede, Bewertung der Stärken und Schwächen der Darstellungsweisen, Analyse potenzieller Lernschwierigkeiten und Ausarbeitung von Empfehlungen für den DaF-Unterricht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Adjektivdeklination in linguistischer und didaktischer Hinsicht (inklusive linguistischer Einordnung und möglicher Lernschwierigkeiten), ein Kapitel zum Vergleich der Darstellung in den drei ausgewählten Grammatiken (mit tabellarischer Übersicht), und ein Fazit.
Welche linguistischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die linguistische Einordnung und Charakterisierung der Adjektivdeklination, die attributive Funktion von Adjektiven, deren morphologische Eigenschaften (Deklination und Komparation), sowie die unterschiedlichen Reihenfolgen von Kasus und Genus in Grammatiken und deren didaktische Auswirkungen.
Welche didaktischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert potenzielle Lernschwierigkeiten im Zusammenhang mit der Adjektivdeklination und bewertet die didaktische Eignung der verschiedenen Präsentationsweisen in den ausgewählten Grammatiken. Sie berücksichtigt die Herausforderungen, die die Adjektivdeklination für Lerner und Lehrende im DaF-Unterricht darstellt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Das Fazit der Arbeit ist im bereitgestellten Textauszug nicht vollständig enthalten. Es wird jedoch erwartet, dass das Fazit die Ergebnisse des Vergleichs zusammenfasst und konkrete Empfehlungen für den DaF-Unterricht im Bezug auf die didaktische Behandlung der Adjektivdeklination gibt.)
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Adjektivdeklination, Deutsch als Fremdsprache (DaF), Grammatikvergleich, Helbig/Buscha, Dudengrammatik, Klipp und Klar, Didaktik, Lernschwierigkeiten, linguistische Analyse, Kasus, Genus, Numerus, Lehrwerkgestaltung.
- Quote paper
- Saeda Nayer (Author), 2016, Vergleich der Darstellung der Adjektivdeklination in den Grammatiken des Deutschen am Beispiel Duden, Helbig/ Buscha und Klipp und Klar, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419892