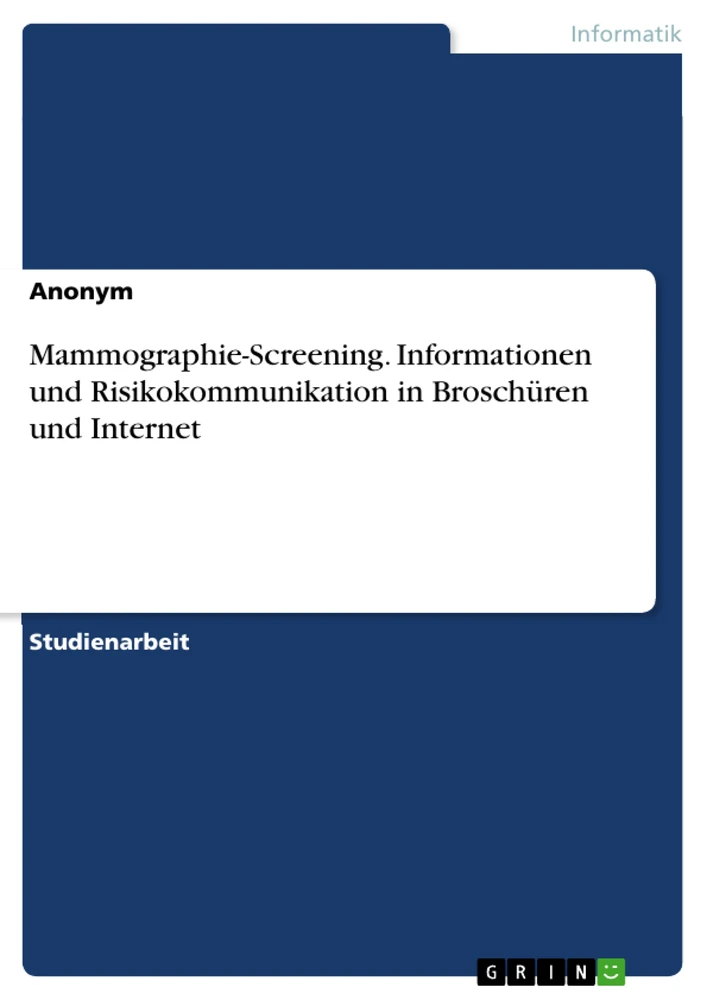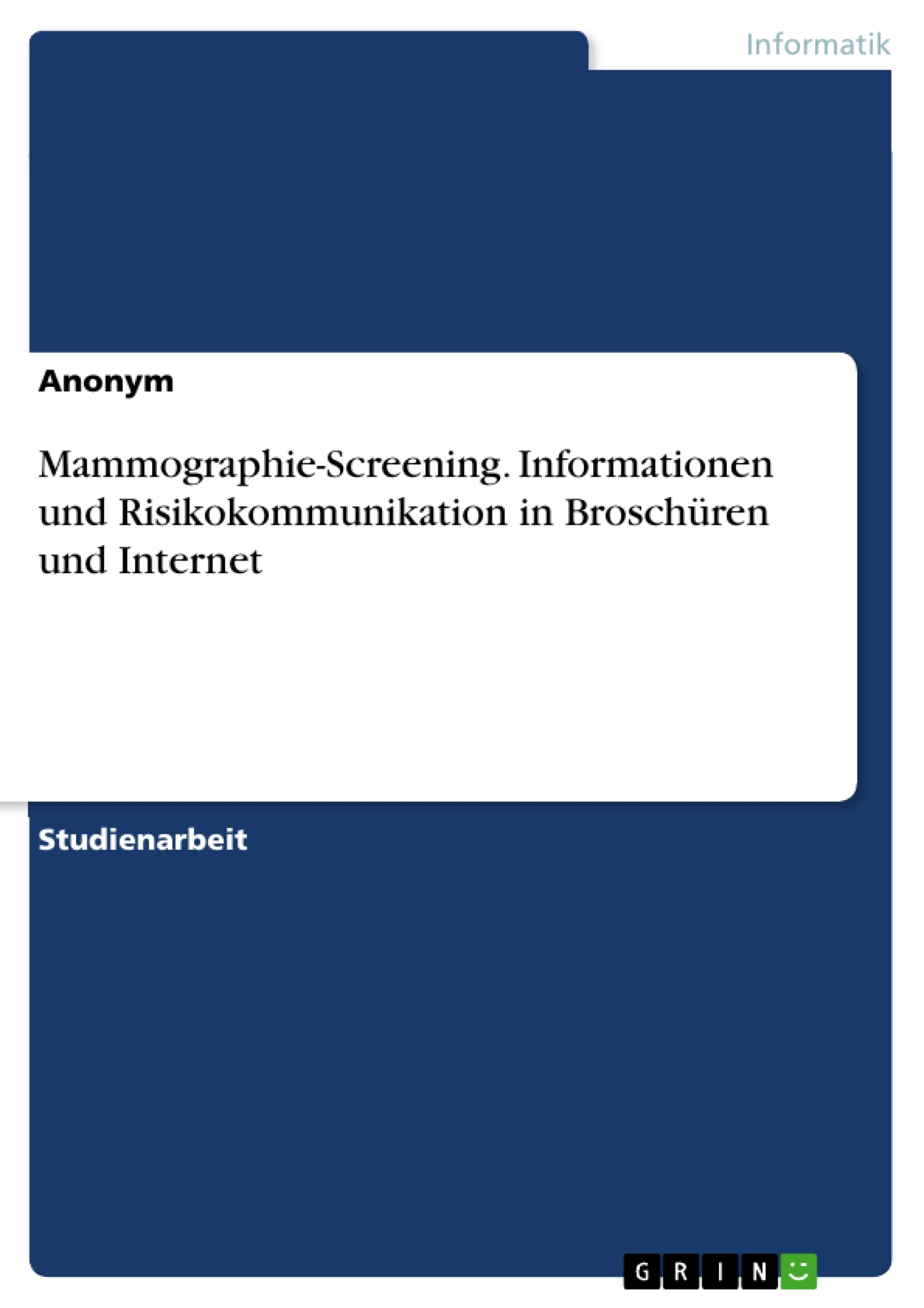Diese Seminararbeit im Rahmen des Proseminars „Der mündige Patient – Eine Illusion“ im Sommersemester 2010 soll einen Überblick über die Risikokommunikation mit Brustkrebspatientinnen von Seiten der Ärzte, Informationsbroschüren und des Internets bezüglich des Mammographie-Screenings. Es soll herausgearbeitet werden, inwiefern die Patientin /der Patient (es können auch Männer an Brustkrebs erkranken) im Zuge ihrer Informationsbeschaffung im Unklaren gelassen wird, welche Fehler demnach in der Risikokommunikation bestehen und wie diese Fehler beseitigt werden können. Im ersten Teil der Seminararbeit soll eine Einführung in die Materie, also in die Begrifflichkeiten gegeben werden. Im Fokus steht hier das Screening und im Einzelnen das Mammographie-Screening, welches eines der verschiedenen Screening-Arten zur Erkennung von Brustkrebs darstellt. Hier soll der Ablauf eines Mammographie-Screenings skizziert werden. Daraufhin werden die Nachteile, die eine Mammographie mit sich bringen kann aufgezählt und erläutert. Das Phänomen der „falsch-positiven Befunde“ etc. soll dem Leser in diesem Kapitel nähergebracht werden. Im Anschluss daran soll sich mit der Risikokommunikation zwischen Patient/in und Informationsquelle (sei es der Arzt, eine Informationsbroschüre oder Internetseiten, die dieses Thema behandeln) auseinandergesetzt werden. Inwiefern kann der Patient / die Patientin sich in der Informationsvielfalt zurechtfinden? Werden auch die Nachteile des Mammographie-Screenings aufschlussreich behandelt und erläutert? Könnten die Patientinnen / die Patienten negativ beeinflusst werden? Hier soll u.a. die mangelnde Aufklärung durch Informationsbroschüren oder das Internet thematisiert werden. Die Arbeit soll keine wertenden Aussagen beinhalten, sie soll den Leser nicht beeinflussen, sondern neutral die Vor- und Nachteile in Bezug auf Screenings und die Risikoinformation darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Screening / Mammographie-Screening
- 3. Risikokommunikation zum Thema Mammographie
- 3.1 Vorteile der Mammographie
- 3.2 Nachteile der Mammographie
- 4. Das Internet – eine zuverlässige Informationsquelle?
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Risikokommunikation rund um das Mammographie-Screening bei Brustkrebspatientinnen. Ziel ist es, Unklarheiten in der Informationsbeschaffung aufzuzeigen, Fehler in der Risikokommunikation zu identifizieren und mögliche Verbesserungen vorzuschlagen. Die Arbeit analysiert die Informationsquellen (Ärzte, Broschüren, Internet) und bewertet deren Auswirkungen auf die Patientinnen.
- Das Mammographie-Screening: Ablauf, Vor- und Nachteile
- Risikokommunikation: Arzt-Patienten-Gespräch, Informationsmaterial
- Die Rolle des Internets als Informationsquelle
- Mögliche negative Einflüsse auf Patientinnen durch mangelnde Aufklärung
- Neutraler Vergleich von Vor- und Nachteilen des Screenings
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Arbeit gibt einen Überblick über die Risikokommunikation zum Thema Mammographie-Screening. Sie beleuchtet die Informationsbeschaffung von Patientinnen und analysiert, inwiefern Unklarheiten bestehen und wie die Risikokommunikation verbessert werden kann. Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung zum Thema Screening und Mammographie, eine Betrachtung der Vor- und Nachteile der Mammographie, eine Analyse der Risikokommunikation durch verschiedene Informationsquellen und einen abschließenden Fazit. Die Arbeit verzichtet auf wertende Aussagen und strebt eine neutrale Darstellung an.
2. Screening / Mammographie-Screening: Dieses Kapitel definiert Screening als systematischen Suchtest zur Früherkennung von Krankheiten. Es beschreibt das Mammographie-Screening als radiologische Vorsorgeuntersuchung für Brustkrebs bei Frauen zwischen 50 und 69 Jahren in Deutschland. Der Ablauf der Untersuchung, die Verwendung spezieller Röntgengeräte und die Darstellungstechnik werden erläutert. Die Unterscheidung zwischen diagnostischer und Früherkennungsmammographie wird hervorgehoben, ebenso wie alternative Untersuchungsmethoden wie Ultraschall und Magnetresonanztomographie und deren jeweilige Vor- und Nachteile. Das Kapitel betont die Bedeutung des Screenings zur Senkung der Brustkrebssterblichkeit, ohne präventiven Charakter zu haben, und diskutiert die optimale Häufigkeit der Untersuchungen. Zusätzlich werden die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten bei positivem Befund – Tumorektomie, Amputation und Strahlentherapie – beschrieben.
3. Risikokommunikation zum Thema Mammographie: Dieses Kapitel analysiert die Kommunikation von Risiken im Zusammenhang mit dem Mammographie-Screening. Es untersucht, ob Patientinnen ausreichend über Vor- und Nachteile aufgeklärt werden und wie die Informationsvielfalt aus Arztgesprächen, Broschüren und Internetquellen die Entscheidungsfindung beeinflusst. Das Kapitel fokussiert darauf, wie die unterschiedliche Darstellung der Ergebnisse von Studien zum Nutzen des Mammographie-Screenings zu einer fehlerhaften oder verzerrten Risikokommunikation beitragen kann. Die mangelnde Aufklärung durch Informationsbroschüren oder das Internet wird als ein Schwerpunkt thematisiert. Der Fokus liegt auf der Analyse von potenziellen negativen Einflüssen auf Patientinnen durch ungenügende Informationen.
4. Das Internet – eine zuverlässige Informationsquelle?: (Anmerkung: Da der Text keine explizite Kapitelüberschrift für Kapitel 4 enthält, wird hier eine mögliche Überschrift formuliert, die den Kontext des Textes widerspiegelt). Dieses Kapitel würde sich voraussichtlich mit der Zuverlässigkeit und der Qualität von online verfügbaren Informationen zum Mammographie-Screening auseinandersetzen. Es würde die Herausforderungen analysieren, die sich für Patientinnen bei der Bewertung von Informationen aus dem Internet ergeben, und die Vor- und Nachteile des Informationszugriffs über das Internet im Kontext der Risikokommunikation beleuchten. Es würde wahrscheinlich auch den Aspekt der Glaubwürdigkeit und der Objektivität online verfügbarer Informationen behandeln.
Schlüsselwörter
Mammographie-Screening, Brustkrebsfrüherkennung, Risikokommunikation, Patientinneninformation, Vor- und Nachteile, Internet, Informationsquellen, ärztliche Aufklärung, falsch-positive Befunde, diagnostische Mammographie, Früherkennungsmammographie, Strahlenbelastung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs): Seminararbeit zur Risikokommunikation beim Mammographie-Screening
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Risikokommunikation rund um das Mammographie-Screening bei Brustkrebspatientinnen. Sie analysiert die Informationsquellen (Ärzte, Broschüren, Internet) und deren Auswirkungen auf die Patientinnen, um Unklarheiten in der Informationsbeschaffung aufzuzeigen, Fehler in der Risikokommunikation zu identifizieren und mögliche Verbesserungen vorzuschlagen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Das Mammographie-Screening (Ablauf, Vor- und Nachteile); Risikokommunikation (Arzt-Patienten-Gespräch, Informationsmaterial); Die Rolle des Internets als Informationsquelle; Mögliche negative Einflüsse auf Patientinnen durch mangelnde Aufklärung; und einen neutralen Vergleich von Vor- und Nachteilen des Screenings.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Mammographie-Screening, ein Kapitel zur Risikokommunikation, ein Kapitel zum Internet als Informationsquelle und ein Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas und analysiert die Informationslage und deren Auswirkungen auf die Patientinnen.
Was wird im Kapitel zum Mammographie-Screening erklärt?
Dieses Kapitel definiert Screening und beschreibt das Mammographie-Screening in Deutschland. Es erläutert den Ablauf der Untersuchung, die verwendete Technik, die Unterscheidung zwischen diagnostischer und Früherkennungsmammographie, alternative Untersuchungsmethoden und deren Vor- und Nachteile. Es betont die Bedeutung des Screenings zur Senkung der Brustkrebssterblichkeit und diskutiert die optimale Häufigkeit der Untersuchungen sowie die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten bei positivem Befund.
Was ist der Fokus des Kapitels zur Risikokommunikation?
Dieses Kapitel analysiert die Kommunikation von Risiken im Zusammenhang mit dem Mammographie-Screening. Es untersucht, ob Patientinnen ausreichend über Vor- und Nachteile aufgeklärt werden und wie die Informationsvielfalt die Entscheidungsfindung beeinflusst. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse, wie die unterschiedliche Darstellung von Studienergebnissen zu einer fehlerhaften Risikokommunikation beitragen kann, insbesondere durch mangelnde Aufklärung in Broschüren oder im Internet.
Welche Rolle spielt das Internet in der Seminararbeit?
Die Arbeit untersucht die Zuverlässigkeit und Qualität von online verfügbaren Informationen zum Mammographie-Screening. Es werden die Herausforderungen bei der Bewertung von Internetinformationen und die Vor- und Nachteile des Informationszugriffs über das Internet im Kontext der Risikokommunikation beleuchtet. Die Glaubwürdigkeit und Objektivität online verfügbarer Informationen werden ebenfalls thematisiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt auf eine neutrale Darstellung ab und vermeidet wertende Aussagen. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und benennt mögliche Verbesserungen in der Risikokommunikation, um Patientinnen besser zu informieren und ihre Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Mammographie-Screening, Brustkrebsfrüherkennung, Risikokommunikation, Patientinneninformation, Vor- und Nachteile, Internet, Informationsquellen, ärztliche Aufklärung, falsch-positive Befunde, diagnostische Mammographie, Früherkennungsmammographie, Strahlenbelastung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2010, Mammographie-Screening. Informationen und Risikokommunikation in Broschüren und Internet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419309