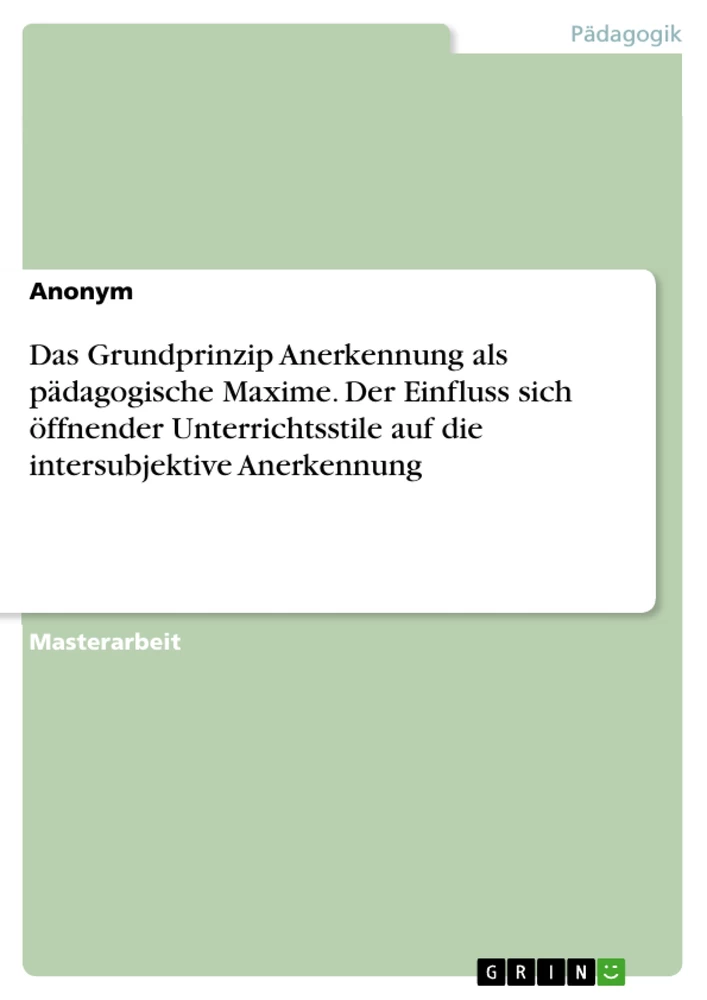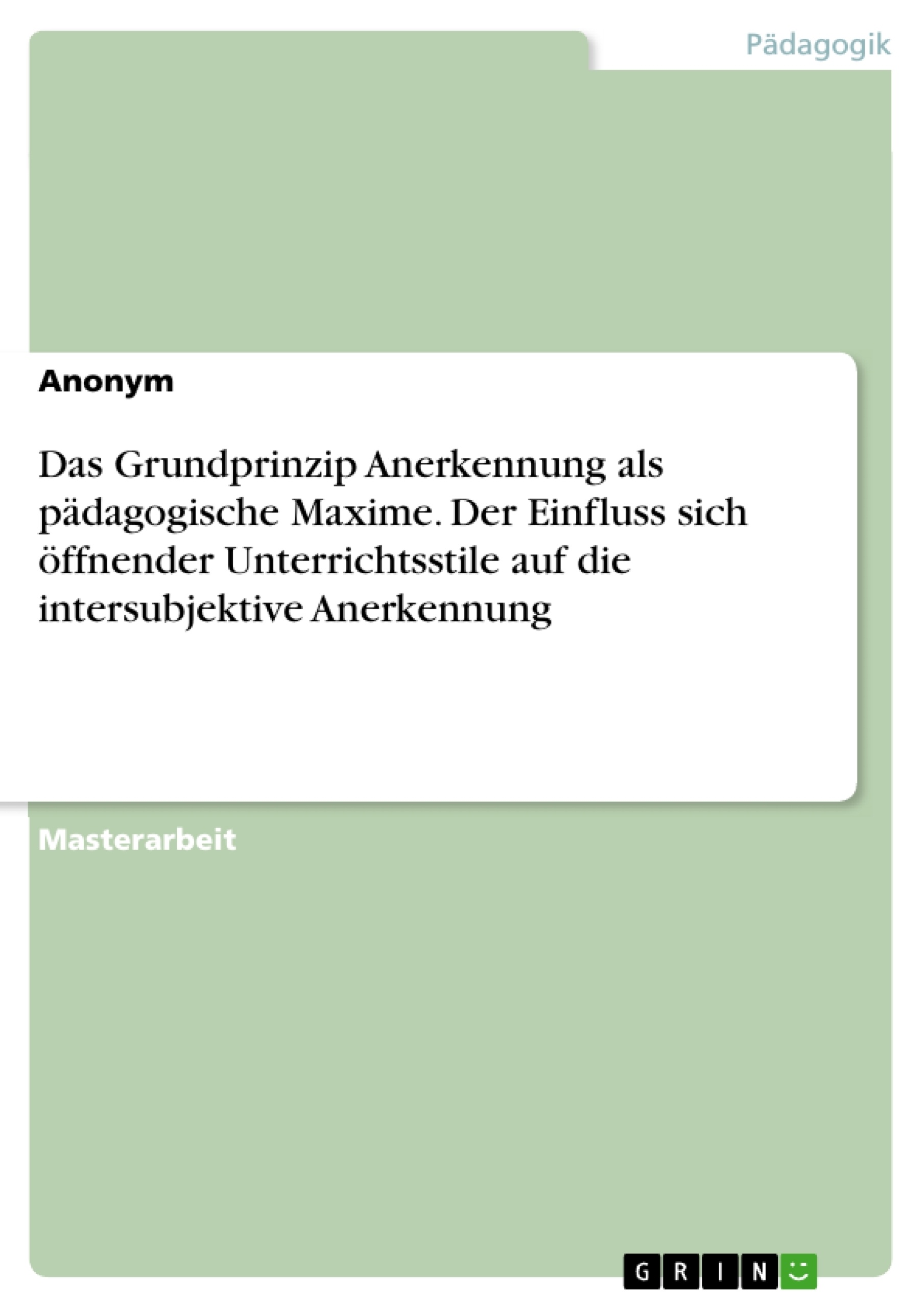Die Vermittlung der in unserer Verfassungs- und Gesellschaftsordnung tragenden Werte macht einen der Schwerpunkte unseres pädagogischen Bildungs- und Erziehungsauftrags in der Schule aus. Welche Werte dies in einer Gesellschaft sind, die immer stärker vom Wandel bestimmt ist, gilt es in Bezug auf das frühzeitige Erfahren und Reflektieren herauszufinden. Man muss sich im Klaren sein, dass Werteerziehung vor allem im pädagogischen Kontext bedeutet, Kindern und Jugendlichen eine Orientierung zu geben, um sie beim Hineinwachsen in die Gesellschaft zu begleiten. Denn Bildung gibt es nicht ohne Erziehung, und Erziehung gibt es nicht ohne Werte. Der Wertewandel des postmodernen Zeitalters stellt jedes Mitglied der Gesellschaft vor innere Zerreißproben. „Wir wollen Bindung in Freiheit, und wir wollen Freiheit in Bindung “. Diese Werte sind andererseits aber das Produkt unseres demokratischen und auf die Verfassung zurückgreifenden Verständnisses von Gleichheit, Freiheit und Solidarität. Es scheinen also nicht neue Verfassungsgesetze notwendig, sondern eher pädagogische Ansätze, die es verstehen, die Kennzeichen der heutigen Gesellschaft zu lesen und entsprechend zu handeln.
Inhaltsverzeichnis
- Das „Grundprinzip“ Anerkennung als pädagogische Bewegung
- Die Bedeutung der Bildung und Erziehung
- Der Kasper-Hauser-Versuch
- Immanuel Kant (1724-1804)
- Hugo Gaudig (1860-1926)
- Albert Scherr
- Scham und Anerkennung
- Formen der Scham
- Schamabwehrverhalten
- Kampf um Anerkennung
- Anerkennung versus Scham im Schulunterricht
- Pädagogik der Vielfalt
- Widerspruch zwischen Vielfalt und Leistung
- Mehrperspektivische Anerkennung
- Interaktionsqualitäten des Lehrerhandelns
- Erziehungsstile nach Kurt Lewin
- Dimensionen des „Erziehens“
- Gütekriterien guten Unterrichts
- Zusammenfassung
- Anerkennungstheoretische Untersuchung sich öffnender Unterrichtsstile – Erste empirische Ergebnisse
- Wissenschaftliches Vorgehen
- Datenerhebung
- Beobachtungsbogen für individuelle Themen
- Erstauswertung der Beobachtung
- Auswertung mit MAXQDA
- Angaben zum Untersuchungsfeld
- Quantitative Analysen
- Grad der Anerkennung im Fächervergleich
- Grad der Anerkennung nach Schultyp
- Grad der Anerkennung nach Unterrichtsstil
- Anerkennung versus lernförderlicher Unterricht
- Anerkennung versus thematische Aufmerksamkeit
- Vergleich der einzelnen Lehrkräfte
- Qualitative Analysen
- Anerkennende Szenen im Schulunterricht
- Missachtende Szenen im Schulunterricht
- Szenen „sich öffnender Unterrichtsstile“
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss sich öffnender Unterrichtsstile auf die intersubjektive Anerkennung im Bildungskontext. Sie beleuchtet das „Grundprinzip Anerkennung“ als pädagogische Bewegung und analysiert empirisch, wie verschiedene Unterrichtsstile die Anerkennung von Schülern beeinflussen.
- Das „Grundprinzip Anerkennung“ als pädagogischer Ansatz
- Der Zusammenhang zwischen Anerkennung und Scham im Unterricht
- Die Bedeutung von Pädagogik der Vielfalt für Anerkennung
- Empirische Untersuchung verschiedener Unterrichtsstile
- Analyse der Interaktionsqualitäten des Lehrerhandelns
Zusammenfassung der Kapitel
Das „Grundprinzip“ Anerkennung als pädagogische Bewegung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beleuchtet die Bedeutung von Anerkennung in Bildung und Erziehung anhand verschiedener philosophischer und pädagogischer Perspektiven, von Kant bis zu zeitgenössischen Ansätzen. Der Fokus liegt auf dem Spannungsfeld zwischen Anerkennung und Scham und deren Auswirkungen auf den Unterricht. Der Kasper-Hauser-Versuch wird als Beispiel für die Bedeutung von sozialer Interaktion und Anerkennung für die Entwicklung des Individuums herangezogen. Die Bedeutung der Pädagogik der Vielfalt im Kontext von Anerkennung und der Umgang mit dem Widerspruch zwischen Vielfalt und Leistung werden diskutiert. Schließlich werden Interaktionsqualitäten des Lehrerhandelns und verschiedene Erziehungsstile im Hinblick auf ihre Auswirkung auf die Anerkennung beleuchtet.
Anerkennungstheoretische Untersuchung sich öffnender Unterrichtsstile – Erste empirische Ergebnisse: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung zum Thema. Es detailliert die methodischen Vorgehensweisen, inklusive Datenerhebung (Beobachtungsbogen), Auswertung (MAXQDA) und die Beschreibung des Untersuchungsfeldes. Sowohl quantitative als auch qualitative Analysen werden vorgestellt. Die quantitativen Analysen untersuchen den Grad der Anerkennung in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Fach, Schultyp und Unterrichtsstil. Die qualitativen Analysen untersuchen aussagenstarke Szenen im Unterricht, sowohl anerkennende als auch missachtende, um ein umfassenderes Bild zu vermitteln. Die Ergebnisse zeigen erste Zusammenhänge zwischen dem Unterrichtsstil und dem Grad der Anerkennung auf, bieten aber auch Raum für weitere Untersuchungen.
Schlüsselwörter
Anerkennung, Pädagogik, Unterrichtsstil, Scham, Inklusive Pädagogik, Empirische Forschung, Qualitative Analyse, Quantitative Analyse, Lehrerhandeln, Interaktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Anerkennung im Unterricht
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss „sich öffnender Unterrichtsstile“ auf die intersubjektive Anerkennung im Bildungskontext. Sie analysiert empirisch, wie verschiedene Unterrichtsstile die Anerkennung von Schülern beeinflussen und beleuchtet das „Grundprinzip Anerkennung“ als pädagogische Bewegung.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit basiert auf dem „Grundprinzip Anerkennung“ als pädagogischer Ansatz. Sie betrachtet den Zusammenhang zwischen Anerkennung und Scham im Unterricht, die Bedeutung der Pädagogik der Vielfalt für Anerkennung und analysiert die Interaktionsqualitäten des Lehrerhandelns, inklusive verschiedener Erziehungsstile (z.B. nach Kurt Lewin).
Welche philosophischen und pädagogischen Perspektiven werden einbezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene philosophische und pädagogische Perspektiven, von Immanuel Kant bis zu zeitgenössischen Ansätzen. Der Kasper-Hauser-Versuch wird als Beispiel für die Bedeutung von sozialer Interaktion und Anerkennung für die Entwicklung des Individuums herangezogen. Die Bedeutung von Anerkennung und der Umgang mit dem Widerspruch zwischen Vielfalt und Leistung im Rahmen der Pädagogik der Vielfalt werden diskutiert.
Wie ist die empirische Untersuchung aufgebaut?
Die empirische Untersuchung beschreibt methodische Vorgehensweisen, inklusive Datenerhebung (Beobachtungsbogen), Auswertung (MAXQDA) und die Beschreibung des Untersuchungsfeldes. Sowohl quantitative als auch qualitative Analysen werden durchgeführt. Die quantitativen Analysen untersuchen den Grad der Anerkennung in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Fach, Schultyp und Unterrichtsstil. Die qualitativen Analysen untersuchen aussagenstarke Szenen im Unterricht (anerkennende und missachtende Szenen).
Welche quantitativen Analysen werden durchgeführt?
Die quantitativen Analysen untersuchen den Grad der Anerkennung im Fächervergleich, nach Schultyp, nach Unterrichtsstil, im Verhältnis zu lernförderlichem Unterricht und thematischer Aufmerksamkeit sowie im Vergleich der einzelnen Lehrkräfte.
Welche qualitativen Analysen werden durchgeführt?
Die qualitativen Analysen untersuchen anerkennende und missachtende Szenen im Unterricht und konzentrieren sich auf Szenen, die „sich öffnende Unterrichtsstile“ repräsentieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Anerkennung, Pädagogik, Unterrichtsstil, Scham, Inklusive Pädagogik, Empirische Forschung, Qualitative Analyse, Quantitative Analyse, Lehrerhandeln, Interaktion.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu dem „Grundprinzip Anerkennung“ als pädagogische Bewegung (inkl. Bedeutung von Bildung und Erziehung, Scham und Anerkennung, Pädagogik der Vielfalt und Interaktionsqualitäten des Lehrerhandelns) und ein Kapitel zur anerkennungstheoretischen Untersuchung sich öffnender Unterrichtsstile mit ersten empirischen Ergebnissen (inkl. wissenschaftlichem Vorgehen, quantitativen und qualitativen Analysen).
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse zeigen erste Zusammenhänge zwischen dem Unterrichtsstil und dem Grad der Anerkennung auf und bieten Raum für weitere Untersuchungen. Die Arbeit präsentiert sowohl quantitative als auch qualitative Analysen von Unterrichtsszenen, die anerkennendes und missachtendes Lehrerhandeln aufzeigen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Das Grundprinzip Anerkennung als pädagogische Maxime. Der Einfluss sich öffnender Unterrichtsstile auf die intersubjektive Anerkennung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/419287