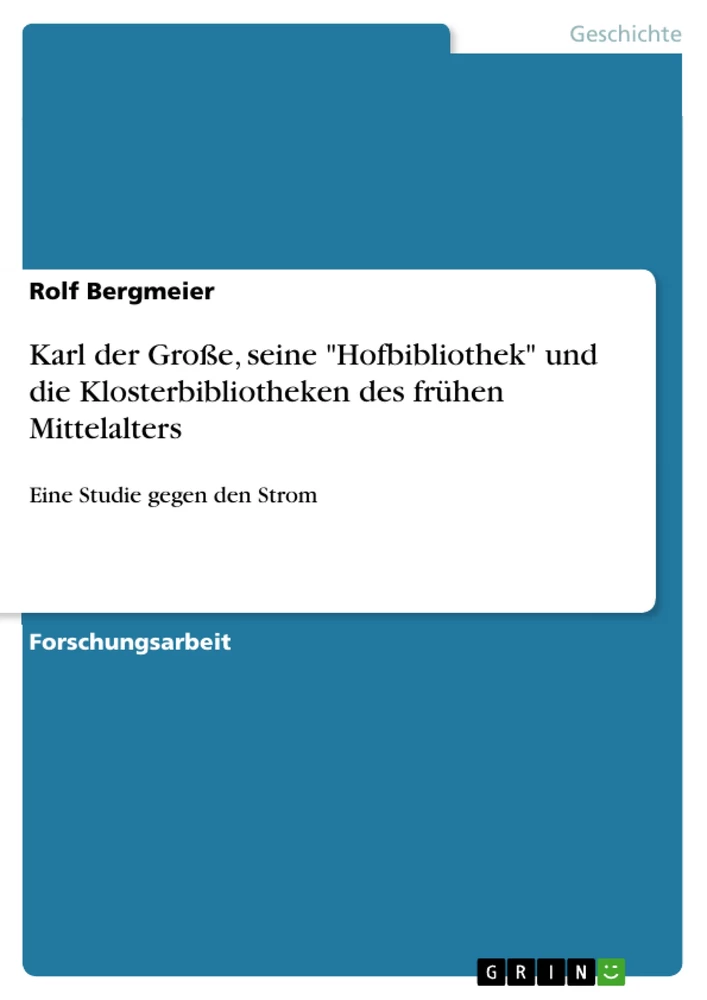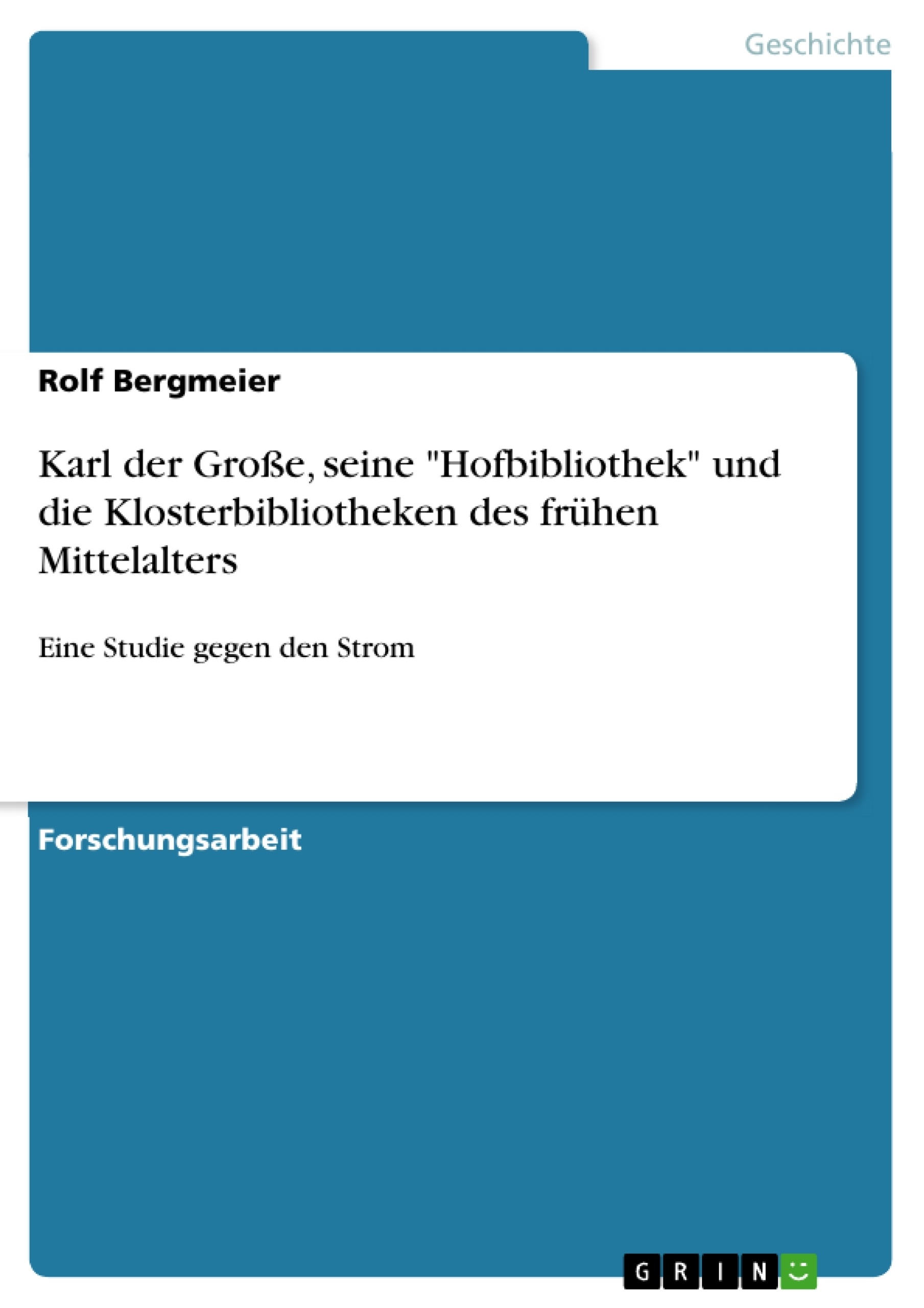Nach Tausenden von Seiten Karl-Biografien soll hier das Leben Karls nicht noch einmal nachgezeichnet werden. Seine Jugend ist ausreichend spekulativ beschrieben worden, seine Konkubinen sind uns nur eine Fußnote wert und seine Kaiserkrönung im Jahr 800 lässt uns nicht vor Ehrfurcht erschauern. Wir sind stattdessen vor allem an Karl als „Gelehrtem“ und „Vater Europas“ interessiert, an seiner hoch gerühmten Hofbibliothek und dem Beitrag der Klosterbibliotheken zur „abendländischen Kultur“.
Karl wird 768 zum König gesalbt. Das erste Jahrzehnt seiner Herrschaft hat keine künstlerischen oder literarischen Denkmäler hinterlassen. Erst in den 780er-Jahren erwirbt er sich den Ruf eines „Gelehrten“. Dieser Ruf wird von Karls Hofberichterstatter Einhard (770–840) begründet, der nahezu zwei Jahrzehnte nach Karls Tod in seiner Vita Karoli Magni (Das Leben Karls des Großen) die gelehrten Ambitionen Karls beschreibt, und von Karl in seiner Epistola generalis (um 790) selbst genährt: „Voll wachsamen Eifer sind wir damit beschäftigt, die Werkstatt der Wissenschaften wiederherzustellen, die durch die Nachlässigkeit unserer Vorfahren beinahe verödet war und laden durch eigenes Beispiel, soviel wir können, dazu ein, die freien Künste zu erlernen“. Karl, so heißt es analog dazu im Katalog der Aachener Karl-Ausstellung 2014, habe „sich intensiv auf dem Gebiet der Wissenschaften einweisen“ lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Karls Gelehrsamkeit
- Karls Hofbibliothek
- Die Überlieferung
- Die „hoch gerühmte“ Bibliothek
- Die Klosterbibliotheken
- Die Meinung der Buchwissenschaftler
- Belege: Verzeichnisse und Bestände
- Facit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Rolle Karls des Großen als „Gelehrten“ und „Vater Europas“, insbesondere mit der Bedeutung seiner vermeintlichen Hofbibliothek und des Beitrags der Klosterbibliotheken zur Entwicklung der abendländischen Kultur. Der Autor Rolf Bergmeier nimmt eine kritische Perspektive ein und hinterfragt gängige Mythen und Annahmen über Karls Gelehrsamkeit und seine Sammlung von Büchern.
- Kritik an der Darstellung Karls als „Gelehrten“
- Analyse der Quellen und ihrer Zuverlässigkeit
- Überprüfung der Existenz und Bedeutung der Hofbibliothek
- Einordnung der Klosterbibliotheken in den Kontext der frühen Buchkultur
- Herausarbeitung der Bedeutung der karolingischen Buchkultur
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Der Text stellt die Fragestellung und den Ansatz der Studie vor und grenzt sich von herkömmlichen Karl-Biografien ab.
- Karls Gelehrsamkeit: Das Kapitel analysiert die Quellen, die für Karls Gelehrsamkeit sprechen, und hinterfragt deren Zuverlässigkeit. Es stellt dar, dass Karl möglicherweise nur rudimentär lesen und schreiben konnte und dass die Annahme einer „wissenschaftlichen“ Hofgesellschaft übertrieben ist.
- Karls Hofbibliothek: Dieses Kapitel beleuchtet die Überlieferung zur Hofbibliothek und zeigt, dass die Existenz einer großen und vielfältigen Sammlung von Büchern nicht gesichert ist. Der Autor präsentiert unterschiedliche Sichtweisen und argumentiert, dass die meisten Aussagen über die Bibliothek auf Spekulationen beruhen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Karl der Große, Gelehrsamkeit, Hofbibliothek, Klosterbibliotheken, Buchkultur, Frühmittelalter, Quellenkritik, Mythen, Spekulation, Fakten, Forschung.
- Quote paper
- M.A. Rolf Bergmeier (Author), 2018, Karl der Große, seine "Hofbibliothek" und die Klosterbibliotheken des frühen Mittelalters, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418820