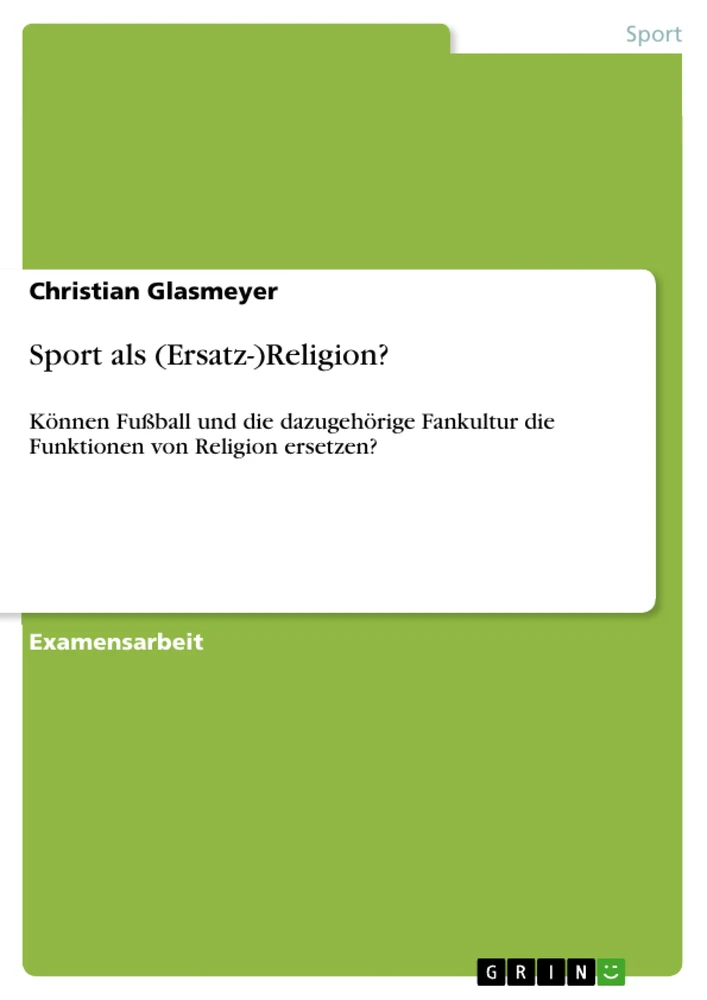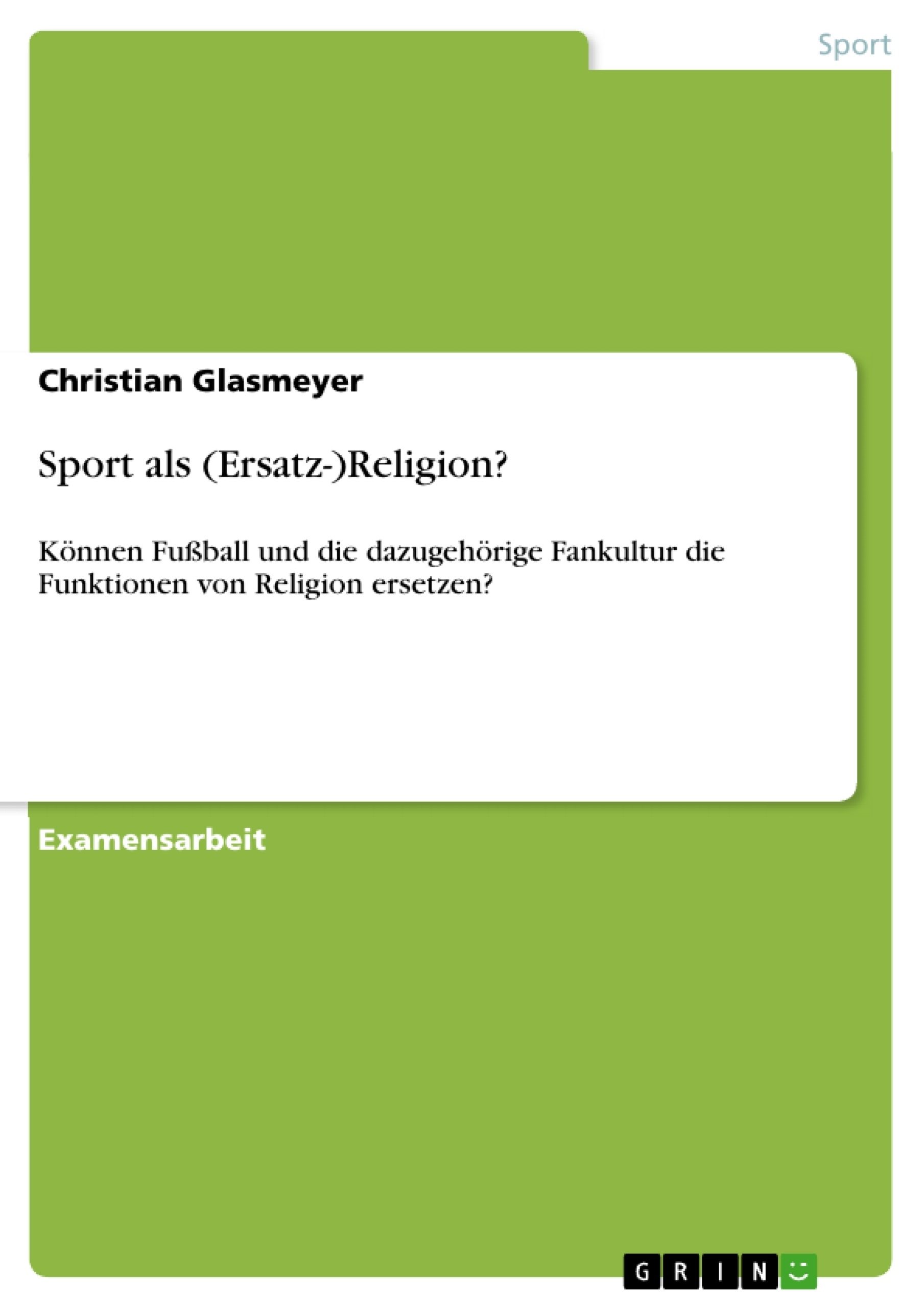Was hat Sport mit Religion zu tun? Überhaupt nichts? Vielleicht etwas? Oder doch ziemlich viel? Sich bekreuzigende Spieler, zum Gebet gefaltete Hände, Grüße und Küsse gen Himmel sind keine seltenen Bilder bei Fußballübertragungen. Aber neben diesen offensichtlichen religiösen Symbolen und Ritualen einiger vereinzelter, ihren Glauben extrovertiert auslebenden, Spieler, lassen sich beim Fußball auch noch andere, tiefer greifende Parallelen zu Religion und gerade auch zur kirchlichen Liturgie beobachten.
So ähnelt beispielsweise das Einmarschieren der Mannschaften dem Einlaufen des Priesters und der Messdiener in die Kirche, die Gesänge der Fans erinnern an Kirchenchoräle und die (noch) überwiegend patriarchalischen Strukturen sind in Fußball und Kirche sehr ähnlich konzipiert. Die römisch-katholische Kirche etwa hat ihr weltweites Oberhaupt, den Papst. Ihm folgen Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe und Priester. Der Fußball organisiert sich ähnlich strukturiert in Verbänden. Weltweit ist die FIFA das „Oberhaupt“, auf europäischer Ebene folgt die UEFA, dann die Bundes- und schließlich Landesverbände. Wie eine Gemeinde von ihrem Priester geleitet wird, leitet der Vorsitzende einen Verein, der Trainer eine Mannschaft und ein „Erwählter“ die Fangesänge und Schlachtrufe im Stadion. Die äußeren, wahrnehmbaren Strukturen von Fußball und Religion sind also schon einmal ziemlich ähnlich.
Wenn von und über Fußball gesprochen wird, ist außerdem religiöse Sprache allgegenwärtig, besonders in den Medien. Begriffe wie z.B. „Fußballgott“, „Hand Gottes“, „Das Wunder von Bern“ oder „Teamgeist“ sind allesamt religiös konnotiert und zugleich jedem echten Fußballfan ein Begriff. Aber warum erhalten diese Termini aus dem religiösen Sprachgebrauch Einzug in die Welt des Sports, besonders in die des Fußballs? Gerade, wo doch sicher nicht jeder Fußballfan von sich behaupten würde, ein religiöser Mensch zu sein. Und genau hier liegt neben den beschriebenen Parallelen schließlich auch einer der größten Unterschiede von Fußball und Religion: Das öffentliche Interesse am (Profi-)Fußball steigt seit Jahren stetig an, während in den Medien dagegen von der Kirche zunehmend nur im Zusammenhang mit der sogenannten Kirchenkrise berichtet wird. Während die Stadien also immer voller werden, werden die Kirchen zunehmend leerer. Könnte Fußall und die dazugehörige Fankultur die Funktionen von Fußball etwa ersetzen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung der eigenen Fragestellung
- Inhaltlicher Aufbau und Ziel der Arbeit
- Religion – eine Begriffsbestimmung
- Substanzielle Religions-Definitionen
- Funktionale Religions-Definitionen
- Die elementaren Formen des religiösen Lebens nach Durkheim
- Weitere Funktionen von Religion
- Charakteristika des Fußballsports
- Geschichte des Fußballsports
- Ursprünge
- Entwicklung in Europa
- Entwicklung in Deutschland
- Zum Fantum im (Fußball-)Sport
- Was ist ein Fan?
- Fans in der Forschung
- Fußballfans
- Berührungspunkte von Fußball und Religion
- Ursprünge und Entwicklung
- Metaphorischer Sprachgebrauch
- Religiöse Symbolik im Fußball
- Funktionen von Religion im Einzugsbereich des Fußballs
- Gemeinschaftsbildung
- Einteilung der Dinge in heilig und profan
- Vorstellung mythischer Persönlichkeiten
- Verbote und Wertevorstellungen
- Rituale
- Systematisierung der Lebensführung
- Kontingenzbewältigung
- Empirische Befunde
- Entwicklung der Zuschauerzahlen der Bundesliga
- Entwicklungen der DFB-Mitgliederzahlen
- Entwicklungen der Kirchenmitglieder in Deutschland
- Fußball-Fans und Religion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Verhältnis von Fußball und Religion, insbesondere ob Fußball die Funktionen von Religion ersetzen kann. Die Arbeit untersucht, wie sich die beiden Bereiche in ihren Ursprüngen und Entwicklungen ähneln und wie sich die Sprache und Symbolik des Fußballs mit religiösen Konzepten überschneidet. Darüber hinaus werden die Funktionen von Religion, wie Gemeinschaftsbildung, Wertevorstellungen und Rituale, auf ihre Relevanz im Fußball und im Fantum untersucht.
- Beziehungen zwischen Fußball und Religion im historischen Kontext
- Metaphern und Symbole im Fußball, die religiöse Bezüge aufweisen
- Die Rolle des Fußballs in der Gemeinschaftsbildung und der Identitätsbildung
- Die Bedeutung von Ritualen und Symbolen im Fußball als Ausdruck von Glaubensvorstellungen
- Die Frage, ob Fußball bestimmte Funktionen von Religion übernehmen oder sogar ersetzen kann
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit der Einleitung, in der die Fragestellung der Arbeit vorgestellt und die Relevanz des Themas herausgestellt wird. Kapitel 2 analysiert verschiedene Religionsverständnisse und fokussiert auf den funktionalen Religionsbegriff. Im Anschluss werden in Kapitel 3 die Geschichte und Entwicklung des Fußballs sowie das Fantum im Fußballsport behandelt. Kapitel 4 untersucht detailliert die Berührungspunkte von Fußball und Religion, insbesondere die gemeinsame Geschichte, die metaphorische Sprache und die Funktionen von Religion im Einzugsbereich des Fußballs. Kapitel 5 präsentiert empirische Befunde zur Entwicklung von Zuschauerzahlen, Vereinsmitgliedschaften und Kirchenmitgliedschaften. Dabei wird die Frage nach einer möglichen Zusammenhang zwischen Fantum und Religiosität aufgegriffen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Sport und Religion am Beispiel des Fußballs. Im Fokus stehen die Funktionen von Religion, insbesondere im Vergleich zum Fußball und seinem Fantum. Die Arbeit untersucht die Gemeinschaftsbildung, Rituale und Symbole im Fußball sowie die metaphorische Sprache des Fußballs und ihre religiösen Bezüge. Weitere zentrale Themen sind die Entwicklung von Zuschauerzahlen, Vereinsmitgliedschaften und Kirchenmitgliedschaften sowie die Frage, ob Fußball die Funktionen von Religion übernehmen oder sogar ersetzen kann.
- Quote paper
- Christian Glasmeyer (Author), 2013, Sport als (Ersatz-)Religion?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418775