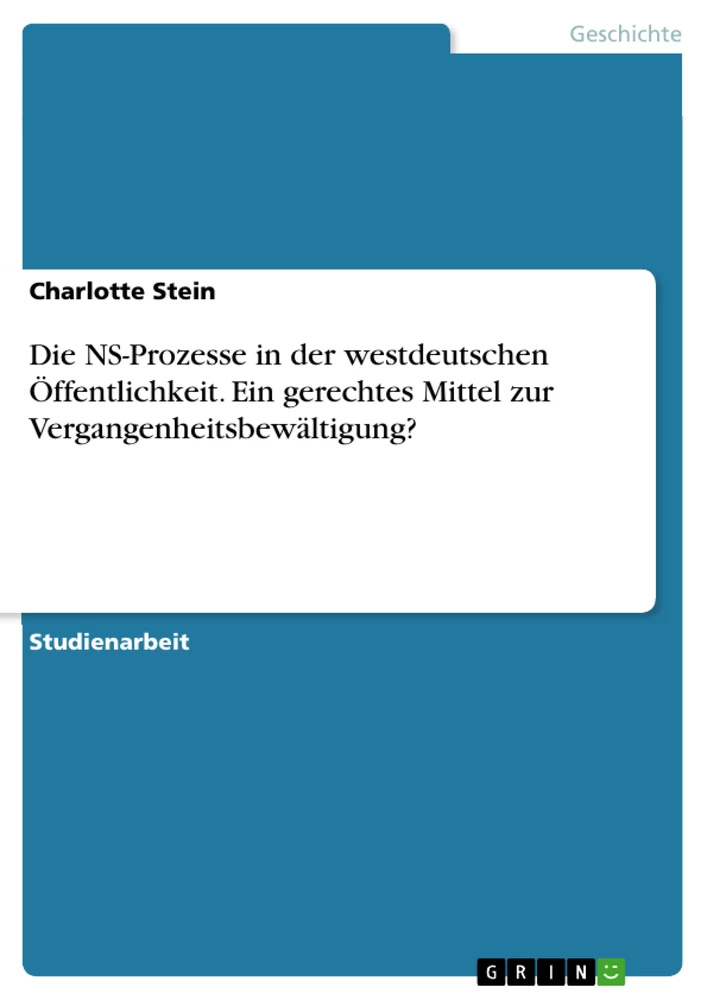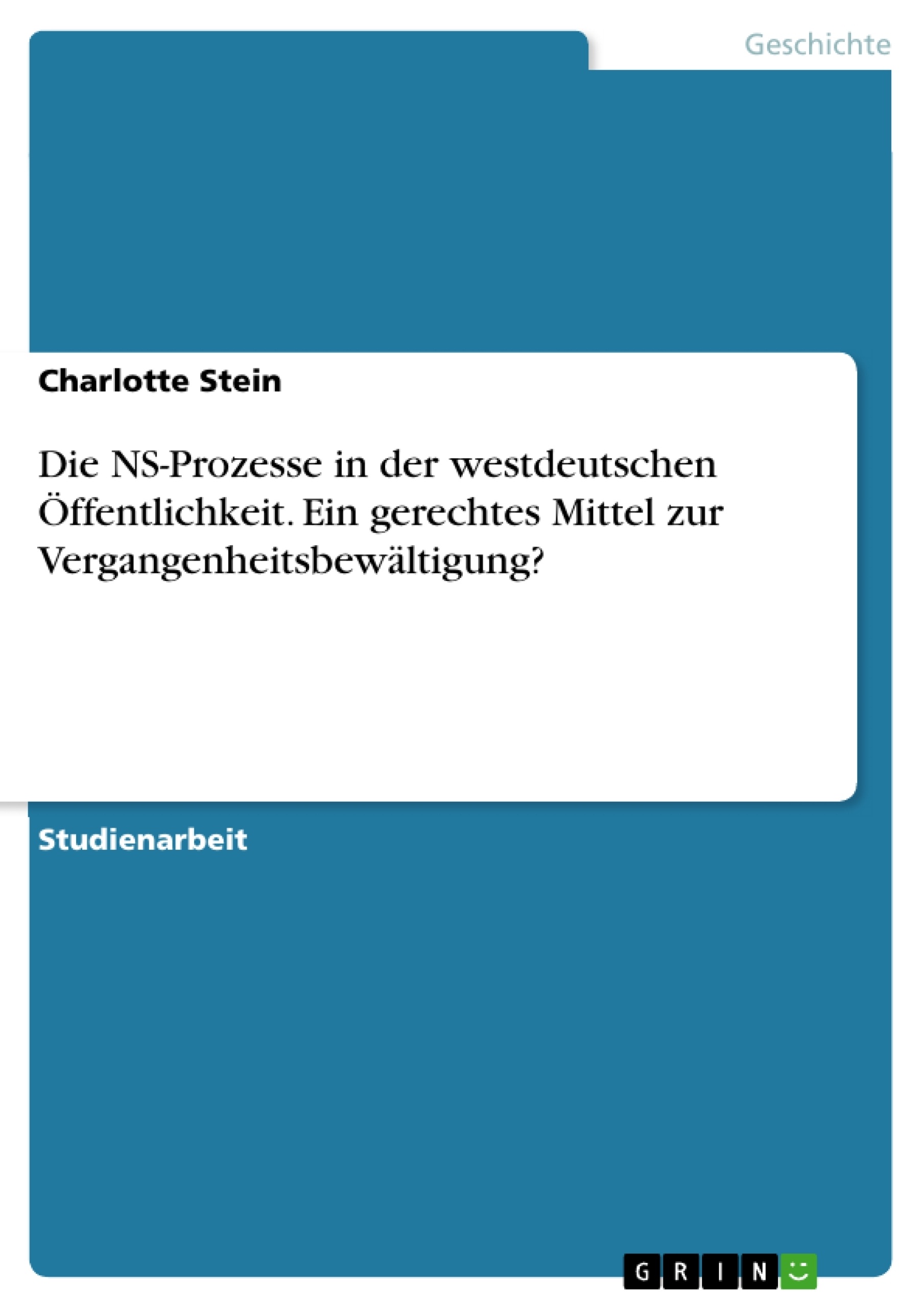Der sechste Bundespräsident Richard von Weizäcker sagte am 8. Mai 1985 in seiner Ansprache zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft: "Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart". Bei Erwähnung der Vergangenheit in Verbindung mit nationalsozialistischer Gewaltherrschaft denkt wohl jeder an die Bilder von grausam verstümmelten, misshandelten und getöteten Juden in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten. Eben diese Bilder wurden auch in den Prozessen gegen die Hauptkriegsverbrecher als Beweismaterial gesichtet. Ihre Verwendung war ebenso umstritten wie die Prozesse selbst.
Ziel dieser Hausarbeit ist es, darzustellen, wie die NS-Prozesse in der breiten Öffentlichkeit wirklich gesehen wurden, wie die Prozesse das Meinungsbild in Bezug auf den Nationalsozialismus beeinflusst haben und ob die NS-Prozesse als gerechtes Mittel zur Vergangenheitsbewältigung empfunden wurden. Zur Beantwortung dieser Fragen ist es nötig, die juristischen und historischen Gegebenheiten der Jahre 1945 bis 1969 darzustellen.
Zur Darstellung der politischen Phasen ist die Hausarbeit in drei Kapitel unterteilt. Zunächst erfolgt die Schilderung der Besetzungszeit von 1945 bis 1949. Dem folgend schließen sich die Jahre von der Gründung der beiden deutschen Staaten bis 1961 an. Den Anschluss bilden die Jahre nach der "Adenauer-Ära" bis zum Ende der 1960er. Im abschließenden letzten Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst, um die Entwicklung des öffentlichen Meinungsbildes im untersuchten Zeitraum darzustellen. Da NS-Prozesse in der DDR nicht öffentlich waren, erfolgte hier keine öffentliche Diskussion. Es konnte sich somit kein öffentliches Meinungsbild entwickeln. Die NS-Prozesse, die in der DDR geführt wurde, fallen deshalb aus der Betrachtung heraus.
Als Grundlage der Arbeit dienen die Ausführungen von Arnulf Kutsch, Werner Bergmann und Bernd Weisbrod, die auf Umfragen des Meinungsforschungsinstituts EMNID und des Office of Military Government for Germany (OMGUS) basieren. Diese Werke nennen, im Gegensatz zu den ebenfalls verwendeten Schriften von Peter Reichel und Peter Steinbach, konkrete Zahlen aus repräsentativen Umfragen und zeichnen somit ein belegbares Bild der öffentlichen Meinung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deutschland unter der Besatzung der Alliierten
- Juristische Verfolgung von NS-Straftätern
- Die Nürnberger Prozesse in der deutschen Öffentlichkeit
- Die BRD während der „Adenauer-Ära“
- Grundlagen für die juristische Vergangenheitsbewältigung in der jungen BRD
- Der „Ulmer-Einsatzgruppenprozess“
- Zeiten des Wandels
- Der Eichmann-Prozess in Jerusalem
- Oppositionsbildung und Konfrontation mit der Vergangenheit
- Der Frankfurter Auschwitz-Prozess
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die öffentliche Wahrnehmung von NS-Prozessen in der Bundesrepublik Deutschland von 1945 bis 1969. Das Hauptziel ist es, zu analysieren, wie die Prozesse die öffentliche Meinung zum Nationalsozialismus beeinflussten und ob sie als gerechtes Mittel der Vergangenheitsbewältigung betrachtet wurden.
- Die juristische Verfolgung von NS-Straftätern in den verschiedenen politischen Phasen der frühen Bundesrepublik
- Die öffentliche Debatte um NS-Prozesse und ihre Rezeption in der breiten Bevölkerung
- Der Einfluss der Nürnberger Prozesse und anderer wichtiger Verfahren auf das deutsche Selbstbild
- Die Rolle der Medien und der politischen Eliten bei der Formung des öffentlichen Diskurses
- Die Bedeutung von NS-Prozessen für die Vergangenheitsbewältigung und die Entwicklung der deutschen Identität
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Besatzungszeit Deutschlands von 1945 bis 1949. Es beleuchtet die Entnazifizierungsmaßnahmen der Alliierten und die Prozesse gegen NS-Straftäter, insbesondere die Nürnberger Prozesse und ihre Rezeption in der deutschen Öffentlichkeit.
Kapitel 2 widmet sich der frühen Bundesrepublik während der „Adenauer-Ära“ (1949-1961). Hier werden die Grundlagen für die juristische Vergangenheitsbewältigung in der jungen BRD erörtert sowie die Bedeutung des „Ulmer-Einsatzgruppenprozesses“ analysiert.
Das dritte Kapitel beleuchtet die „Zeiten des Wandels“ nach der „Adenauer-Ära“ bis zum Ende der 1960er Jahre. Es betrachtet den Eichmann-Prozess in Jerusalem, die zunehmende Oppositionsbildung und Konfrontation mit der Vergangenheit sowie den Frankfurter Auschwitz-Prozess.
Schlüsselwörter
NS-Prozesse, deutsche Öffentlichkeit, Vergangenheitsbewältigung, Nürnberger Prozesse, Eichmann-Prozess, Frankfurter Auschwitz-Prozess, Entnazifizierung, Bundesrepublik Deutschland, politische Phasen, Medienrezeption, öffentliches Meinungsbild, deutsche Identität.
- Citation du texte
- Charlotte Stein (Auteur), 2011, Die NS-Prozesse in der westdeutschen Öffentlichkeit. Ein gerechtes Mittel zur Vergangenheitsbewältigung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418722