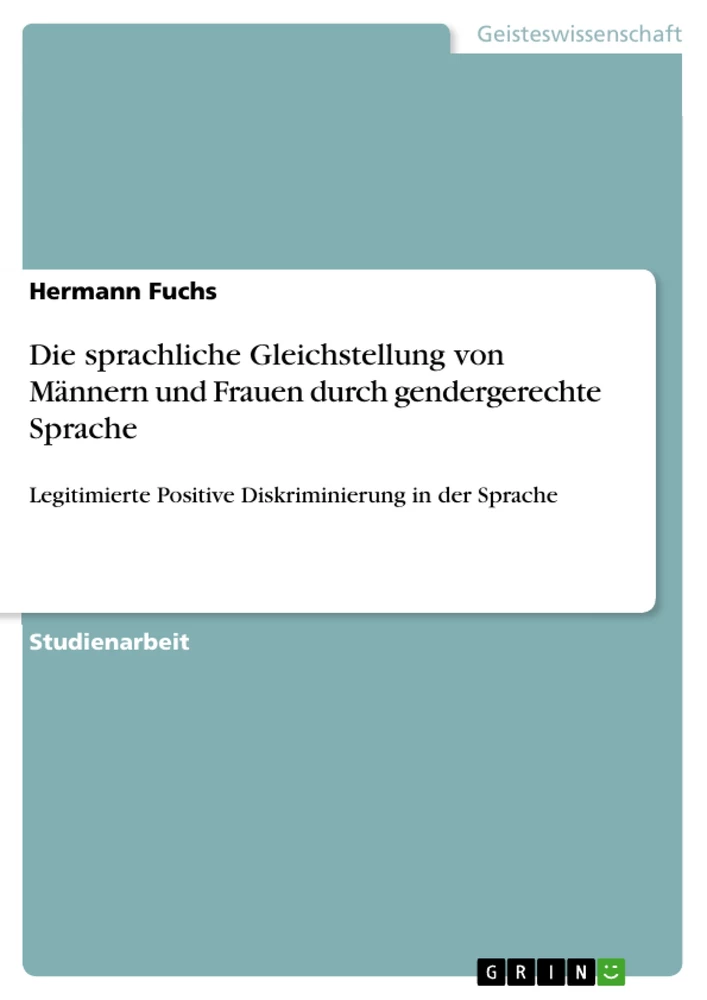„Wie kommt die ‚Welt‘ in das Individuum?“ (Niederbacher/Zimmermann, 2011) ist wohl die bedeutsamste Fragestellung der Sozialisationsforschung und es wurden schon unzählige Versuche unternommen, diese zu beantworten. Doch um nur eine wichtige Komponente zu nennen: die Sprache ist ein fundamentaler Schlüssel dazu.
Basil Bernstein formulierte die Hypothese, dass der Sprachgebrauch die gesellschaftliche Herkunft widerspiegele und in der Folge die spätere gesellschaftliche Stellung beeinflusse.
Sprache scheint also ein äußerst mächtiger Baustein zu sein, um sich die Welt anzueignen und sie zu verändern.
Kann also auch die gesellschaftliche Gleichstellung von Mann und Frau durch einen bewussteren Sprachgebrauch verbessert werden? Und ist dieser Eingriff in die Alltagssprache eine Form der Diskriminierung, weil er manchmal zu Lasten der Männer geht? Ist Positive Diskriminierung von Frauen in der Sprache dennoch ein legitimes Mittel, um eine Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse herbeizuführen?
Diese Fragen sollen in der vorliegenden Arbeit behandelt werden. Ausgehend von einer Definition der Begriffe „Diskriminierung“ und „Positive Diskriminierung“ soll auf die Wichtigkeit dieser Begrifflichkeiten hingewiesen werden. Im nächsten Schritt wird allgemein Diskriminierung in der Sprache sowie die sprachliche Stellung von Frauen im Deutschen beleuchtet.
Anschließend werden Stärken und Schwächen dargestellt, die in einem Fazit gegeneinander abgewogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Positive Diskriminierung?
- 2.1 Zum Begriff Diskriminierung
- 2.2 Definition Positive Diskriminierung
- 2.3 Synonyme Begrifflichkeiten und Kritik
- 3. Diskriminierung und Sprache
- 3.1 Diskriminierung als sprachliches Grundprinzip
- 3.2 Wie Sprache diskriminierende Handlungen beeinflusst
- 3.3 Die deutsche Sprache ist männlich
- 4. Gendern als Positive Diskriminierung in der Sprache
- 4.1 Stärken gendergerechter Sprache
- 4.2 Schwächen gendergerechter Sprache
- 4.3 Maßnahmen zur Implementierung gendergerechter Sprache
- 4.4 Fazit: Sinnvolle Maßnahmen Positiver Diskriminierung in der Sprache
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Legitimität der positiven Diskriminierung von Frauen in der Sprache, insbesondere durch gendergerechte Sprache. Sie beleuchtet die Frage, ob ein bewussterer Sprachgebrauch die gesellschaftliche Gleichstellung von Männern und Frauen verbessern kann und ob dies eine Form der Diskriminierung darstellt.
- Definition und Anwendung des Begriffs "Positive Diskriminierung"
- Der Zusammenhang zwischen Diskriminierung und Sprache
- Die sprachliche Benachteiligung von Frauen im Deutschen
- Stärken und Schwächen gendergerechter Sprache
- Möglichkeiten zur Implementierung gendergerechter Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sprachlichen Gleichstellung von Männern und Frauen ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Legitimität positiver Diskriminierung in der Sprache. Sie verweist auf den Einfluss von Sprache auf Sozialisation und gesellschaftliche Stellung und argumentiert für die Relevanz der Untersuchung, wie bewussterer Sprachgebrauch die gesellschaftliche Gleichberechtigung fördern kann.
2. Was ist Positive Diskriminierung?: Dieses Kapitel beginnt mit einer Auseinandersetzung mit dem Begriff „Diskriminierung“ und seiner Entwicklung von einer neutralen Unterscheidung zu einer herabwürdigenden Bewertung. Es definiert „Positive Diskriminierung“ als beabsichtigte Ungleichbehandlung mit dem Ziel, bestehende Benachteiligung auszugleichen und gesellschaftliche Gleichstellung zu fördern. Der Unterschied zu negativer Diskriminierung wird verdeutlicht und kritische Aspekte werden angerissen.
3. Diskriminierung und Sprache: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Diskriminierung und Sprache, indem es Diskriminierung als sprachliches Grundprinzip darstellt und aufzeigt, wie Sprache diskriminierende Handlungen beeinflusst. Es wird die männlich geprägte deutsche Sprache analysiert und die damit verbundene Benachteiligung von Frauen hervorgehoben.
4. Gendern als Positive Diskriminierung in der Sprache: Dieses Kapitel behandelt das Gendern als Methode der positiven Diskriminierung. Es werden sowohl die Stärken (z.B. der Weg zur Gleichberechtigung durch Vermeidung des generischen Maskulinums und die gedankliche Einbeziehung von Frauen) als auch die Schwächen (z.B. Einbußen in der Leserlichkeit und zwanghafte Umschreibungen) gendergerechter Sprache diskutiert. Schließlich werden Maßnahmen zur Implementierung gendergerechter Sprache vorgeschlagen.
Schlüsselwörter
Positive Diskriminierung, Gendergerechte Sprache, Sprachliche Gleichstellung, Diskriminierung, Frauen, Männer, Gesellschaftliche Gleichstellung, Generisches Maskulinum, Chancengleichheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Positive Diskriminierung in der Sprache"
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Legitimität positiver Diskriminierung von Frauen in der Sprache, insbesondere durch gendergerechte Sprache. Sie beleuchtet, ob bewussterer Sprachgebrauch die gesellschaftliche Gleichstellung verbessert und ob dies selbst eine Form der Diskriminierung darstellt.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Anwendung von "Positiver Diskriminierung", den Zusammenhang zwischen Diskriminierung und Sprache, die sprachliche Benachteiligung von Frauen im Deutschen, Stärken und Schwächen gendergerechter Sprache sowie Möglichkeiten zur Implementierung gendergerechter Sprache.
Wie wird der Begriff "Positive Diskriminierung" definiert?
Die Arbeit definiert "Positive Diskriminierung" als beabsichtigte Ungleichbehandlung, um bestehende Benachteiligung auszugleichen und gesellschaftliche Gleichstellung zu fördern. Der Unterschied zu negativer Diskriminierung wird herausgestellt, und kritische Aspekte werden diskutiert.
Welchen Zusammenhang stellt die Arbeit zwischen Diskriminierung und Sprache her?
Die Arbeit präsentiert Diskriminierung als sprachliches Grundprinzip und zeigt auf, wie Sprache diskriminierende Handlungen beeinflusst. Die männlich geprägte deutsche Sprache wird analysiert und die damit verbundene Benachteiligung von Frauen hervorgehoben.
Welche Vor- und Nachteile gendergerechter Sprache werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Stärken gendergerechter Sprache, wie z.B. den Weg zur Gleichberechtigung durch Vermeidung des generischen Maskulinums und die gedankliche Einbeziehung von Frauen. Gleichzeitig werden Schwächen wie Einbußen in der Leserlichkeit und zwanghafte Umschreibungen angesprochen.
Welche Maßnahmen zur Implementierung gendergerechter Sprache werden vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt Maßnahmen zur Implementierung gendergerechter Sprache vor, obwohl die konkreten Maßnahmen nicht im bereitgestellten Auszug detailliert beschrieben sind.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Positive Diskriminierung, Gendergerechte Sprache, Sprachliche Gleichstellung, Diskriminierung, Frauen, Männer, Gesellschaftliche Gleichstellung, Generisches Maskulinum, Chancengleichheit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von Positiver Diskriminierung, ein Kapitel zum Zusammenhang von Diskriminierung und Sprache, und ein Kapitel zu Gendern als positiver Diskriminierung in der Sprache. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung separat erläutert.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit folgt einer klaren Struktur mit Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung und Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörtern. Dies ermöglicht eine systematische Auseinandersetzung mit dem Thema.
- Quote paper
- Hermann Fuchs (Author), 2018, Die sprachliche Gleichstellung von Männern und Frauen durch gendergerechte Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418510