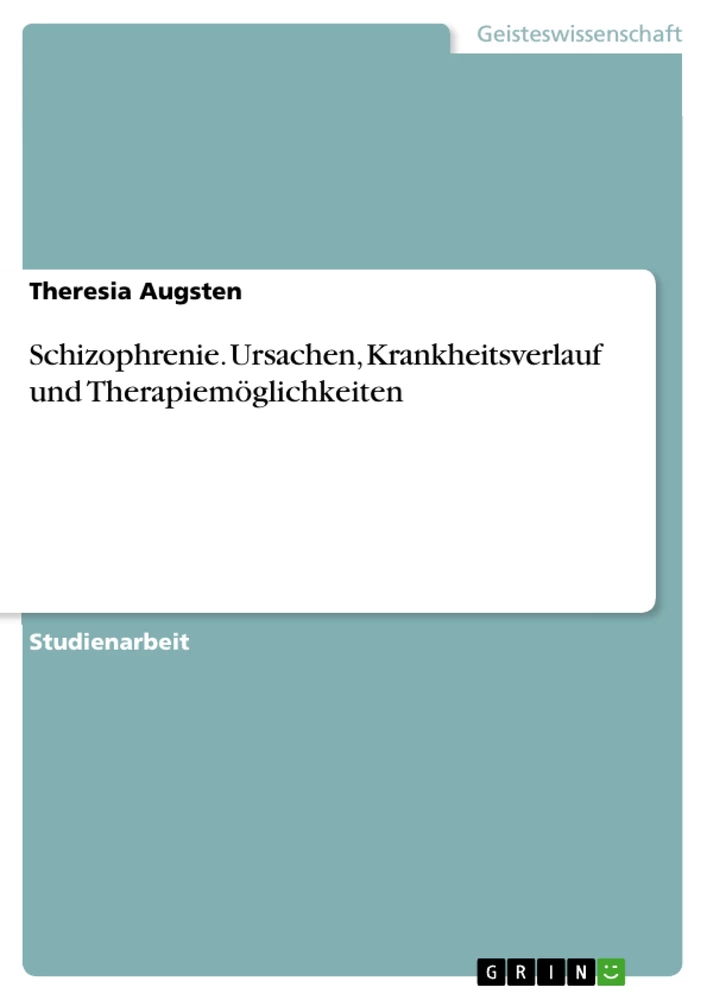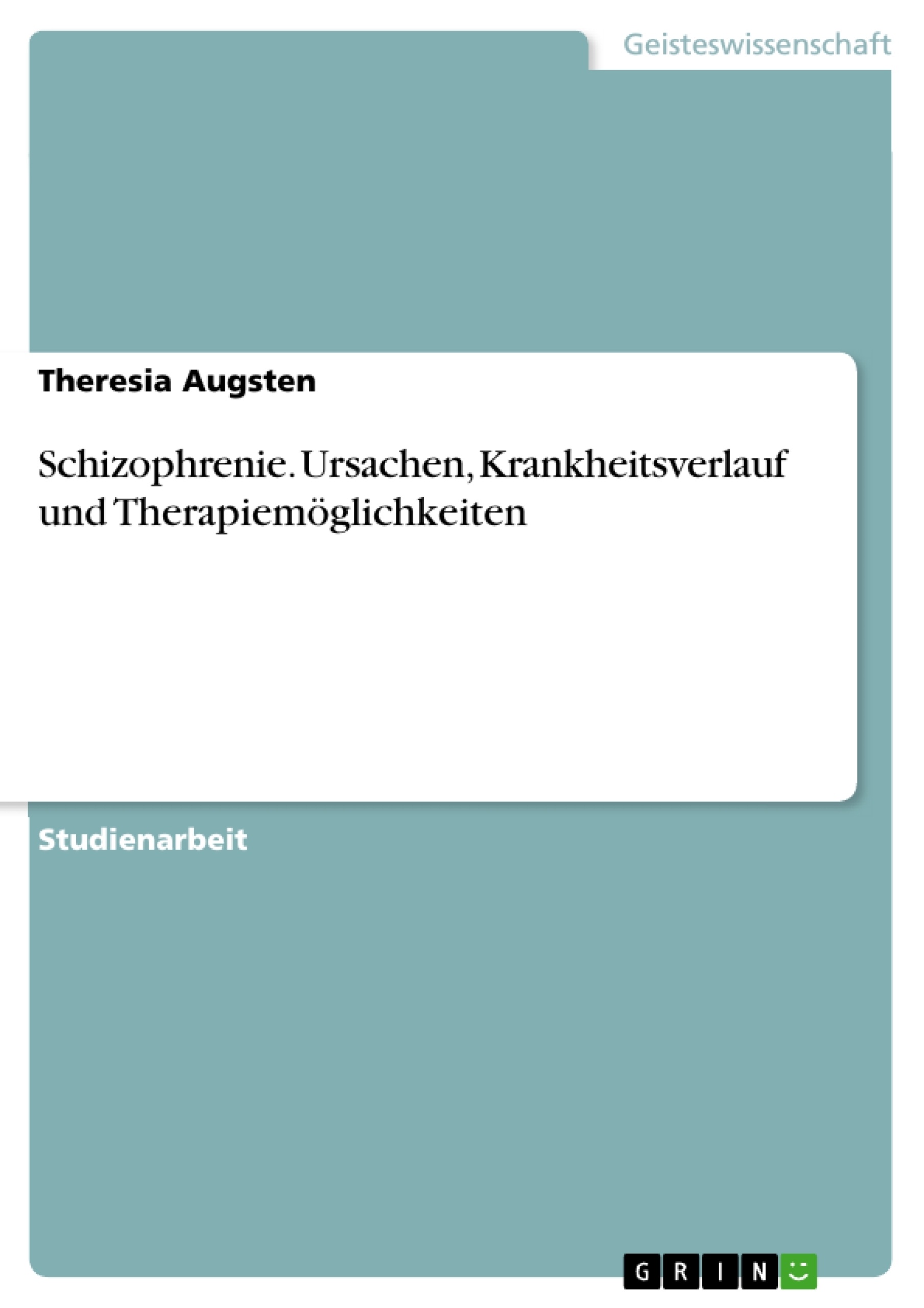Es geht in dieser Hausarbeit um das Thema Schizophrenie. Das Wort und Krankheitsbild Schizophrenie ist auch heute noch mit vielen Vorurteilen besetzt. Kaum jemand weiß, was sich tatsächlich hinter dieser Krankheit verbirgt. Ich möchte diese Hausarbeit nutzen, um das Krankheitsbild der Schizophrenie näher zu beleuchten. Da ein Arbeitsfeld der Sozialarbeit/Sozialpädagogik die Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen ist, ist es auch wichtig, mehr über diese Krankheit zu erfahren und sie somit auch als solche zu erkennen. Durch das Seminar „Soziale Arbeit und sozialpsychiatrische Perspektiven“, sowie durch einen Fall von schizophrener Erkrankung in meinem Bekanntenkreis, entstand bei mir der Wunsch mich näher mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Schizophrenie hat viele Ausprägungen und kann hier nicht in all ihren Aspekten geschildert werden. Ich möchte diese Hausarbeit mit einem Rückblick auf die Begriffsdefinition „Schizophrenie“ beginnen. Im weiteren Verlauf geht es um die Häufigkeiten und die Krankheitsursachen. Ferner möchte ich mich auch den Entstehungsbedienungen widmen, wobei ich mich aber hauptsächlich auf sozialpsychiatrische beziehungsweise psychologische Ansätze beschränken möchte. Nachfolgende Kapitel beschäftigen sich dann mit den Symptomen, den verschiedenen Unterformen der Schizophrenie, dem Verlauf der Krankheit und Therapieformen. Den Abschluss dieser Hausarbeit wird eine Anlehnung an das erwähnte Seminar bilden. Speziell möchte ich dabei auf eine alternative Möglichkeit zum Psychiatrieaufenthalt eingehen – dem Berliner Weglaufhaus.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschichte der (heute) „Schizophrenie(n)“ genannten Ich-Krankheit
- 2.1. Emil Kraeplin
- 2.2. Eugen Bleuler
- 3. Häufigkeiten
- 4. Entstehungsbedingungen und Krankheitsursachen
- 4.1. Sozialpsychiatrische und psychologische Konzepte
- 4.1.1. Etikettierungstheorie
- 4.1.2. Soziale Schicht und psychische Krankheit
- 4.1.3. Life Events - Lebensverändernde Ereignisse
- 4.1.4. Schizophrenie und Familie
- 4.2. Biologisch-psychiatrischer Ansatz
- 4.2.1. Vererbung
- 4.1. Sozialpsychiatrische und psychologische Konzepte
- 5. Symptomatik
- 5.1. Grundsymptome
- 5.1.1. Formale Denkstörungen – Störungen des Denkens
- 5.1.2. Störung der Affektivität – Störung des Gefühls
- 5.1.3. Störung des Wollens, des Handelns und Störungen des Ich-Erlebens
- 5.2. Akzessorische Symptome
- 5.2.1. Wahn
- 5.2.2. Halluzinationen
- 5.2.3. Katatone Symptome
- 5.1. Grundsymptome
- 6. Unterformen der Schizophrenie
- 6.1. Hebephrenie
- 6.2. Paranoide Schizophrenie
- 6.3. Schizophrenia simplex
- 6.4. Katatonie
- 6.5. Residuelle Form
- 7. Verlauf
- 7.1. Beginn der Erkrankung
- 7.2. Verlaufstyp
- 7.3. Endzustand
- 7.4. Häufigkeit der verschiedenen Verlaufsformen
- 8. Therapie
- 8.1. Medikation
- 8.2. Psychotherapie
- 8.3. Soziotherapie
- 9. Das Berliner Weglaufhaus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit zielt darauf ab, das Krankheitsbild der Schizophrenie umfassend zu beleuchten und sozialpsychiatrische Perspektiven aufzuzeigen. Sie soll das Verständnis für Schizophrenie fördern und die Bedeutung sozialer Aspekte bei der Entstehung und Bewältigung der Erkrankung hervorheben.
- Historische Entwicklung des Schizophreniebegriffs
- Entstehungsbedingungen und Ursachen von Schizophrenie (biologisch-psychiatrische und sozialpsychiatrische Ansätze)
- Symptome und Unterformen der Schizophrenie
- Verlauf und Therapieformen der Schizophrenie
- Alternative Behandlungsansätze (z.B. Berliner Weglaufhaus)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Schizophrenie ein, betont die bestehenden Vorurteile und die Bedeutung des Verständnisses der Erkrankung im Kontext sozialer Arbeit. Die Arbeit kündigt den Aufbau an, der von der historischen Begriffsdefinition über Häufigkeiten und Ursachen bis hin zu Symptomen, Verlaufsformen und Therapieoptionen reicht. Besondere Erwähnung findet das Berliner Weglaufhaus als alternatives Therapiemodell.
2. Geschichte der (heute) „Schizophrenie(n)“ genannten Ich-Krankheit: Dieses Kapitel skizziert die historische Entwicklung des Schizophreniebegriffs, indem es die Beiträge bedeutender Persönlichkeiten wie Emil Kraeplin und Eugen Bleuler beleuchtet und deren unterschiedliche Konzepte zur Definition und Klassifizierung der Erkrankung darstellt. Es zeigt die Entwicklung des Verständnisses von Schizophrenie von frühen, oft stigmatisierenden Beschreibungen hin zu differenzierteren Ansätzen.
3. Häufigkeiten: (Annahme: Kapitel enthält Informationen zur Verbreitung von Schizophrenie). Dieses Kapitel präsentiert statistische Daten zur Häufigkeit des Auftretens von Schizophrenie in der Bevölkerung. Es werden wahrscheinlich Daten zu Prävalenz und Inzidenzraten vorgestellt und mögliche Einflussfaktoren auf die Häufigkeitsverteilung diskutiert. Die Daten werden den Kontext für die Bedeutung und den Umfang des Problems liefern.
4. Entstehungsbedingungen und Krankheitsursachen: Dieses Kapitel untersucht die vielschichtigen Faktoren, die zur Entstehung von Schizophrenie beitragen. Es werden sowohl sozialpsychiatrische und psychologische Ansätze (wie Etikettierungstheorie, sozioökonomische Faktoren, Life Events und familiäre Einflüsse) als auch biologisch-psychiatrische Aspekte (wie Vererbung und genetische Faktoren) umfassend behandelt und in ihrer Interaktion analysiert. Die komplexen Wechselwirkungen zwischen biologischen Dispositionen und Umweltfaktoren werden hervorgehoben.
5. Symptomatik: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die vielfältigen Symptome der Schizophrenie. Es differenziert zwischen Grundsymptomen (Denk-, Gefühls- und Willensstörungen) und akzessorischen Symptomen (Wahn, Halluzinationen, katatone Symptome). Die Beschreibung der Symptome ist auf die klinische Präsentation ausgerichtet und veranschaulicht die Bandbreite der möglichen Ausprägungen der Erkrankung. Die Bedeutung der Unterscheidung zwischen den Symptomtypen wird betont.
6. Unterformen der Schizophrenie: Dieses Kapitel widmet sich den verschiedenen Unterformen der Schizophrenie (Hebephrenie, paranoide Schizophrenie, Schizophrenia simplex, Katatonie, residuelle Form), beschreibt deren spezifische Merkmale und Unterschiede. Der Fokus liegt dabei auf der Klassifizierung und der Beschreibung der jeweiligen Symptomkonstellationen. Die Bedeutung der differenzierten Diagnostik wird hervorgehoben.
7. Verlauf: Das Kapitel behandelt den Verlauf der Schizophrenie, beginnend mit dem Erkrankungsbeginn, über verschiedene Verlaufstypen bis hin zum möglichen Endzustand. Es analysiert verschiedene Verlaufsmuster und ihre prognostische Bedeutung. Die Häufigkeit der verschiedenen Verlaufsformen wird ebenfalls erörtert, um ein umfassendes Bild des Krankheitsverlaufs zu vermitteln.
8. Therapie: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Therapieansätze bei Schizophrenie, darunter Medikation, Psychotherapie und Soziotherapie. Es werden die jeweiligen Methoden, ihre Wirkungsweisen und Indikationen sowie die Bedeutung einer ganzheitlichen Therapie erläutert. Die Integration verschiedener therapeutischer Ansätze wird betont.
9. Das Berliner Weglaufhaus: (Annahme: Kapitel beschreibt ein alternatives Behandlungsmodell). Dieses Kapitel beschreibt das Berliner Weglaufhaus als Beispiel für eine alternative Behandlungsmöglichkeit für Menschen mit Schizophrenie, die eine Ergänzung oder Alternative zu traditionellen stationären Behandlungen darstellt. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Modells und seiner spezifischen Ansätze. Die Vorteile und Grenzen dieses Ansatzes werden analysiert und in Bezug zu anderen Behandlungsmethoden gesetzt.
Schlüsselwörter
Schizophrenie, Sozialpsychiatrie, Psychopathologie, Symptome, Verlaufsformen, Therapie, Emil Kraeplin, Eugen Bleuler, Biologische Faktoren, Soziale Faktoren, Etikettierungstheorie, Alternativen Behandlungsmodelle, Berliner Weglaufhaus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Hausarbeit über Schizophrenie
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Krankheitsbild der Schizophrenie. Sie behandelt die historische Entwicklung des Begriffs, Häufigkeiten, Entstehungsbedingungen und Ursachen (biologisch-psychiatrisch und sozialpsychiatrisch), Symptomatik (inklusive Grund- und Akzessorischen Symptomen), Unterformen, Verlauf, Therapieansätze (Medikation, Psychotherapie, Soziotherapie) und ein alternatives Behandlungsmodell (Berliner Weglaufhaus).
Welche historischen Aspekte der Schizophrenie werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Beiträge von Emil Kraeplin und Eugen Bleuler zur Definition und Klassifizierung der Schizophrenie und zeigt die Entwicklung des Verständnisses dieser Erkrankung über die Zeit auf.
Welche Ursachen für Schizophrenie werden diskutiert?
Die Hausarbeit untersucht sowohl biologisch-psychiatrische Ansätze (z.B. Vererbung) als auch sozialpsychiatrische und psychologische Konzepte (z.B. Etikettierungstheorie, soziale Schicht, Life Events, familiäre Einflüsse) zur Entstehung von Schizophrenie und deren Interaktion.
Welche Symptome der Schizophrenie werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Grundsymptome (Denk-, Gefühls- und Willensstörungen) und die akzessorischen Symptome (Wahn, Halluzinationen, katatone Symptome) der Schizophrenie und deren unterschiedliche Ausprägungen.
Welche Unterformen der Schizophrenie werden unterschieden?
Die verschiedenen Unterformen der Schizophrenie, wie Hebephrenie, paranoide Schizophrenie, Schizophrenia simplex, Katatonie und die residuelle Form, werden hinsichtlich ihrer spezifischen Merkmale und Symptomkonstellationen erläutert.
Wie wird der Verlauf der Schizophrenie dargestellt?
Der Verlauf der Schizophrenie wird von Beginn der Erkrankung über verschiedene Verlaufstypen bis zum möglichen Endzustand beschrieben, inklusive der Häufigkeit der verschiedenen Verlaufsformen.
Welche Therapieansätze werden vorgestellt?
Die Hausarbeit beleuchtet verschiedene Therapieansätze, einschließlich Medikation, Psychotherapie und Soziotherapie, deren Wirkungsweisen und die Bedeutung einer ganzheitlichen Therapie.
Was ist das Berliner Weglaufhaus?
Das Berliner Weglaufhaus wird als Beispiel für ein alternatives Behandlungsmodell für Menschen mit Schizophrenie vorgestellt, das als Ergänzung oder Alternative zu traditionellen stationären Behandlungen dient. Seine Ansätze, Vorteile und Grenzen werden analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Schizophrenie, Sozialpsychiatrie, Psychopathologie, Symptome, Verlaufsformen, Therapie, Emil Kraeplin, Eugen Bleuler, Biologische Faktoren, Soziale Faktoren, Etikettierungstheorie, Alternative Behandlungsmodelle, Berliner Weglaufhaus.
Für wen ist diese Hausarbeit gedacht?
Diese Hausarbeit richtet sich an ein akademisches Publikum und dient der Analyse von Themen im Zusammenhang mit Schizophrenie.
- Quote paper
- Theresia Augsten (Author), 2005, Schizophrenie. Ursachen, Krankheitsverlauf und Therapiemöglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41794