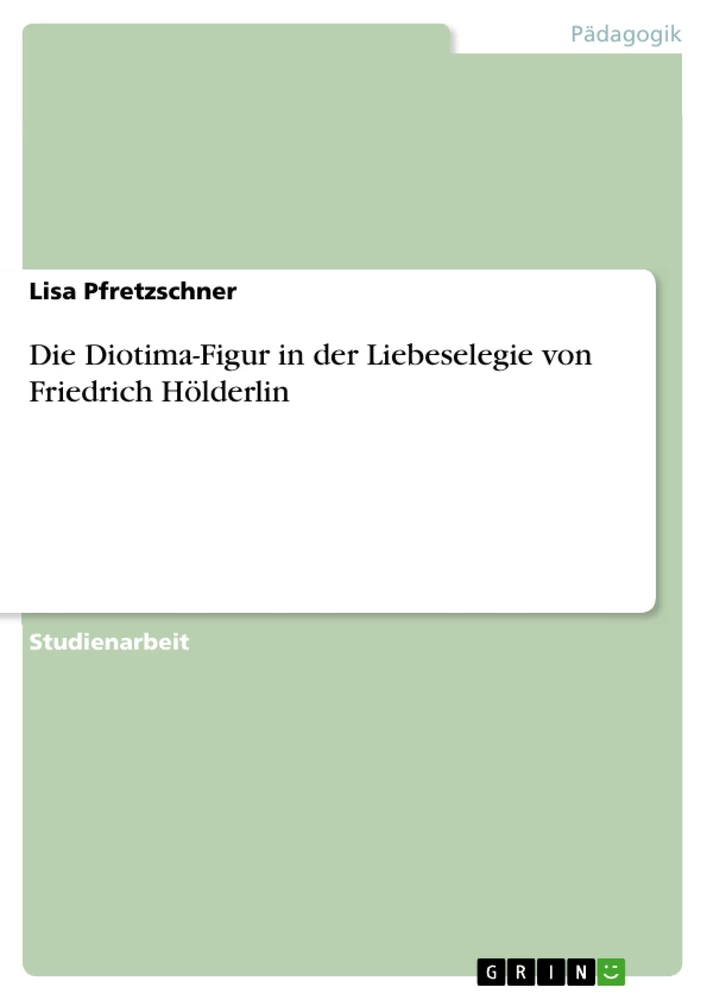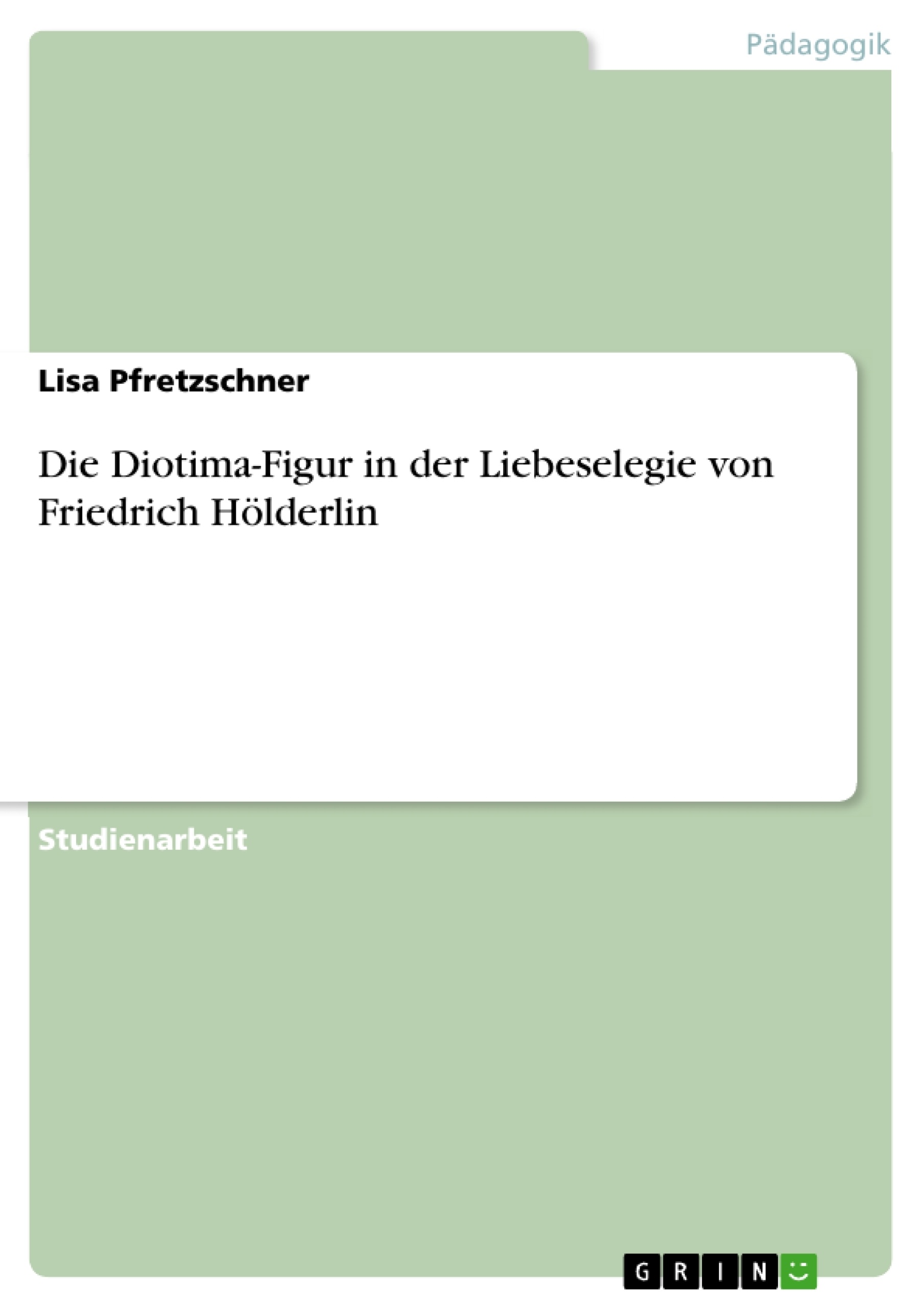In dieser Arbeit setze ich mich mit dem Leben des Dichters Friedrich Hölderlin auseinander und nehme insbesondere Bezug auf seine Diotima-Figur. Im Zuge der Auseinandersetzung mit der Elegie Menons Klagen um Diotima von Hölderlin, stellte sich die Frage, wie die Komponenten des Titels zustande kamen.
Ich erachte es für wichtig, einen groben Überblick über das Leben des Autors Hölderlin zu geben, um später auch Zusammenhänge mit seinen literarischen Werken deutlicher machen zu können. Zudem werde ich eine Einführung in den allgemeinen Elegiebegriff geben.
Um die Figur der Diotima und auch die Bedeutung des Menon begreiflicher zu machen, stelle ich im Hauptteil der Arbeit darüber hinaus den Bezug zu Platon her, bei dem die Namen dieser zum ersten Mal auftauchen. Dabei greife ich Platons Werke Symposion und Menon auf, wobei ich zum besseren Verständnis kurz und knapp auf den Inhalt dieser eingehen möchte. Ebenso nehme ich Bezug zu Hölderlins Werk Hyperion, um Verweise auf nachfolgende Texte herzustellen.
Danach werde ich die vorangegangenen Ausführungen erfassen und die gesammelten Informationen in Zusammenhänge bringen. Der Schlussteil soll dazu dienen, eine knappe Zusammenfassung zu liefern und noch einmal Bezug auf die Einleitung meiner Arbeit zu nehmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Biographischer Abriss
- 2.2 Aufbau und Inhalt der Elegie Menons Klagen um Diotima
- 2.2.1 Vorbemerkungen zum Elegiebegriff
- 2.2.2 Menons Klagen um Diotima (um 1800)
- 2.3 Bezug zu Platon
- 2.3.1 Vorbemerkungen
- 2.3.2 Symposion (383 v. Chr.)
- 2.3.3 Menon (ca. 402 v. Chr.)
- 2.4 Rolle des Hyperion
- 2.5 Zusammenfassung
- 3. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Diotima-Figur in Friedrich Hölderlins Werk, insbesondere im Kontext der Elegie "Menons Klagen um Diotima". Die Zielsetzung ist es, Hölderlins Leben und Werk in Beziehung zu setzen und die Entstehung der Komponenten des Titels der Elegie zu beleuchten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Klärung des Elegiebegriffs und dem Bezug zu Platons Werken "Symposion" und "Menon".
- Biographischer Kontext von Friedrich Hölderlins Leben und Werk
- Analyse der Elegie "Menons Klagen um Diotima"
- Definition und Entwicklung des Elegiebegriffs
- Bezug zu Platons Philosophie und seinen Figuren Diotima und Menon
- Die Rolle des Hyperion im Gesamtwerk Hölderlins
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat aus einem Brief Susette Gontards an Hölderlin, das die emotionale Grundlage der Arbeit andeutet. Sie beschreibt das Ziel der Arbeit: die Auseinandersetzung mit Hölderlins Leben und seiner Diotima-Figur, insbesondere im Bezug auf die Elegie "Menons Klagen um Diotima". Es wird die Notwendigkeit eines biographischen Überblicks und einer Einführung in den Elegiebegriff begründet, um die spätere Analyse zu erleichtern. Der Bezug zu Platon und seinem Werk wird angekündigt, ebenso wie die Einbeziehung von Hölderlins "Hyperion". Abschließend wird die Struktur der Arbeit skizziert, mit einer Zusammenfassung im Schlussteil.
2. Hauptteil: Der Hauptteil beginnt mit einem biographischen Abriss von Friedrich Hölderlins Leben, beginnend mit seiner Geburt und Schulzeit bis hin zu seinem Studium in Tübingen und seiner Beziehung zu Susette Gontard. Der Abschnitt beleuchtet den Einfluss der Französischen Revolution und Napoleons auf sein Werk. Es folgt eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Aufbau und Inhalt der Elegie "Menons Klagen um Diotima", inklusive einer Diskussion des Elegiebegriffs und seiner Entwicklung. Der Bezug zu Platons "Symposion" und "Menon" wird hergestellt, um die Figuren Diotima und Menon zu erklären. Schließlich wird die Rolle des Hyperion in Hölderlins Werk beleuchtet, um Verbindungen zu anderen Texten herzustellen.
Schlüsselwörter
Friedrich Hölderlin, Diotima, Menon, Elegie, Platon, Symposion, Hyperion, Biographischer Abriss, Literaturanalyse, Lyrik, Französische Revolution, Susette Gontard.
Häufig gestellte Fragen zu "Menons Klagen um Diotima": Eine Analyse von Friedrich Hölderlins Werk
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Figur Diotima in Friedrich Hölderlins Werk, insbesondere in seiner Elegie "Menons Klagen um Diotima". Sie untersucht den biographischen Kontext, die Entstehung des Titels, den Elegiebegriff und den Bezug zu Platons Werken "Symposion" und "Menon".
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Hölderlins Biografie und sein Werk, die detaillierte Analyse der Elegie "Menons Klagen um Diotima", die Definition und Entwicklung des Elegiebegriffs, die Beziehung zu Platons Philosophie und Figuren (Diotima und Menon), sowie die Rolle des Hyperion in Hölderlins Gesamtwerk.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Der Hauptteil umfasst einen biographischen Abriss Hölderlins, eine Analyse des Aufbaus und Inhalts der Elegie, eine Auseinandersetzung mit dem Elegiebegriff, den Bezug zu Platons "Symposion" und "Menon" und die Rolle des Hyperion. Die Einleitung enthält ein Zitat von Susette Gontard und skizziert die Zielsetzung und Struktur der Arbeit. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Bedeutung haben Platons "Symposion" und "Menon" für die Analyse?
Platons "Symposion" und "Menon" sind zentral für das Verständnis der Elegie "Menons Klagen um Diotima". Sie liefern den Kontext für die Figuren Diotima und Menon und helfen, die philosophischen und literarischen Bezüge in Hölderlins Werk zu verstehen. Die Arbeit untersucht die Verbindungen zwischen Hölderlins Werk und Platons Philosophie.
Welche Rolle spielt Hyperion in dieser Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet die Rolle des Hyperion im Gesamtwerk Hölderlins und untersucht mögliche Verbindungen zwischen "Menons Klagen um Diotima" und anderen Texten. Hyperion wird im Kontext der Gesamtinterpretation von Hölderlins Werk betrachtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Hölderlin, Diotima, Menon, Elegie, Platon, Symposion, Hyperion, Biographischer Abriss, Literaturanalyse, Lyrik, Französische Revolution, Susette Gontard.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Hölderlins Leben und Werk in Beziehung zu setzen und die Entstehung der Komponenten des Titels der Elegie "Menons Klagen um Diotima" zu beleuchten. Sie klärt den Elegiebegriff und den Bezug zu Platons Werken.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der Einleitung und des Hauptteils. Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Der Hauptteil fasst den biographischen Abriss, die Analyse der Elegie, den Bezug zu Platon und die Rolle des Hyperion zusammen.
- Quote paper
- Lisa Pfretzschner (Author), 2016, Die Diotima-Figur in der Liebeselegie von Friedrich Hölderlin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/417920