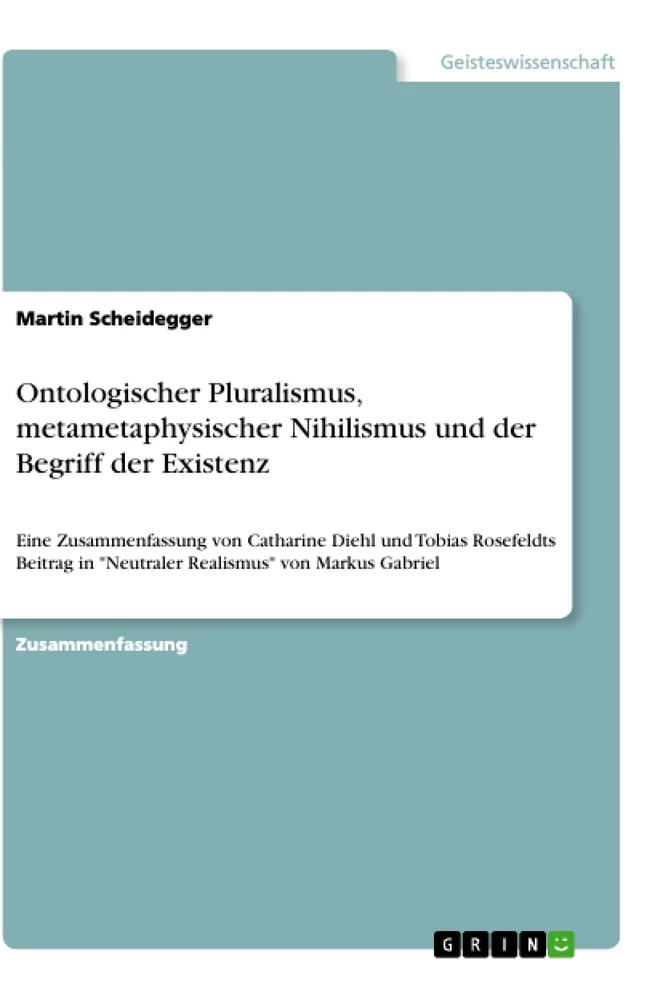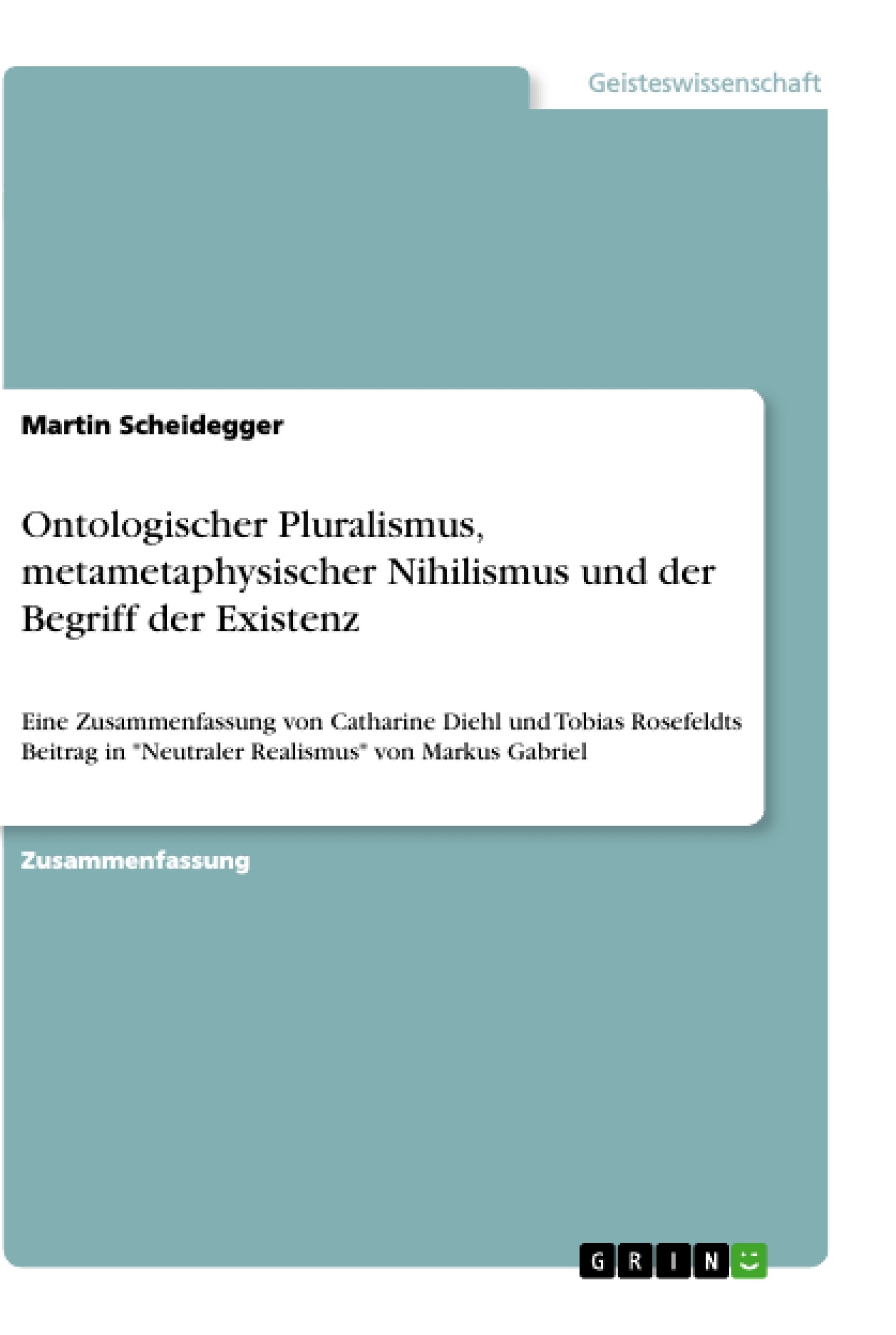Diese Zusammenfassung behandelt den Beitrag von Catharine Diehl und Tobias Rosefeldt in "Neutraler Realismus" von Markus Gabriel. Catharine Diehl und Tobias Rosefeldt behandeln den ontologischen Pluralismus, den metametaphysischen Nihilismus sowie Markus Gabriels Begriff der Existenz und prüfen, ob Gabriels Ansatz ("Neutraler Realismus") dem Niveau der aktuellen Fachdebatten gerecht werden kann. Sie kommen dabei zu einem negativen Resultat. Gabriel verteidigt seinen Ansatz daraufhin in einer Replik gegen die Kritik von Diehl und Rosefeldt.
Gibt es den neuen Realismus?
Catharine Diehl/Tobias Rosefeldt (Humboldt-Universitt zu Berlin)
In: T. Buchheim (Hg.). 2016. Neutraler Realismus. Freiburg/Mnchen: Alber, 46-65.
Diehl und Rosefeldt behandeln den ontologischen Pluralismus, den metametaphysischen Nihilismus sowie Gabriels Begriff der Existenz und prfen, ob Gabriels Ansatz dem Niveau der aktuellen Fachdebatten gerecht werden kann.
I. Ontologischer Pluralismus
Diehl und Rosefeldt ziehen Gabriels W rfelallegorie heran, die von zwei Beschreibungen ausgeht:
(1) Es gibt in dem Szenario n Elementarteilchen.
(2) Es gibt in dem Szenario drei Wrfel.
Den ontologischen Pluralismus rekonstruieren Diehl und Rosefeldt anhand dieses Beispiels als eine Kombination von (mindestens) sechs Annahmen:
(a) Wahrheit: (1) und (2) sind wahr. Selbst physikalistische Reduktionisten leugnen die Wahrheit von (2) nicht.
Da diese These selten bestritten wird, ist sie nicht wirklich interessant.
(b) Realismus: (1) und (2) wren auch dann wahr gewesen, wenn es keine Sprecher/Denker gegeben htte.
Dieser These stimmen Diehl und Rosefeldt zu. Sie ist aber auch nicht besonders interessant, da es heutzutage kaum Philosophen gebe, die sie bestreiten.
(c) Gleichwertigkeit: In ontologischer Hinsicht gibt es keinen hierarchischen Unterschied zwischen (1) und (2). Keine der Beschreibungen ist an sich besser als die andere.
Diehl und Rosefeldt finden bei Gabriel keine Argumente fr diese These, obwohl dies ntig wre, da auch andere Positionen (a) vertreten, aber dafr argumentieren, dass manche Entitten fundamentaler als andere sind, oder dafr, dass sich Quantoren hinsichtlich ontologischer Verpflichtung unterschiedlich interpretieren lassen.
(d) Sinnfeldabhngigkeit: Zu existieren bedeutet, in einem Sinnfeld zu erscheinen.
Diehl und Rosefeldt ist es nicht gelungen, zu verstehen, was ein Sinnfeld ist. Die Anlehnung an Freges Unterscheidung von Sinn und Bedeutung sei irrefhrend. Ferner sei Gabriels Prmisse, dass sich kein Ding von allen anderen Dingen allein durch dessen numerische Verschiedenheit von diesen unterscheiden lsst, begrndungsbedrftig, da sie gegenwrtig kontrovers diskutiert wird.
Gabriels These, dass es uninteressant fr uns sei, wenn wir nichts ber einen Gegenstand wssten, als von welchen Gegenstnden er sich numerisch unterscheidet, stelle eine unzulssige Verwechslung von psychologischen/epistemologischen und ontologischen Problemen dar, weshalb sie keinerlei argumentative Kraft habe.
(e) Partialitt: (1) und (2) beschreiben nicht dasselbe. Elementarteilchen und Wrfel gehren zu verschiedenen Bereichen.
Es gibt eine schwache Lesart dieser These, die philosophisch unspektakulr ist, und eine nicht-triviale st rkere Lesart, zu der man gelangt, wenn man den Begriff des Bereichs nher spezifiziert. Letzteres scheint bei Gabriel der Fall zu sein. Zum einen trgt Gabriels Argumentation an einigen Stellen idealistische Zge, die einer Begrndung bedrfen, insofern behauptet wird, dass Gegenstandsbereiche durch die Sinne mitkonstituiert seien, vermittels derer wir auf die Gegenstnde in ihnen Bezug nehmen. Des Weiteren sei die Annahme der Unabh ngigkeit von Gegenstandsbereichen hoch kontrovers.
(f) Kontinuitt: Es gibt in ontologischer Hinsicht eine Kontinuitt zwischen deskriptiver und fiktionaler Rede. D.h. nicht nur wissenschaftliche, sondern auch fiktionale Entitten existieren.
Gabriel scheint hier fr einen fiktionalen Realismus zu pldieren, wobei die meisten Vertreter dieser Position einen hheren Anspruch in Bezug auf die angemessene Rechtfertigung dieser Theorie haben. Gabriel beachtet laut Diehl und Rosefeldt nicht die Feinheiten der Debatte.
Laut den meisten fiktionalen Realisten verpflichtet uns die Wahrheit meta-fiktionaler Aussagen - wie Faust wurde von Goethe erfunden - auf ihre Position. Fiktionale Gegenstnde knnen demnach als abstrakte Entitten aufgefasst werden, die nicht (wirklich) die Eigenschaften haben, die ihnen in den Fiktionen zugesprochen werden (sie werden durch sie hchstens in gewisser Weise charakterisiert). Bei Gabriel liest es sich hingegen so, als ob die fiktionalen Gegenstnde konkrete Entitten seien, die tatschlich die Eigenschaften haben, die ihnen zugesprochen werden. (f) ist laut Diehl und Rosefeldt in dieser Lesart unbegrndet und problematisch, da die fiktionalen Eigenschaften als exemplifiziert statt blo als charakterisierend angenommen werden.
Zudem kann man in diesem Ansatz sogar einen antirealistischen Zug ausmachen, der Gabriels Intention eigentlich zuwiderlaufen msste: Existieren nmlich Elementarteilchen nur, weil Physiker das behaupten, so wie Mephisto existiert, weil er in Goethes Faust vorkommt?
II. Metametaphysischer Nihilismus
Der metametaphysische Nihilismus, den Gabriel vertritt, besagt, dass es keine Welt, d.h. unrestringierte Totalitt, gibt. Damit will er sich sowohl vom metaphysischen Realismus als auch vom metaphysischen Antirealismus abgrenzen, die beide das Gegenteil behaupten (weshalb sie berhaupt metaphysisch genannt werden).
Fr die These, dass es keine unrestringierte Totalitt aller Dinge gebe, schlagen Diehl und Rosefeldt vier Lesarten vor, wobei sich letztlich herausstellt, dass ihnen keine dieser Lesarten plausibel erscheint und folglich unklar bleibt, was die These berhaupt besagen soll:
(1) Es gibt keine Menge aller Dinge, welche Elemente dieser Menge wren.
Dass Gabriel (1) vertritt, scheint ihnen nicht plausibel zu sein, da ein breiter Konsens herrscht, dass die Annahme einer Menge aller Dinge inkompatibel mit den meisten gngigen Mengentheorien ist, und somit (1) keine interessante These darstellt. Ebenfalls unkontrovers wre es, wenn Gabriel die zwei Thesen bestreiten wrde, dass die Quantifikation ber Objekte immer die Existenz eines weiteren Objekts voraussetzt, dem diese angehren (All-in-One-Prinzip), und dass es zudem noch absolut unrestringierte Quantifikation gibt, da die Kombination dieser Thesen trivialerweise inkohrent sei und keiner sie vertrete.
(2) Es gibt keine mereologische Summe aller Dinge, welche Teile dieses Ganzen wren. Auch dass Gabriel (2) vertreten will, scheint Diehl und Rosefeldt angesichts der folgenden berlegungen unplausibel zu sein.
Wenn man in (2) unter Teile nur echte Teile versteht, ist (2) trivialerweise korrekt, da es nichts geben kann, von dem alles - und damit auch es selbst - ein echter Teil ist. Metaphysisch interessant und umstritten ist erst die These, dass es nichts gibt, von dem alles andere ein echter Teil ist, was aber selbst nicht Teil eines anderen ist. Der mereologische Universalismus (fr alle Objekte gibt es ein Objekt, dessen Teil sie sind) ist Diehl und Rosefeldt zufolge eine Position, die davon betroffen wre, da sie solch ein maximales Objekt annehmen muss, das aus allen anderen Objekten besteht. Mereologische Nihilisten und moderate Positionen lehnen ein solches Objekt aber ab. Jedoch werden auch solche Positionen von Gabriel dem metaphysischen Realismus zugeordnet, was dagegenspricht, dass Gabriel These (2) im Sinn hatte.
(3) Absolut unrestringierte Quantifikation, d.h. ber Objekte jeglicher Art, ist nicht mglich.
Ein Grund, warum man (3) vertreten knnte, besteht darin, dass absolut unrestringierte Quantifikation in Kombination mit einem Komprehensionsprinzip der Mengentheorie zu Russells Antinomie fhrt (die Klasse aller Klassen, die sich nicht selbst als Element enthalten).
Es finden sich bei Gabriel aber keine (neuen) Argumente, die fr die Lesart (3) sprechen. Zudem schliet die Gegenthese, dass absolut unrestringierte Quantifikation m glich ist, nicht aus, dass auch restringierte Quantifikation mglich ist, weshalb diese Position z.B. auch kompatibel mit den beiden Beschreibungen in der W rfelallegorie ist.
(4) Es gibt keinen sinnfeldneutralen Sinn von Existenz.
Man knnte einwenden, dass sich ein sinnfeldneutraler Sinn von Existenz disjunktiv gewinnen liee. Existenz im Allgemeinen wre dann die Disjunktion der unendlich vielen sinnfeldspezifischen Arten von Existenz. Das scheint auch zu Gabriels These zu passen, dass Existenz das Erscheinen in irgendeinem Sinnfeld bedeutet.
Im Anschluss daran prfen Diehl und Rosefeldt ein Argument aus Gabriels Bestseller Warum es die Welt nicht gibt, in dem er die Nichtexistenz der Welt dadurch begrndet, dass es kein letztes und umfassendstes Sinnfeld aller Sinnfelder geben kann. (Ganz nebenbei problematisieren Diehl und Rosefeldt auch, dass demnach das Argument fr den metametaphysischen Nihilismus von der Akzeptanz der Sinnfeldontologie abhngig gemacht wird, mit der vielleicht nur wenige mitgehen wrden.)
Da Sinnfelder selbst Gegenstnde sind und Gegenstnde laut Gabriel nur existieren knnen, wenn sie sich hinreichend von anderen unterscheiden, muss ein Sinnfeld immer Teil von etwas anderem (nmlich einem weiteren Sinnfeld) sein, als ihm selbst, und ferner noch mit anderen Sinnfeldern innerhalb des Sinnfeldes, in dem sie erscheinen, kontrastieren.
Ein Sinnfeld aller Sinnfelder htte als Supergegenstand Gabriel zufolge alle Eigenschaften seiner Teile, wodurch er sich von nichts mehr unterschiede. Laut Diehl und Rosefeldt hat die These, dass ein mereologisches Ganzes alle Eigenschaften seiner Teile habe, jedoch absurde Konsequenzen. Z.B. wre ein Hund kugelfrmig, weil dessen Augpfel kugelfrmig sind.
III. Existenz
In diesem Abschnitt zeigen Diehl und Rosefeldt, inwiefern Gabriel einige prominente Thesen ber Existenz, von denen er sich abgrenzen will, missverstanden hat.
(i) Existenz und Quantifikation
Gabriel wirft der modernen (fregeanischen) Logik vor, diese impliziere die Behauptung, dass alles, was existiert, immer z hlbar ist und entsprechend Existenz an quantifizierte Aussagen ber diskrete Gegenstnde gebunden sei. Gabriel meint hingegen, dass z.B. die Frage, ob es Pferde gebe, nicht eine Frage nach der Anzahl der Pferde sei. Diehl und Rosefeldt weisen erstens darauf hin, dass Frege zufolge die Aussage Es gibt Pferde in der Tat eine Antwort auf die Frage nach der Anzahl der Pferde ist, er diese aber nicht als eine vollst ndige Antwort ansieht, da sie keine genaue Anzahl angibt, sondern nur ausschliet, dass die Anzahl der Pferde = 0 ist. Zweitens ist Freges Auffassung von Quantifikation auch mit berabzhlbaren Mengen (z.B. der Menge der reellen Zahlen) vereinbar.
(ii) Existenz und Restriktion
Gabriel zufolge behauptet Kripke, dass fiktionalen Gegenstnden lediglich restringierte Existenz zugesprochen werden kann. Darin sieht Gabriel eine ontologische Abwertung fiktionaler Gegenstnde, die er ablehnt.
Laut Diehl und Rosefeldt unterstellt Gabriel Kripke hier Thesen, die Kripke gerade nicht vertreten will. Kripke will fiktionale Entitten nicht abwerten, sondern darauf hinweisen, dass wir in manchen Kontexten die Quantoren in unseren Aussagen implizit restringieren, z.B. auf den Bereich nicht-fiktionaler Gegenstnde, wodurch auch negative Existenzaussagen ber fiktionale Gegenstnde wahr sein knnen.
(iii) Quantifikation und ontologische Verpflichtung
Gabriel fhrt zwei Beispielstze an, von denen er behauptet, es handele sich dabei um quantifizierte Aussagen, die keine ontologischen Verpflichtungen mit sich bringen: (QA1) Wenn es mehr als sieben Einhrner gegeben htte, htte es mehr als drei gegeben.
(QA2) Sieben fliegende Spaghettimonster sind mchtiger als drei, schon weil sie in der berzahl sind.
(QA1) hat gem Diehl und Rosefeldt als Ganzes die Form eines kontrafaktischen Konditionals und gerade nicht - wie von Gabriel behauptet - die einer quantifizierten Aussage. (QA2) liee sich letztlich hnlich wie (QA1) als ein Konditional interpretieren. Folglich hat Gabriel keinen Beleg dafr erbracht, dass Existenz nichts mit Quantifikation zu tun hat.
Replik auf Diehl/Rosefeldt
Markus Gabriel (Universitt Bonn)
In: T. Buchheim (Hg.). 2016. Neutraler Realismus. Freiburg/Mnchen: Alber, 165-185.
Zu I. Ontologischer Pluralismus
v Ontologischer Pluralismus ist die These, dass es eine Vielzahl von Gegenstandsbereichen (Sinnfeldern) gibt.
v Da Ontologie fr Gabriel in der Erluterung des Sinns von Existenz besteht, soll es sich beim ontologischen Pluralismus um eine Behauptung ber Existenz handeln. Nmlich besagt sie, dass Existenz regionalisiert ist und zwar unabhngig davon, welche diskursiven Unterschiede gemacht werden. D.h. viele Sinnfelder bestehen unabhngig von der Existenz und Ttigkeit des Menschen.
Im Folgenden geht Gabriel auf die sechs Annahmen ein, die Diehl und Rosefeldt als wesentlich fr den ontologischen Pluralismus extrahiert haben:
Zu (a) Wahrheit: Gabriel stimmt der These mehr oder weniger zu.
Zu (b) Realismus: Gabriel stimmt der These zu, versteht aber etwas anderes darunter. Zudem hlt er die These entgegen Diehl und Rosefeldt nicht fr eine Selbstverstndlichkeit in der gegenwrtigen philosophischen Debatte.
Zu (c) Gleichwertigkeit: Gabriel hlt es nicht fr sinnvoll, ber die Frage, ob etwas existiert, hinaus noch zu fragen, in welchem Wirklichkeitsgrad etwas existiert. Gerade um die Idee eines solchen Wirklichkeitsgeflles zwischen Existierendem zu vermeiden, argumentiert er gegen die Auffassung, dass es eine allumfassende Wirklichkeit gibt. Die These des metametaphysischen Nihilismus ist also entgegen Diehls und Rosefeldts Annahme doch an dieser Stelle relevant, da dadurch die alternativen Positionen, die sie hier anfhren, ausgeschlossen werden.
Die Grundidee der Sinnfeldontologie besteht darin, die metametaphysische Frage in die Ontologie zu verlagern. Man gelangt daher erst dann zu der These, dass die Welt nicht existiert, nachdem man eine Theorie der Existenz formuliert hat, die die Anwendungsbedingungen von existiert bestimmt hat.
Zu (d) Sinnfeldabhngigkeit: Die Sinnfeldontologie behauptet, dass es einen restringierten Existenzbegriff gibt (der eine ihm entsprechende Existenzeigenschaft ausdrckt). Der Begriff richtet sich jeweils mindestens auf einen Gegenstandsbereich und wird dann zutreffend prdiziert, wenn der Gegenstandsbereich denjenigen Gegenstand enth lt, dessen Existenz behauptet wird.
Zu (e) Partialitt: Mit der strkeren Lesart dieser These liegen Diehl und Rosefeldt laut Gabriel fast richtig. Gabriel sieht darin jedoch keinen idealistischen Zug und er vertritt auch nicht die These, dass alle Gegenstandsbereiche durch die Sinne mitkonstituiert sind, vermittels derer wir auf die Gegenstnde in ihnen Bezug nehmen, da Gabriels realistischer Position zufolge nicht ausgeschlossen werden kann, dass es viele Sinne gibt, die wir niemals in sprachlicher Form verwenden werden, um durch sie Gegenstnde zu erfassen. Gabriel schliet sich hier Freges Position an, dass Sinne objektiv sind.
In Bezug auf die Annahme der Unabh ngigkeit von Gegenstandsbereichen bestreitet Gabriel die These, dass es z.B. keine exakte physikalische Kopie unseres Sonnensystems geben knnte, in der nicht alles ber die BRD der Fall wre, was tatschlich der Fall ist. Diese Haltung begrndet er durch eine anti-reduktionistische Position.
Zu (f) Kontinuitt: Richtig sei, dass Gabriel behauptet, sowohl wissenschaftliche als auch fiktionale Entitten wrden existieren. Falsch sei die Unterstellung, Gabriel behaupte, wissenschaftliche Diskurse und literarische Werke wrden Sinnfelder konstituieren. Denn Sinnfelder sind laut Gabriel gegeben.
Ebenfalls unzutreffend sei die Annahme, Gabriel vertrete einen fiktionalen Realismus. Gabriel wirft Diehl und Rosefeldt vor, sie wrden die Unterscheidung von fiktionalen und fiktiven Gegenstnden nicht bercksichtigen. Bei ersteren handelt es sich um Gegenstnde, von denen in Texten die Rede ist, die Merkmale erfllen, die sie zur Fiktion machen (z.B. Faust). Bei Letzteren handelt es sich jedoch um bloe Einbildungen.
Diehl und Rosefeldt liegen zumindest richtig darin, dass Gabriel fiktionale Gegenstnde nicht fr abstrakte Entitten hlt (Faust ist also ein wirklicher Mensch). Genealogie: Auch wenn fiktionale Gegenstnde fr Gabriel keine abstrakten Entitten sind, heit das nicht, dass sie durch Ausgedachtwerden zur Existenz kommen, da diese Annahme nmlich in dem Sinnfeld einer Fiktion nicht wahr sein kann. Unbestimmtheit: Daraus, dass fiktionale Gegenstnde in literarischen Werken nicht vollstndig charakterisiert sind, kann man Gabriel zufolge nicht ohne Weiteres schlieen, dass diese Gegenstnde nicht viele weitere Eigenschaften haben, die jedoch nicht explizit gemacht werden.
Widerspr chlichkeit: Selbst wenn eine Fiktion widersprchliche Gegenstnde enthalten sollte, folgt noch nicht, dass dies auf andere Bereich abfrbt, in denen wir einen solchen Widerspruch nicht dulden wrden.
Antirealismus: Gabriel meint, er htte nirgendwo behauptet, dass die Physik ihre Gegenstnde (z.B. Elementarteilchen) durch Aussagen zur Existenz bringt. Die Analogie zur Fiktion hilft Diehl und Rosefeldt an dieser Stelle nicht, und zwar aufgrund der Klrung, die Gabriel zuvor zur Genealogie gegeben hat.
Zu II. Metametaphysischer Nihilismus
Gabriel behandelt in diesem Abschnitt kurz auf kritische Weise die Lesarten der These des metametaphysischen Nihilismus, die Diehl und Rosefeldt angeboten haben.
Zu (1) Menge: Gabriel vertritt diese Lesart nicht, hlt sie entgegen Diehl und Rosefeldt aber nicht fr unkontrovers, da er u.a. nicht der Meinung ist, die Existenz einer Menge aller Dinge sei unvereinbar mit allen vern nftigen Mengentheorien (z.B. Quines).
Zu (2) Mereologie: Gabriel versteht nicht, was dieser mereologische Exkurs eigentlich fr einen Sinn hatte, da Diehl und Rosefeldt doch klar eingesehen htten, dass diese Lesart nichts mit seiner Position zu tun habe.
Zu (3) Absolut unrestringierte Quantifikation: Gabriel teilt manche Vorannahmen der Debatte nicht, wrde entgegen Diehl und Rosefeldt aber nicht ausschlieen, dass seine Sinnfeldontologie dazu einen Beitrag leisten kann.
Zu (4) Sinnfeld: Diese Lesart kommt Gabriels Position am nchsten. Gabriel stimmt auch der Mglichkeit zu, einen abstrakten, disjunktiven Existenzbegriff formulieren zu knnen. Es ist Gabriel zufolge aber nicht ersichtlich, warum dies ein Problem fr seine Sinnfeldontologie und die These des metametaphysischen Nihilismus darstellen sollte, da dafr gezeigt werden msste, inwiefern ein solcher Existenzbegriff auch die Existenz einer Welt sichern wrde.
Zu III. Existenz
Zu (i) Existenz und Quantifikation: Hier verweist Gabriel zum einen auf seine Replik auf Garca, wo er Einwnde und Alternativen zur -These formuliert hat, zum anderen erwhnt er, dass die Quantifikation ber Massen (z.B. Wasser oder Gold) nichts mit der Anzahl bestimmter Gegenstnde zu tun hat.
Zu (ii) Existenz und Restriktion: Da es hier mehr um Kripke-Auslegung geht, wirft Gabriel Diehl und Rosefeldt ebenfalls vor, Kripkes Thesen in Reference and Existence missverstanden zu haben. Entgegen Diehl und Rosefeldt vertrete Kripke die Ansicht, dass Existenz nicht mit Selbstidentitt verwechselt werden drfe.
Hufig gestellte Fragen
Was ist der ontologische Pluralismus laut Diehl und Rosefeldt in Bezug auf Gabriels Ansatz?
Diehl und Rosefeldt rekonstruieren den ontologischen Pluralismus anhand von Gabriels Wrfelallegorie als eine Kombination von sechs Annahmen: Wahrheit, Realismus, Gleichwertigkeit, Sinnfeldabhngigkeit, Partialitt und Kontinuitt. Sie kritisieren, dass Gabriel fr einige dieser Thesen keine ausreichenden Argumente liefere und die Feinheiten der Debatte nicht beachte.
Was ist der metametaphysische Nihilismus nach Gabriel und wie wird er von Diehl und Rosefeldt interpretiert?
Der metametaphysische Nihilismus besagt, dass es keine Welt, d.h. unrestringierte Totalitt, gibt. Diehl und Rosefeldt schlagen vier Lesarten dieser These vor, finden aber keine davon plausibel und bemngeln, dass unklar bleibe, was die These berhaupt besagen soll.
Inwiefern missversteht Gabriel laut Diehl und Rosefeldt prominente Thesen ber Existenz?
Diehl und Rosefeldt argumentieren, dass Gabriel einige Thesen ber Existenz, von denen er sich abgrenzen will, missverstanden hat, insbesondere in Bezug auf Existenz und Quantifikation, Existenz und Restriktion sowie Quantifikation und ontologische Verpflichtung. Sie zeigen auf, dass Gabriels Kritik auf falschen Annahmen ber die Positionen von Frege und Kripke beruht.
Wie reagiert Gabriel auf die Kritik von Diehl und Rosefeldt bezglich des ontologischen Pluralismus?
Gabriel argumentiert, dass der ontologische Pluralismus die These sei, dass es eine Vielzahl von Gegenstandsbereichen (Sinnfeldern) gibt und er eine Behauptung ber Existenz darstellt, da Existenz regionalisiert ist und zwar unabhngig von diskursiven Unterschieden. Er stimmt den sechs Annahmen von Diehl und Rosefeldt teilweise zu, verteidigt aber seine Positionen und korrigiert ihre Interpretationen.
Was antwortet Gabriel auf die Kritik am metametaphysischen Nihilismus?
Gabriel verteidigt seine These des metametaphysischen Nihilismus und kritisiert die Lesarten, die Diehl und Rosefeldt anbieten. Er betont, dass seine Sinnfeldontologie einen Beitrag zur Debatte leisten knne.
Wie rechtfertigt Gabriel seine Position in Bezug auf Existenz und Quantifikation?
Gabriel verteidigt seine Position zur Beziehung zwischen Existenz und Quantifikation, indem er sich auf seine Replik auf Garca bezieht und erwhnt, dass die Quantifikation ber Massen nichts mit der Anzahl bestimmter Gegenstnde zu tun hat. Er betont auch, dass Quantifikation nicht hinreichend fr Existenz sei und lehnt die Reduktion der vielfltigen Gebrauchsweisen von existiert auf ein einheitliches Konzept ab.
Was sind Gabriels Ansichten ber fiktionale Gegenstnde im Vergleich zu Diehl und Rosefeldts Interpretation?
Gabriel unterscheidet zwischen fiktionalen und fiktiven Gegenstnden. Er besteht darauf, dass fiktionale Gegenstnde keine abstrakten Entitten sind und kritisiert Diehl und Rosefeldt dafr, dass sie diese Unterscheidung nicht bercksichtigen. Er argumentiert, dass die Existenz von fiktionalen Gegenstnden nicht davon abhngt, dass sie ausgedacht werden.
Wie rechtfertigt Gabriel die Unabhngigkeit von Gegenstandsbereichen und vermeidet idealistische Zge?
Gabriel argumentiert gegen idealistische Zge, indem er betont, dass seine realistische Position nicht ausschliet, dass es viele Sinne gibt, die wir niemals in sprachlicher Form verwenden werden, um durch sie Gegenstnde zu erfassen. Er schliet sich hier Freges Position an, dass Sinne objektiv sind.
Was ist die Bedeutung der Sinnfeldontologie im Kontext von Gabriels Philosophie?
Die Grundidee der Sinnfeldontologie besteht darin, die metametaphysische Frage in die Ontologie zu verlagern. Dies fhrt zu der These, dass die Welt nicht existiert, nachdem man eine Theorie der Existenz formuliert hat, die die Anwendungsbedingungen von existiert bestimmt hat.
Welche Rolle spielt die Kritik von Diehl und Rosefeldt in Bezug auf Gabriels Positionen zum neuen Realismus?
Die Kritik von Diehl und Rosefeldt dient als Ausgangspunkt fr Gabriel, seine Positionen zum ontologischen Pluralismus, metametaphysischen Nihilismus und zur Existenz zu przisieren und zu verteidigen. Er korrigiert Missverstndnisse und betont die Feinheiten seiner Argumentation.
- Quote paper
- Martin Scheidegger (Author), 2017, Ontologischer Pluralismus, metametaphysischer Nihilismus und der Begriff der Existenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/417820