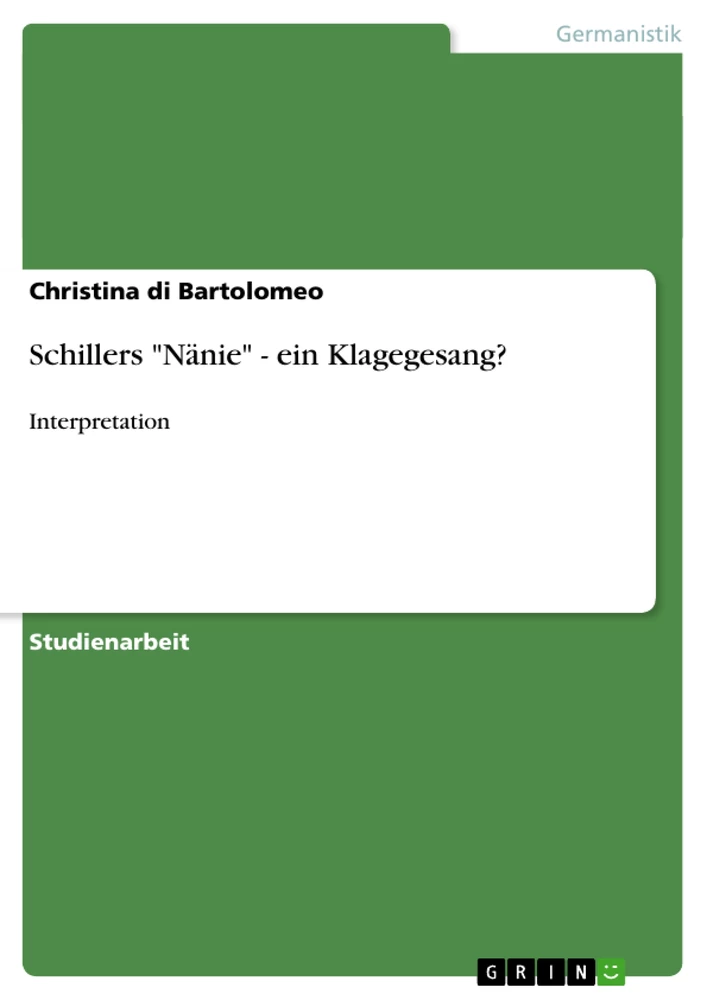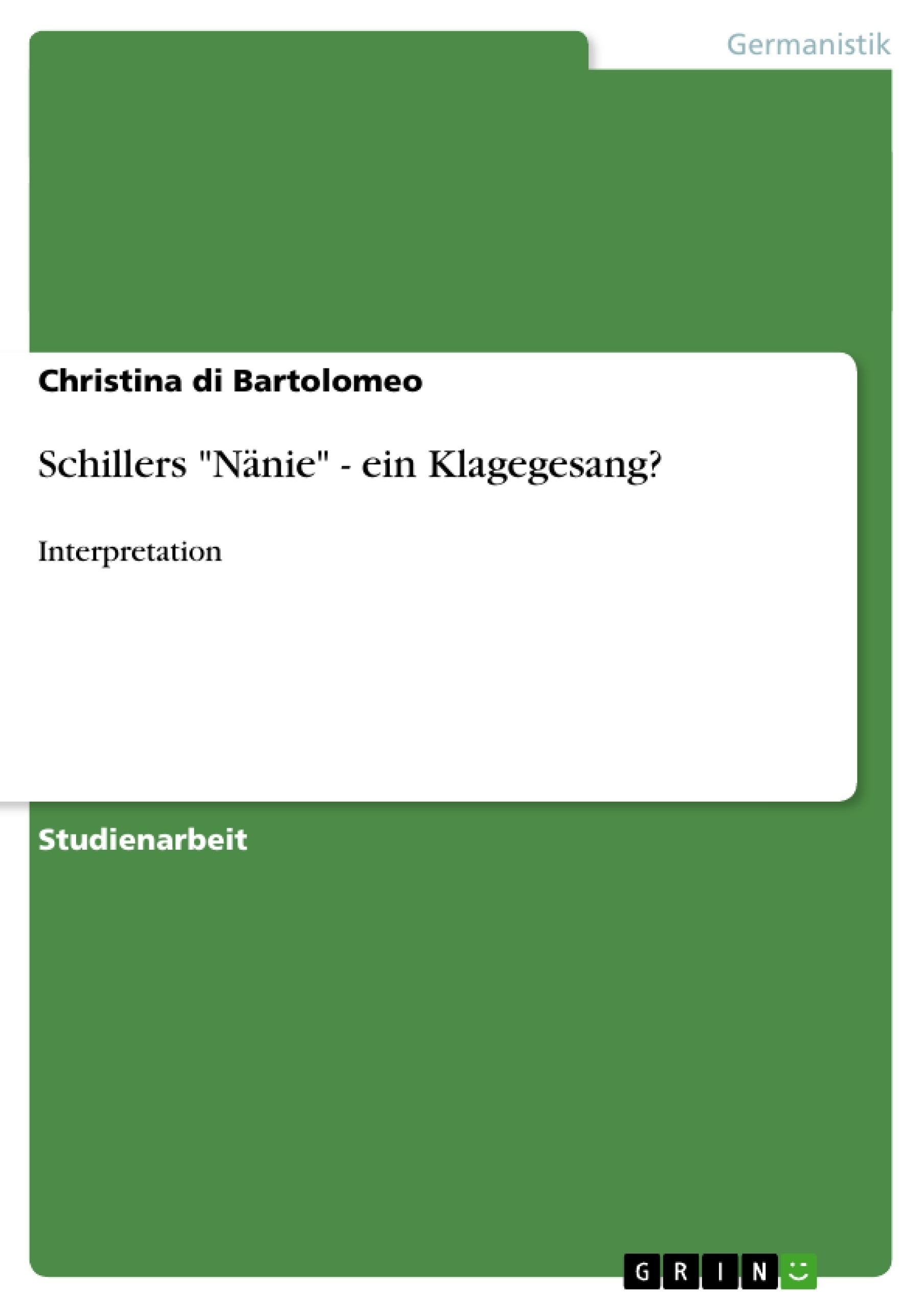Friedrich Schillers Nänie wird heute allgemein als eines der schönsten deutschen Gedichte angesehen. Was genau die Faszination des Gedichts in unserer Zeit ausmacht kann vielleicht ansatzweise in der folgenden Interpretation geklärt werden. Es geht aber vor allem darum, den von Schiller ausgeführten mythologischen Bezügen auf den Grund zu gehen, da diese für den heutigen Leser nicht mehr so offensichtlich zu verstehen sind, wie es für die Zeitgenossen Schillers der Fall war.
Da es sich dem Titel nach um einen Klagegesang, handelt wird der wesentliche Teil dieser Arbeit sich mit der Frage nach der Aussage des Gedichts beschäftigen. Es soll geklärt werden, inwiefern es sich bei der Nänie um eine Art Klagegesang handelt. Es bleibt vor allem zu klären, wen oder vielmehr was Friedrich Schiller in seinem Gedicht beklagt. Hierbei sind die verschiedenen Einflüsse und Anregungen wichtig. Der Hauptteil der folgenden Arbeit wird darauf verwendet, das Gedicht zu interpretieren und zu deuten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Entstehungsgeschichte
- II.1 Entstehungszeitpunkt
- II.2 Einflüsse
- III. Die mythologischen Bezüge in der Nänie
- IV. Formaler Aufbau
- V. Interpretation
- VI. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Friedrich Schillers Gedicht „Nänie“ und untersucht dessen Entstehungsgeschichte, mythologische Bezüge und Interpretation. Ziel ist es, die anhaltende Faszination des Gedichts zu beleuchten und die für den heutigen Leser möglicherweise weniger offensichtlichen Bezüge zu Schillers Zeit und Kontext zu erhellen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Klärung der Aussage des Gedichts und untersucht, was Schiller beklagt.
- Entstehungsgeschichte und Einflüsse auf Schillers „Nänie“
- Mythologische Bezüge und ihre Bedeutung
- Interpretation des Gedichts als Klagegesang
- Vergleich mit Werken anderer Autoren (Goethe, Louise Brachmann)
- Die Frage nach dem "Beklagten" in Schillers Gedicht
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die anhaltende positive Rezeption von Schillers „Nänie“ im Gegensatz zu ihrer eher unbedeutenden Resonanz zur Entstehungszeit heraus. Sie betont die Bedeutung der mythologischen Bezüge für das Verständnis des Gedichts und kündigt den Fokus der Arbeit auf die Interpretation des Gedichts als Klagegesang an, wobei die Frage nach dem "Beklagten" im Mittelpunkt steht. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der verschiedenen Einflüsse und Anregungen, die Schillers Werk geprägt haben.
II. Entstehungsgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte der „Nänie“, wobei der genaue Zeitpunkt aufgrund fehlender Quellenangaben umstritten ist. Es wird zwischen verschiedenen Entstehungsdaten spekuliert, basierend auf der Veröffentlichung im August 1800 und Schillers Korrespondenz mit seinem Verleger. Ein Unterkapitel behandelt die vielfältigen Einflüsse auf Schiller, insbesondere drei Klagelieder aus dem Jahr 1798 und Louise Brachmanns Gedicht, das möglicherweise als Inspiration diente. Die Diskussion umfasst Parallelen zu Goethes „Euphrosyne“ und vergleicht die verwendeten Motive und die Thematik des Trauerns um Verlorenes. Der Abschnitt zeigt die Komplexität der Einflüsse und Anregungen auf, die Schillers Werk prägten und verdeutlicht die Schwierigkeiten, einen präzisen Entstehungszeitraum zu bestimmen. Der Einfluss von Louise Brachmanns Gedicht, sowie Goethes Euphrosyne und der Bezug auf die Legende von Orpheus und Eurydike werden im Detail analysiert.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Nänie, Klagegesang, Mythologie, Entstehungsgeschichte, Interpretation, Goethe, Euphrosyne, Louise Brachmann, Orpheus und Eurydike, literarische Einflüsse, Trauer, Tod, Schönheit.
Häufig gestellte Fragen zu Schillers „Nänie“
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Friedrich Schillers Gedicht „Nänie“. Sie untersucht die Entstehungsgeschichte, die mythologischen Bezüge und bietet eine Interpretation des Gedichts. Ein Schwerpunkt liegt auf der Klärung der Aussage und der Frage, was Schiller beklagt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehungsgeschichte und die Einflüsse auf Schillers „Nänie“, die mythologischen Bezüge und deren Bedeutung, die Interpretation des Gedichts als Klagegesang, Vergleiche mit Werken anderer Autoren (Goethe, Louise Brachmann) und die Frage nach dem "Beklagten" im Gedicht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt: Einleitung, Entstehungsgeschichte (inkl. Entstehungszeitpunkt und Einflüsse), mythologische Bezüge in der Nänie, formaler Aufbau, Interpretation und Schlussfolgerung. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Wann entstand Schillers „Nänie“?
Der genaue Entstehungszeitpunkt ist aufgrund fehlender Quellen umstritten. Die Arbeit spekuliert basierend auf der Veröffentlichung im August 1800 und Schillers Korrespondenz mit seinem Verleger über verschiedene mögliche Entstehungsdaten.
Welche Einflüsse hatte die Entstehung von Schillers „Nänie“?
Die Arbeit untersucht verschiedene Einflüsse, darunter drei Klagelieder aus dem Jahr 1798 und Louise Brachmanns Gedicht, welches als mögliche Inspiration gilt. Parallelen zu Goethes „Euphrosyne“ werden analysiert und die verwendeten Motive und die Thematik des Trauerns um Verlorenes verglichen. Der Einfluss von Louise Brachmanns Gedicht, sowie Goethes Euphrosyne und der Bezug auf die Legende von Orpheus und Eurydike werden detailliert untersucht.
Wie wird die „Nänie“ interpretiert?
Die Arbeit interpretiert die „Nänie“ als Klagegesang und konzentriert sich auf die Klärung der Aussage des Gedichts und die Frage nach dem "Beklagten".
Welche Autoren werden im Vergleich zu Schiller herangezogen?
Die Arbeit vergleicht Schillers „Nänie“ mit Werken von Goethe (Euphrosyne) und Louise Brachmann.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Schiller, Nänie, Klagegesang, Mythologie, Entstehungsgeschichte, Interpretation, Goethe, Euphrosyne, Louise Brachmann, Orpheus und Eurydike, literarische Einflüsse, Trauer, Tod, Schönheit.
Wo liegt der Fokus der Arbeit?
Der Fokus liegt auf der Interpretation des Gedichts als Klagegesang und der Klärung der Aussage sowie der Frage nach dem "Beklagten". Die Arbeit beleuchtet die anhaltende Faszination des Gedichts und erhellt Bezüge zu Schillers Zeit und Kontext.
- Quote paper
- Christina di Bartolomeo (Author), 2005, Schillers "Nänie" - ein Klagegesang?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41744