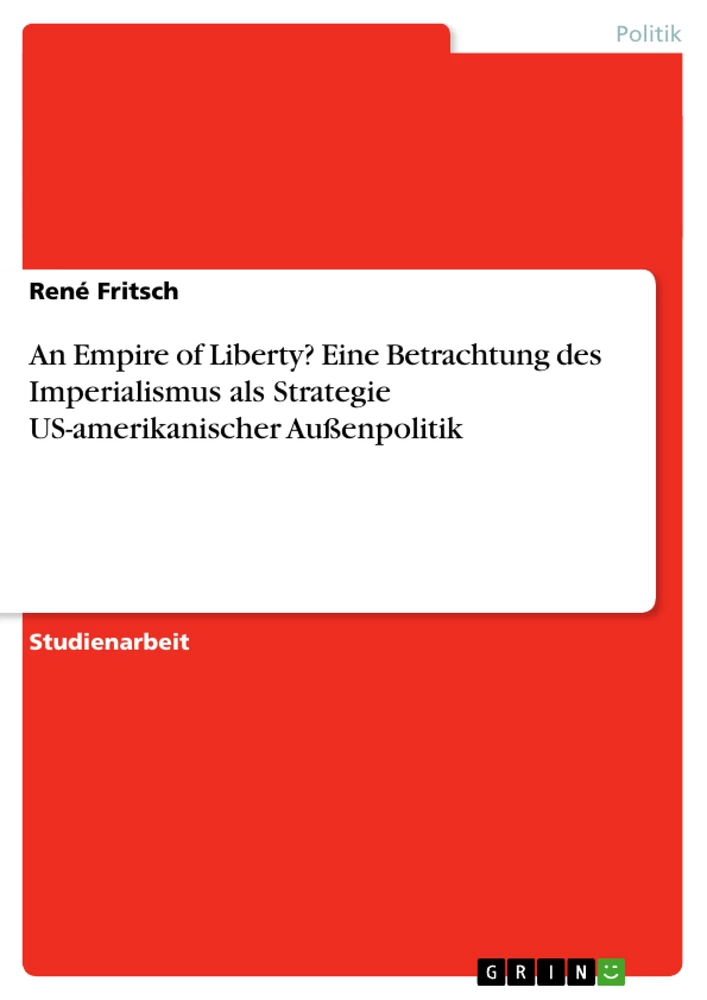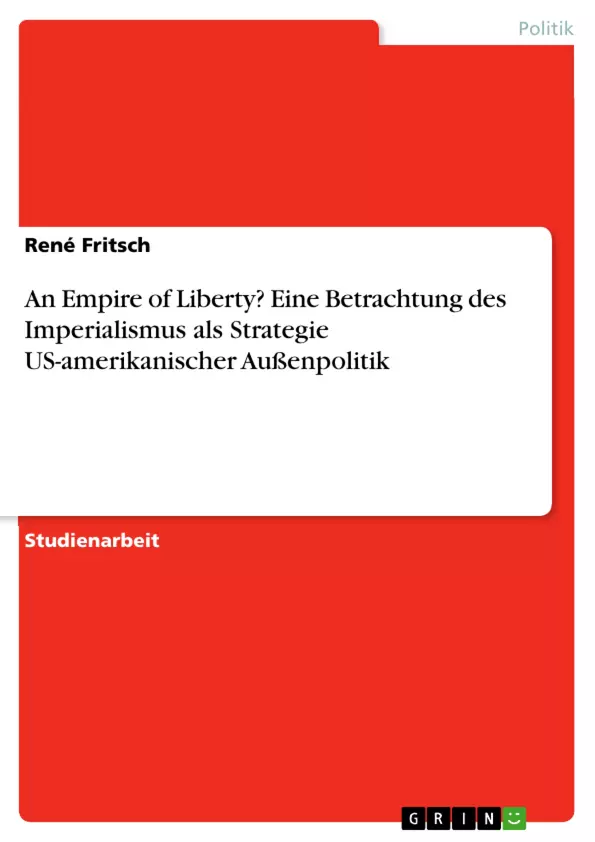Die vorliegenden Arbeit liefert eine kompakte Analyse der US-amerikanischen Außenpolitik und ihrer theoretischen Fundierung während der ersten Amtszeit von Präsident George W. Bush (2001-2004). Der dabei gewählte Blickwinkel ist derjenige der handelnden Akteure und ihres intellektuellen Umfelds. Im Verlauf der Arbeit wird die Hypothese überprüft, wonach die USA über eine lange und andauernde Tradition imperialistischer Politik verfügen, welche sich in ihrer Ausprägung von allen anderen bekannten Typen des Imperialismus unterscheidet.
Dazu wird zunächst das historisch gewachsene außenpolitische Selbstverständnis der USA beleuchtet. Es schließt sich eine systematische Wiedergabe der Empire-Debatte an, die in den Vereingten Staaten nach dem Ende des Kalten Krieges, also seit Beginn der 1990er Jahre, geführt wurde. Nach diesen theoretischen Erörterungen wird die konkrete US-Außenpolitik der ersten Administration George W. Bush mit Blick auf imperialistische Ausrichtungen untersucht. Hierbei bilden die drei klassischen politologischen Dimensionen Sicherheit, Wohlfahrt und Herrschaft den Rahmen der Analyse. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, in dem Theorie und Empirie miteinander verknüpft werden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DAS AUBENPOLITISCHE SELBSTVERSTÄNDNIS DER USA
- DIE EMPIRE-DEBATTE SEIT ENDE DES KALTEN KRIEGES
- KERNELEMENTE DER GESAMTSTRATEGIE GEORGE W. BUSHS
- SICHERHEIT
- WOHLFAHRT
- HERRSCHAFT
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die US-amerikanische Außenpolitik und ihre theoretische Fundierung aus der Perspektive der Akteure und ihres intellektuellen Umfelds. Insbesondere im Kontext der jüngeren Vergangenheit wird untersucht, ob der Begriff des Imperialismus angesichts zunehmender (Zivil-)Gesellschaften und schwächerer Staaten noch relevant ist.
- Die historische Entwicklung des amerikanischen Imperialismus
- Die Empire-Debatte in den Vereinigten Staaten nach dem Ende des Kalten Krieges
- Die aktuelle US-Außenpolitik unter der ersten Administration George W. Bush
- Die drei klassischen politologischen Dimensionen Sicherheit, Wohlfahrt und Herrschaft
- Verknüpfung von Theorie und Empirie im Fazit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Definiert den Begriff des Imperialismus und stellt die Forschungsfrage nach der Relevanz des Begriffs in der heutigen Zeit. Die Arbeit untersucht die These, dass die USA eine eigene Tradition des Imperialismus besitzen, die sich von anderen Formen unterscheidet.
- Das außenpolitische Selbstverständnis der USA: Erörtert die Wurzeln des amerikanischen Selbstverständnisses im Kontext der Staatsgründung und der Konfrontation mit dem Britischen Empire. Die Arbeit beleuchtet den ambivalenten Umgang mit dem Begriff „Empire“ in der frühen amerikanischen Geschichte.
- Die Empire-Debatte seit Ende des Kalten Krieges: Analysiert die Debatte um das amerikanische Imperium, die in den Vereinigten Staaten nach dem Ende des Kalten Krieges entstanden ist. Die Arbeit stellt die unterschiedlichen Perspektiven und Argumente innerhalb der Debatte vor.
- Kernelemente der Gesamtstrategie George W. Bush: Untersucht die aktuelle US-Außenpolitik unter der ersten Administration George W. Bush im Hinblick auf imperialistische Tendenzen. Die Arbeit analysiert die Strategie anhand der drei klassischen Dimensionen Sicherheit, Wohlfahrt und Herrschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet den Begriff des Imperialismus im Kontext der US-amerikanischen Außenpolitik. Zentrale Themen sind das außenpolitische Selbstverständnis der USA, die Empire-Debatte, die aktuelle US-Außenpolitik unter George W. Bush und die drei klassischen Dimensionen Sicherheit, Wohlfahrt und Herrschaft. Weitere wichtige Begriffe sind: Hegemonie, Zivilisation, öffentliche Güter, Souveränität.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff „Empire of Liberty“?
Es beschreibt das amerikanische Selbstverständnis, Freiheit und Demokratie weltweit zu verbreiten, was oft als moralische Rechtfertigung für imperialistische Strategien dient.
Welche Rolle spielte George W. Bush für den US-Imperialismus?
Während seiner ersten Amtszeit (2001-2004) verfolgte seine Administration eine Außenpolitik, die in der Forschung oft als modern-imperialistisch eingestuft wird, insbesondere im Bereich der Sicherheitspolitik.
Was sind die drei Dimensionen der Empire-Analyse?
Die US-Außenpolitik wird anhand der politologischen Dimensionen Sicherheit, Wohlfahrt und Herrschaft untersucht.
Wie unterscheidet sich der US-Imperialismus von klassischen Formen?
Die Arbeit prüft die Hypothese, dass die USA über eine eigene Tradition verfügen, die weniger auf territorialer Besetzung als vielmehr auf globaler Hegemonie und der Sicherung öffentlicher Güter basiert.
Was war die Empire-Debatte nach dem Kalten Krieg?
Nach 1990 diskutierten Wissenschaftler in den USA intensiv darüber, ob das Land nun die einzige verbliebene Supermacht sei und welche imperialen Verpflichtungen daraus erwachsen.
- Citar trabajo
- René Fritsch (Autor), 2004, An Empire of Liberty? Eine Betrachtung des Imperialismus als Strategie US-amerikanischer Außenpolitik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/41740